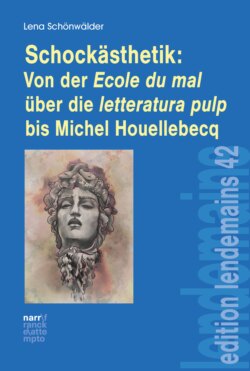Читать книгу Schockästhetik: Von der Ecole du mal über die letteratura pulp bis Michel Houellebecq - Lena Schönwälder - Страница 16
1.2.5 Das Obszöne
ОглавлениеDem Ekel bzw. dem Ekelobjekt als Wirkungskategorie in gewisser Weise anverwandt ist auch das Obszöne. Zwar handelt es sich hierbei im Unterschied zum Ekel nicht um einen Primäraffekt, sondern vielmehr um ein Zuschreibungsphänomen, das ihm jedoch in seiner Wirkungsweise durch die Intensität der produzierten Emotionen (die bisweilen gar den Ekel involvieren können) nahekommt. Was dabei ganz konkret obszön eigentlich ist, erweist sich als schwer fassbar. So lauten Ludwig Marcuses einleitende Worte zum Vorverständnis des Obszönen in seiner Monographie Obszön. Geschichte einer Entrüstung wie folgt: »Das lehrt die lange Geschichte: obszön ist, wer oder was irgendwo irgendwann irgendwen aus irgendwelchem Grund zur Entrüstung getrieben hat. Nur im Ereignis der Entrüstung ist das Obszöne mehr als ein Gespenst.«1 Dieses obszöne »wer oder was« betrifft dabei vornehmlich den Sexual- oder Fäkalbereich und kennt laut Duden eine Vielzahl an Synonymen: anrüchig, anstößig, anzüglich, doppeldeutig, frivol, nicht salonfähig, pikant, pornographisch, schamlos, unanständig, zweideutig; dreckig; nicht stubenrein, schlüpfrig, schmutzig, zotig; ordinär; unflätig; vulgär; schweinisch, säuisch. Zwar lässt es sich mit einer Vielzahl von Begriffen be- und umschreiben, bleibt aber dennoch im Kern schwer greifbar – nicht zuletzt, da es sich um eine äußerst subjektive Erlebniskategorie handelt, die sich kaum empirisch fassen lässt. Es sei »eine Gleichung mit mindestens sechs Unbekannten«, so Marcuse, was jedoch besonders auch die Justiz in der Vergangenheit nicht davon abgehalten hat, sich an einer Definition zu versuchen.2 Zweifellos ist das Obszöne (in der Kunst) historisch wandelbar: Die Texte, derer sich Marcuse annimmt – Friedrich Schlegels Lucinde (1799), Flauberts Madame Bovary (1857) und Baudelaires Fleurs du mal (1857), D.H. Lawrences Lady Chatterley’s Lover (1960), Henry Millers Tropic of Cancer (1934) –, sind indessen längst in den Kreis kanonischer Höhenkammliteratur aufgenommen worden. Laut Stefan Morawski in einem Aufsatz mit dem Titel »Art and Obscenity« aus dem Jahre 1967 erklärt sich dies durch die zunächst falsche Rezeption der betreffenden Texte: Es handele sich um ein Missverständnis zwischen einem Werk, das im Grunde nicht den geringsten Angriff auf die sexuelle Imagination ausübe, und einer Leserschaft, die es nach nicht-ästhetischen Standards gemäß ihren eigenen moralischen Tabus beurteilen würde. So erläutert Morawski, dass das obszöne Zeichen durchaus nicht mit einem Mangel an Literarizität einhergehe und führt aus, wie es künstlerisch transformiert, quasi neutralisiert werden könne, indem es im Medium der Sprache symbolhaften Charakter erhält, ästhetisiert, intellektualisiert und poetisiert wird.3 Die Werke Millers und Lawrences dürften nicht in Hinblick auf die explizite Darstellung sexueller Handlungen hin gelesen werden, sondern in Hinsicht auf den poetischen und philosophischen Gehalt, der sie von der gemeinen Pornographie absetze.4 Hier wird die Problematik des Obszönen in der Kunst ganz deutlich: Es bedarf dessen Rechtfertigung (poetischer, inhaltlich-struktureller, philosophischer Natur), um den Kunstcharakter nicht einzubüßen. Ist es dergestalt nicht plausibilisierbar, driftet das Obszöne ab in die Pornographie, die wie folgt definiert wird:
gesteigerte Form der erotischen Lit. mit ästhetisch, kompositorisch, stilistisch und lit. wertlosen, ausführl. Beschreibungen geschlechtl. Vorgänge (Geschlechtsverkehr, Sexualpraktiken, Perversionen), ohne jeden qualifizierten Kunstanspruch mit der zentralen Wirkungsabsicht sexueller Stimulierung und daher stets unoriginell, monoton in Wiederholung und Steigerung (›Nummerndramaturgie‹) und das schickliche Maß des noch vertretbaren Geschmacks zum Obszönen hin übersteigend. […] Auch die Lit. kann sehr wohl in kompositorisch vertretbarem Maß und aus dem ehrl. Streben nach Erfassung des ganzen Menschen in Einzelszenen (›Stellen‹) zu e. erot. Realismus in der Darstellung des Sexuellen gelangen, aber sie wird die Darstellung der Sexualsphäre stets nur als Mittel zum Aufzeigen menschl. Befindlichkeit, nicht aber als Selbstzweck oder in nur triebsteigernder Absicht benutzen.5
Das Pornographische ist also nicht-literarisch und verfolgt eine andere Wirkungsstrategie als das obszöne Kunstwerk; es will nichts anderes als die körperliche Erregung: »Sie verlangt nicht vergrößerte geistige Anstrengung, sie will entspannen. Sie lebt geradezu von der Verleugnung und Tabuisierung des Geistigen.«6 Doch diese Form der körperlichen Lust am Text ist eine nicht-ästhetische und von literaturwissenschaftlicher Warte aus zunächst problematische Lust.7 In Karl Rosenkranz’ 1853 erschienener Ästhetik des Häßlichen ist diese Form der Erregung gänzlich verpönt: »Alle Darstellung der Scham und der Geschlechtsverhältnisse in Bild oder Wort, welche nicht in wissenschaftlicher oder ethischer Beziehung, sondern der Lüsternheit halber gemacht wird, ist obszön und häßlich« (meine Hervorhebung).8 Pikante Darstellungen des Sexuellen sind also nur dann lizenziert, wenn sie einem höheren Zweck dienen, so z.B. in der Satire der korrigierenden Belehrung. Dass aber gerade diese kreatürliche Lust weitestgehend ausgeblendet wird, muss theoretisch widersinnig erscheinen, wenn es doch die Literatur ist, die die höchsten Empfindungen hervorzurufen vermag:
Generationen von Lesern Shakespeares und Schillers und Byrons und Dostojewskis danken den Meistern ungeheure Steigerungen der Emotionen. Mit Ausnahme der sexuellen? Indem die sogenannten Liberalen leugneten, daß die große Literatur die erotische Phantasie stachle, verdeckten sie höchst illiberal einen ihnen unbequemen Zustand der Dinge. Sie wollten unter keinen Umständen den Boden der Tradition verlassen, die vorschrieb: das Geschlechtliche ist nur zugelassen, wenn es im poetischen Äther verdunstet.9
Dass das Faktum des Obszönen im Kunstwerk nach wie vor problematisch ist und eine Unterscheidung von obszön und pornographisch vorgenommen wird, zeigt die bereits zitierte, relativ aktuelle Definition von Pornographie aus dem Jahre 2001.10
In der Postmoderne schließlich wächst das Interesse im Besonderen an de Sade und die pornographische Kunst (man verzeihe das vermeintliche Oxymoron) wurde damit quasi zu einer neuerlichen Erkenntnisquelle promoviert.11 Auch hier sei erneut auf Bataille verwiesen, der einerseits mit seinen Sachschriften L’Érotisme (1957) und La Littérature et le mal (1957), andererseits aber auch mit seinem sogenannten obszönen Prosawerk (L’Histoire de l’œuil, 1967; Madame Edwarda, 1956; Ma Mère, 1966; Le Petit, 1963; Le Mort, 1967) den Bereich der Sexualität und des Obszönen (neben dem Bösen) als Raum der Überschreitung und Verausgabung herausarbeitete, der in scharfer Opposition zur Herrschaft der Vernunft in der modernen Gesellschaft steht. Susan Sontag stellt denn in ihrem Aufsatz »Die pornographische Phantasie« (1968) auch fest, dass die der Pornographie attestierte Eindeutigkeit der Wirkungsabsicht indessen gar nicht so transparent ist, wie stets angenommen:
Die körperlichen Empfindungen, die ungewollt im Leser erweckt werden, enthalten etwas, das die ganze Erfahrung seiner Menschlichkeit – und seiner Grenzen als Persönlichkeit und als Körper – betrifft. In Wahrheit ist die Eindeutigkeit der Intention in der Pornographie unecht. Nicht hingegen die Aggressivität, die in dieser Intention zum Ausdruck kommt. Was in der Pornographie Endzweck zu sein scheint, ist ebenso sehr ein Mittel von alarmierender und bedrückender Konkretheit. Der Endzweck freilich ist weniger konkret. Die Pornographie ist […] ein Zweig der Literatur, der auf Desorientierung, auf psychische Verwirrung, ausgerichtet ist.12
Sontag trifft hier eine Aussage über die Wirkungsweisen der Pornographie (und sicherlich auch des obszönen Zeichens), die sich mit den Schlüsselbegriffen »Aggressivität« und »Unausweichlichkeit« auf den Punkt bringen lässt. Implizit ist damit ausgedrückt, dass die Pornographie die Überwindung der ästhetischen Differenz sucht und naturgegebene körperliche Reaktionen aktivieren will, die nicht der Verstandeskontrolle unterliegen. Und damit ist der basalste aller Bereiche des Menschen angesprochen: das Andere der Ratio, die Sexualität. Diese jedoch wird im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang nicht frei ausgelebt, sondern durch Regeln und Konventionen reguliert, die sich zu Tabus verdichten.13 Gesellschaftliche Tabus wiederum bestimmen die Schamgrenzen, die im Falle des obszönen Zeichens überschritten werden.
Dieser ›Übergriff‹ auf den Rezipienten gestaltet sich in Hinblick auf die Intensität auf vergleichbare Weise wie bei den anderen Grenzphänomenen des Ekels oder des Grausam-Erhabenen. Doch unterscheidet sich das obszöne Zeichen in seiner Substanz von z.B. dem ekelauslösenden Gegenstand. Die kritische Grenze wird beim Ekelaffekt meist erst durch Akkumulation semantisch verwandter Bedeutungsträger erreicht, während das obszöne Zeichen bereits für sich allein als Signal stehen kann. Diese Beobachtung trifft Wolf-Dieter Stempel in seinem Aufsatz »Mittelalterliche Obszönität als literarästhetisches Problem« (1968). Ob seiner Transparenz sei der betreffende Passus in ganzer Länge zitiert:
Obszönität wird aber auch, und hierin unterscheidet sie sich merkmalhaft von den Vergleichsphänomenen [Grausamkeit, Ekel], in der Substanz fassbar. Erhält z.B. ein komplexer Akt der Grausamkeit ein einziges sprachliches Zeichen (foltern), so liegt diesem ein synthetisches Urteil zugrunde, das aus der Distanz gewonnen wird. Die verschiedenen Aspekte des Vorgangs werden verarbeitet auf einen Nenner gebracht. Maximalnenner, bei welchem die größtmögliche Distanz erreicht wird, ist grausam, eklig, obszön (er war grausam, der Anblick war ekelerregend usw.). Der erzielte Abstand bemißt sich natürlich nach dem Grad der Synthese, sowie nach der Anschaulichkeit des gewählten Ausdrucks (cf. crever les yeux im Unterschied zu blenden), doch geschehen diese Regulierungen innerhalb der jeweils gegebenen Distanzspanne. Die Vorstellung des Zuhörers oder Lesers wird dementsprechend nur schwach affiziert, die der Phantasie vermittelte Anregung zur gedanklichen Entfaltung des Vorgangs bleibt gering. Anders im Fall der Obszönität, wo das synthetische Zeichen eines entsprechenden Vorgangs Signal für eine intensivere gedankliche Detaillierung sein kann, die auf Grund eines über die Intimität verhängten Tabus je nachdem insgeheim erwünscht oder als Zumutung abgewiesen werden kann. Die kritische Anfälligkeit des synthetischen Zeichens für skabröse Inhalte erweist sich auch daran, daß es, von anderen Möglichkeiten der Kaschierung abgesehen, oft in eine Abstraktion zweiten Grades erhoben wird, indem der gewählte Ausdruck, z.B. für den Beischlaf, in einem größeren semantischen Bereich angesiedelt wird (cf. afrz. faire l’uevre ›das Werk tun‹ u.ä.) und das Gemeinte sich nur indirekt auf dem Weg über den Kontext bestimmen läßt. Diese Erscheinung, bei der der Abstand zum signifié nicht sekundär verändert, sondern überhaupt überlagert wird von einem semantischen Gefälle, ist z.B. bei der Darstellung von Grausamkeit oder Häßlichkeit kaum wahrzunehmen oder erreicht dort jedenfalls nicht die gleiche Bedeutung; sie gilt in besonderem Maße auch für die Bezeichnung von einzelnen Dingen der Intimsphäre (Körperteile, körperliche Funktionen usw.), wofür die anderen Grenzbereiche insgesamt nur wenig Analoges bieten. Daraus folgt zugleich ein wichtiger Unterschied in der semantischen Strukturierung: während z.B. bei Häßlichkeit, Ekelhaftigkeit die kritische Grenze erst quantitativ erreicht wird, ohne daß die einzelnen Bestandteile der Beschreibung (wie z.B. krumme Nase) selbst schon auf die Grenze verweisen, besitzt das obszöne Detail (z.B. con) unter gegebenen Umständen bereits einen kritischen Eigenwert; die Summierung kann also hier sozusagen im Sinne einer offenen Reihe erfolgen, dort ist sie geschlossen, bis der kritische Grad vorliegt.14
Das obszöne Detail kann demnach einen höheren Grad der Involvierung erfordern, je nachdem wie direkt bzw. indirekt es beschaffen ist und in welchem Kontext es auftritt. Während der ekelerregende Gegenstand quasi stets nur er selbst ist und auf sich selbst verweist, kann Obszönität gleichermaßen im Uneigentlichen verborgen sein, quasi im Hinterhalt lauern. Es kann aber darüber hinaus auch in seiner schieren Präsenz wirken, ist irreduzibel, sofern es sich in seiner Isoliertheit dem Rezipienten aufdrängt.
Obszönität ist, wie eingangs beschrieben, ein Zuschreibungsphänomen. Zwar können inhaltlich Bereiche benannt werden, die das Obszöne betrifft (Sexualität, Fäkalbereich etc.), doch muss ein obszönes Zeichen eben nicht notwendigerweise einen Gegenstand bezeichnen, der diesen Domänen angehört. So können Körperfunktionen oder Geschlechtsorgane auf völlig unanstößige Weise besprochen werden, z.B. in einer medizinischen Abhandlung. Im Umkehrschluss kann dann ein per se kaum anzüglicher Gegenstand in der Darstellung zum Stein des Anstoßes werden.15 Zutreffender wäre es also gegebenenfalls, von einem Modus der obszönen Darstellung zu sprechen, der in der konkreten Umsetzung auf unterschiedliche Weise realisiert werden kann. Und dabei ist es der Darstellung des Ekelhaften oder Grausamen in gewisser Weise diametral entgegen gestellt: Denn während beispielsweise die zerlegende, detaillierte Schilderung einer brutalen Schlacht durch die Aneinanderreihung blutiger Einzelheiten den kritischen Punkt des Nicht-Mehr-Erträglichen erreichen kann, ist es möglich, dass im Falle des obszönen Zeichens die kaum variierende Wiederholung des Anrüchigen zur Entkräftung der Obszönität beiträgt.16
In Bezug auf die »Kleinstruktur der Obszönität« macht Stempel ferner – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – aufschlussreiche Beobachtungen, die die Wirkungsweisen bzw. die Beschaffenheit des obszönen Zeichens beleuchten.17 Erstens kann es isoliert und damit durch den Zusammenhang nicht motiviert oder aber funktionalisiert als strukturgebendes Element auftreten (z.B. Decameron I, 4, wo das Erotische Grundlage für die pointierte Auflösung der Novelle ist). Überdies stellt sich zweitens die Frage nach der Aktualisierung des Zeichens, d.h.: Auf welcher Diskursebene tritt es auf? Ist es beispielsweise Teil der Rede, dann wird es als Gegenstand der Reflexion distanzierend entschärft; als Teil des récit tritt es dem Rezipienten jedoch ungleich unmittelbarer gegenüber. Auf der histoire-Ebene wiederum kann es distanzschaffend wirken, wenn sich die Geschichte in zeitlicher Distanz zu der Lebenswelt des Lesers abspielt oder aber im umgekehrten Fall deutlich nähestiftend, wenn sie in der Gegenwart des Rezipienten angesetzt ist. Insgesamt sind sämtliche Kunstgriffe, die den Eindruck von Präsenz und Unmittelbarkeit erwecken sollen (z.B. historisches Präsens als Tempus der unmittelbaren Vergegenwärtigung) dazu geeignet, das obszöne Zeichen in die Nähe des Rezipienten zu rücken. Und schließlich wird, wie bereits erwähnt, relevant, wie sich das Verhältnis von Beschreibung bzw. Zerlegung und zeitraffendem récit gestaltet. Drittens kann das obszöne Zeichen in der Sonderform der Metapher auftreten, welche das eigentlich Gemeinte durch Zweideutigkeit verhüllt. Auch Rosenkranz empfiehlt die Metapher als adäquate Form der Verschleierung, die das eigentlich Obszöne dem Betrachter entrückt.18 Doch kann sie paradoxerweise gerade dadurch effektsteigernd wirken, z.B. durch die plötzliche Anreicherung eines vermeintlich harmlosen Sinnes durch ein weiteres, pikantes Signifikat.19 Somit ist das obszöne Zeichen nicht einfach auf krudes, eigentliches Sprechen zu reduzieren, sondern im Gegenteil ließe sich mit Preisendanz die These aufstellen: »je größer der literarische Aufwand ist, desto mehr kann das Sexuelle im Leser zum factum brutum werden«.20
Letztlich aber bleibt das Obszöne im Grunde diffus bzw. historisch und kulturell variabel. Die hier angestellten Ausführungen sind natürlich nicht exhaustiv, führen aber die besondere Problematik des Werturteils »obszön« vor. An dieser Stelle kann Sandra Schwab sicherlich zugestimmt werden, wenn sie schreibt: »Vielleicht ist obszön kein ontologisch zu bestimmender Wert, sondern ein ästhetisches Urteil wie gut oder hässlich, um nur zwei Beispiele zu nennen.«21