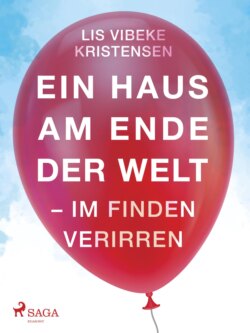Читать книгу Ein Haus am Ende der Welt - Im Finden verirren - Lis Vibeke Kristensen - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wladimira
ОглавлениеKeine Ehrendelegation wartet vor der Polizeiwache.
Kein Journalist hat an ihrem Schicksal Interesse gezeigt. Die internationale Presse hat in dem Moment, als das Turnier entschieden war, die Insel wie ein Heuschreckenschwarm verlassen, und Reykjavík kehrt mit einem Seufzer der Erleichterung zur Normalität und zu wichtigeren Nachrichten über den Fischereikrieg und die Grenzen der Hoheitsgewässer zurück.
Wladimira ist bestenfalls bedeutungslos, schlimmstenfalls eine Belastung der internationalen Beziehungen, ein Fleck auf dem frisch gereinigten Anzug irgendeiner Person.
Wenn er doch bloß mit ihr zusammengeblieben wäre, dann wären sie ein gefragtes Paar. Niemand fragt nach ihren Geschichten. Ohne ihn gibt es sie nicht.
Eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung kann man ihr anbieten und Geld für das Nötigste.
Ein paar vernünftige Halbschuhe statt ihrer havarierten Pumps. Eine Strickjacke. Ein Regenponcho. Alles unglaublich teuer. Ein Schirm für den strömenden Herbstregen liegt definitiv außerhalb ihrer Möglichkeiten.
Notdürftig eingekleidet. Weder hungrig noch satt. In der Warteschleife, ohne zu wissen, worauf sie wartet und was sie zu erwarten hat, wenn überhaupt etwas.
Eine Matratze vom Speicher der Nachbarin stellt ihr Nachtlager dar. Die Wolldecke taucht wie ein Wunder auf, Edda hat sie von der Heilsarmee bekommen. Sie ist grau und so schwer, als sei sie durch und durch feucht.
Wladimira hat ihr ganzes Leben beengt und umgeben von Menschen verbracht, und es macht ihr nichts aus, am Fußende von Eddas Bett zu schlafen, zu ihren leisen Seufzern und Schmatzern einzuschlafen und von ihrem Schnarchen zu erwachen.
Zu zweit sitzen sie am Wachstuch des Tisches, erwachsene Frauen mit gesundem Appetit. Edda reicht ihr die Töpfe, und Wladimira beobachtet sich selbst, wie sie einmal von dem Fisch, den Kartoffeln und der dicken weißen Sauce nimmt und noch einmal und noch ein weiteres Mal, also mindestens einmal zuviel, und trotzdem fühlt sich ihr Magen immer noch leer an.
Edda sieht weg, sie trinkt einen Schluck Milch und leert das Glas dann mit zwei, drei weiteren Schlucken. Ihr Blick schweift in die Ferne. Etwas hinter Wladimiras Schulter muß interessant sein, vielleicht ist es aber auch peinlich, daß jemand soviel essen kann, obwohl er nicht dafür bezahlt hat, aber Edda sagt nichts, sondern räumt einfach die Teller vom Tisch und spült sie unter fließendem Wasser ab.
Wladimira hält beide Hände ins warme Schwefelwasser des Spülbottichs und planscht mit der Spülbürste zwischen Geschirr und Gläsern, bis alles blitzt, einer der wenigen genüßlichen Momente im Verlauf der grauen und eintönigen Tage.
Das Spülen hat sie übernommen, die Böden putzt sie jeden Freitag, und während Edda bei der Arbeit ist, staubt sie die Möbel ab und schrubbt die kleine Toilette mit einem stark riechenden Pulver. Das ist das mindeste, was sie tun kann. Edda läßt sie nie spüren, daß sie ihr im Weg wäre oder daß sie etwas von ihr erwarten würde. Ihr bisheriges Leben war angefüllt mit Pflichten, Studien, Arbeit, Planung, Eilaufträgen und Verrichtungen, mit Sorge um die Mutter und unermüdlichen, täglichen Besorgungen für den Haushalt, mit Hamstern, Tauschhandel, Kopfrechnen und raschen Kaufentschlüssen, ehe ihr jemand zuvorkam. Jetzt sind ihre Tage konturlos und so durchsichtig wie eine Qualle.
Edda badet jeden Tag in der Badeanstalt, aber das kostet Geld, mehr als Wladimira annehmen kann.
Es ist auch so schon zuviel. Das Essen. Die Seife, mit der sie sich wäscht. Die samtweichen Binden aus dem Kleiderschrank, von denen ihr Edda welche abgibt, ein unglaublicher Luxus.
Wladimira wäscht sich mit einem Waschlappen in der Küche. Einmal in der Woche kocht sie den Lappen und ihre Unterhosen in einem Topf auf dem Herd aus und wäscht ihre Hemdbluse, ihren Büstenhalter, der mit immer größerer Mühe sauber wird, und das eine ihrer zwei Paar Strümpfe mit der Hand. Edda hat ihr gezeigt, wie das geht. Edda ist geschickt mit den Händen. Bei ihr sieht alles immer so unkompliziert aus. Sie verschüttet nie Spülwasser auf dem Küchenfußboden und verbrüht sich auch nicht am Dampf des Wasserkessels, so daß sie Margarine auf die Brandblasen schmieren muß.
An ihrem freien Tag schläft Edda lange, und für die Ruhepause nach der Arbeit und nach dem Besuch der Badeanstalt, die sonst immer eine Stunde dauerte, braucht sie in letzter Zeit zwei. Die Wochen vergehen, und es werden drei oder vier.
Bald verbringt Edda die Nachmittage in Gesellschaft eines Büchereibuchs im Bett, isländische Klassiker, die sie Wladimira anbietet. Diese lehnt höflich ab. In ihrem Kopf ist kein Platz für fiktive Personen. Und das, obwohl ihre Mutter keine Aufmerksamkeit von ihr fordert.
Edda legt das Buch neben sich auf den Fußboden. Die Decke rutscht hoch, und Wladimira sieht einen nackten Schenkel. Er ist kräftig und hat kleine Vertiefungen. Darüber rundet sich der Bauch.
»Willst du eine Arbeit?«
Eine Arbeit. Edda hat zwei, Putzen in der Sporthalle und dann noch drei Stunden in der Gemeindeverwaltung, nachdem dort die Angestellten Feierabend gemacht haben. Der Lohn reicht mehr als genug für den Lebensunterhalt. Wladimira hat sich schon gedacht, daß sie den einen übernehmen könnte, aber sie hat nichts gesagt. Die Veränderungen sollen von Edda ausgehen, wenn die Zeit reif ist.
»Eine Arbeit?«
»Bald. In ein paar Monaten. Du kannst meine übernehmen. Vielleicht beide.«
Edda lächelt. Edda lehnt sich ins Kissen zurück, eine große, zufriedene Katze, und klopft mit einer kräftigen und breiten Hand auf die Decke. Allmählich begreift Wladimira, was alle außer ihr schon längst begriffen haben müssen.
Edda nimmt unentwegt zu, aber seit Wladimira in der Wohnung wohnt, ist kein Mann in Eddas Gesellschaft zu sehen gewesen. Es wurde auch kein Mann erwähnt.
Der Vater muß ein verheirateter Mann sein. Oder vielleicht enthalten die Briefe mit den französischen Briefmarken, die durch den Briefkastenschlitz in der Tür fallen, oder das Fotoalbum, in das sie dreisterweise, während Edda bei der Arbeit ist, hineinguckt, eine Erklärung. Ein rotes Album mit undurchschaubaren Schnappschüssen von Möbeln, Fischerbooten und Männern in Ölzeug, von Häusern aus Feldstein und von einer niedrigen, grauen Kirche.
Ein unscharfes Bild zeigt einen Mann, und seine vom Blitz roten Augen erinnern an die einer Ratte. Es handelt sich um einen älteren, dicklichen Mann, und wenn Wladimira überhaupt etwas glaubt, dann, daß er ein Verwandter von Edda sei, obwohl er ihr alles andere als ähnlich sieht, aber vielleicht muß sie ihre Überzeugung ja revidieren.
Edda summt den ganzen Tag lang. Eddas Freundinnen kommen mit vollen Tüten vorbei, und kleine Kleidungsstücke türmen sich auf dem Spitzendeckchen der Kommode, außerdem Stapel von Windeln und Flanelltüchern. Die abgelegten Kindersachen in Blau, Rosa und Weiß – denn man weiß ja nie – würden für ein ganzes Kinderheim reichen.
»Es wird ein Mädchen.«
Gunlaug leert eine Tüte mit gehäkelten Jacken in Grellrosa und Windelhöschen aus weicher, ungefärbter Wolle aus.
Gunlaug und Edda trinken Kaffee, und selbst die wortkarge Edda redet wie ein Wasserfall. Wladimira nippt an ihrer Tasse und hat nichts beizutragen.
Gunlaug hat ihr erstes Kind mit siebzehn bekommen, jetzt sind es vier. Die Älteste hat Gunlaug bereits zur Großmutter gemacht, der Jüngste ist gerade erst eingeschult worden, und vielleicht werden es noch mehr.
»Man weiß es nie.« Gunlaug lacht und schiebt noch ein Stück Pfannkuchen zwischen ihre nikotingelben Zähne. Edda und sie brechen bei jeder Kleinigkeit in prustendes Gelächter aus. Man hat das Gefühl, die Wände der kleinen Wohnung könnten jeden Augenblick unter dem Druck von Fleischlichkeit, Fruchtbarkeit und Ausgelassenheit nachgeben. Wladimira sucht in dem einen der beiden Lehnstühle ganz hinten in der Ecke Schutz und verschanzt sich hinter der Zeitung, während sie darauf wartet, daß Gunlaug verschwindet und Edda wieder einschläft.
Sie liest auf der Jagd nach Neuigkeiten über ihn jedes Wort und jede Silbe, aber die Welt hat das Interesse verloren. Nur in Wladimiras Gedanken ist er immer noch präsent. Wenn sie es nur wagte und wenn Edda nur zuhören würde, könnte sie ihn mit Worten wieder erstehen lassen. Ihn wieder lebendig und präsent machen.
Die Scham hält sie zurück. Die Scham darüber, im Stich gelassen worden zu sein, etwas riskiert und verloren zu haben, eine lächerliche, betrogene Frau zu sein. Fortwährend arbeitet sie an einer Deutung, die sie über die Lippen bringen kann.
Edda ist zu sehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, als daß es einen Sinn gehabt hätte.
Und dann kommt der Tag, an dem es an der Tür klopft, laut und anhaltend. Es wird zu einem Gehämmer mit etwas, was wie eine Keule klingt, wobei es sich aber um Fäuste handelt, und der Treppenaufgang hallt von wütenden Rufen wieder.
Eddas Name, immer wieder, aber Edda ist auf ihrem rostigen Fahrrad zum letzten Job dieses Tages losgeeiert, und sie erwartet sie so bald nicht zurück. Wladimira hält den Atem an und versteckt sich in der Küche, bis die schweren Schritte endlich die Treppe hinabdonnern.
Aus dem Küchenfenster sieht sie den riesigen Körper eines Mannes den Bürgersteig entlangstampfen, allein seine Größe jagt einem Angst ein. Die heisere, volltrunkene Stimme prallt an die Scheibe, und jetzt stolpert er dort unten auf der Straße und fällt fast um. Vielleicht ist er es ja.
Vielleicht ist er der Vater von Eddas Kind, und wenn er es ist, dann wird er zurückkommen, und zwar immer wieder, bis man ihn einläßt. Die Wohnung ist nicht groß genug für sie alle. Wladimira macht sich bereits Sorgen darüber, wie es gehen soll, wenn das Kind kommt.
Eddas Summen verstummt, als sie von dem Mann hört. Eddas rosenrote Wangen erblassen unter ihrem Flaum. Sie packt rasch eine Tasche mit Nachthemd, Zahnbürste und einem der dicken Romane aus der Bibliothek, und dann nichts wie weg.
Gunlaug empfängt sie mit offenen Armen. Ihr Zweitältester befindet sich auf einer langen Reise mit einem Frachter, sein Bett ist frei, und das Essen reicht immer für einen weiteren Esser.
»Du darfst ihn niemals reinlassen«, sagt Edda, »versprich mir das.« Wladimira verspricht es, und dann steht Edda wieder unten auf der Straße, und in Wladimiras Kopf findet sich nur ein Wort.
Preisgegeben.
Geräusche schwerer Schritte auf einer Treppe. Unerbittliches Klopfen, bis die Tür geöffnet wird, hier beschützt dich niemand, jemand hat das Recht oder nimmt es sich einfach, deine Grenzen zu überschreiten und dich deines letzten Restes Macht zu berauben, die dir geblieben ist, der Macht über deinen Körper und dein Leben.
In der Wohnung zu sitzen und darauf zu warten, daß er zurückkehrt, ist keine Alternative.
Die Stadt ist an diesem blauschwarzen Abend eiskalt und abweisend, und sie hat ihre Angst nicht artikulieren wollen, denn was hätten Edda und Gunlaug schon tun sollen.
Sie lenkt ihre Schritte ins Stadtzentrum und streift durch die Straßen, bis ihre Beine sie nicht mehr tragen. Der Mann ist nicht dort, nur andere Männer mit lauten Stimmen, geröteten Gesichtern und großen Jacken, die schwanken und taumeln und versuchen, sich am Wellblech der Hausfassaden abzustützen. Es sind mehr als sonst, selbst für einen Zahltag. Flüchtlinge vor einem Vulkanausbruch überschwemmen die Stadt, und das müßige Warten in den Häusern und Wohnungen von Fremden bringt vermutlich jeden dazu, sich um den Verstand zu trinken.
Eine wohlbekannte Gestalt taucht plötzlich auf dem schmalen Bürgersteig auf. Der Vorsitzende der Schachunion, der von einer Versammlung kommt, mit gerötetem Gesicht, nüchtern, ein gesunder Beitrag zum Straßenbild. Er streckt ihr seine Hand hin, als hätten sie sich gestern zuletzt gesehen.
»Sie sind immer noch hier«, stellt er fest, und das kann Wladimira nicht leugnen.
Es ist zu spät oder zu früh, um andere Worte zu finden als die, die bereits darauf warten, gesagt zu werden. Aus ihrem Mund kommt das ungeschminkte Bild ihrer Fluchtpläne. Das letzte, was sie von ihm gesehen hat, wie er neben dem Mann saß, der ihn vernichtet hatte, den Kopf über ein Minischachspiel gebeugt, allein gelassen in seinem Unglück.
»Was ist aus ihm geworden?«
»Soweit ich weiß, geht es ihm gut.« Der Vorsitzende der Schachunion versucht sie zu beruhigen. »Erholung, heißt es. Außer der Erschöpfung war da vielleicht noch ein Nervenzusammenbruch.«
In dem System, das sie verlassen hat, hatten die Dinge nie den Namen, den sie verdienten. Erholung kann alles bedeuten. Ein zwangsweiser Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt gehört noch zu den milderen Varianten, die krasseren heißen Deportation, vielleicht auch tödlicher Unfall.
Preisgegeben.
Ein Laut kommt über ihre Lippen. Auf einem rissigen Bürgersteig im schwachen Licht einer Straßenlaterne jammert Wladimira.
Der Vorsitzende der Schachunion legt ihr eine Hand auf die Schulter.
»Kann ich irgend etwas tun?«
»Sie können mich auf dem laufenden halten.«
Eddas Adresse ist auf Dauer zu unsicher. Statt dessen läßt sie sich die seine geben und seine Telefonnummer. Als sie sich trennen, ist etwas verändert.
Wladimira geht erfüllt von einer Art Hoffnung weiter durch die Dunkelheit. Sie kommt durch Straßen, die jetzt menschenleer sind, und am Friedhof vorbei, auf dem ein kühler Wind durch die Büsche pfeift.
Der Himmel ist sternenhell, und im Haus ist es still, als sie die Tür mit dem Schlüssel öffnet. Niemand hält an der Hausecke nach einer Prostituierten Ausschau, keine groben Hände versuchen sie zu packen.
In dieser Nacht schläft sie nicht. Statt dessen schreibt sie einen Brief, den ersten von vielen. Vielleicht wird sie ihn nie abschicken. Im Augenblick spielt das keine Rolle.
Die Woche vergeht ohne weitere gewaltsame Anschläge, und daß er nicht zurückgekommen sei, bedeute wohl, daß er zurück nach Hause gefahren sei, meint Edda, oder auch, daß er wieder angeheuert habe. Er sei nicht der Vater des Kindes, nie im Leben, aber wie er sie gefunden habe, das sei ihr ein Rätsel. Nicht einmal ihre Mutter kenne die Adresse.
Zum Wochenende kommt sie zurück, denn Gunlaugs Kinder brauchen Platz und machen Krach, und zwar so sehr, daß es selbst Edda schwerfällt, mitten in diesem Tumult zu schlafen. Sie ist rund wie ein kleiner Walfisch und müde wie ein ganzes Altersheim, und sie kann auf dem Fahrrad kaum das Gleichgewicht bewahren. Es fällt ihr schwer, sich zu bücken und einen Putzlappen aufzuheben, und schließlich schlägt Wladimira es selbst vor.
Zum ersten Mal hat sie sich ihr Essen verdient, und sie schämt sich nicht mehr, Edda in die Badeanstalt zu begleiten. Zusammen sitzen sie in dem heißen Wasser und warten darauf, daß sich ihre schmerzenden Muskeln entspannen.
»Eigentlich sollte man hier sein Kind zur Welt bringen«, meint Edda. »Hier tut nichts weh.«
Aber Eddas Tochter kommt dann doch im Krankenhaus zur Welt, und zwar an einem windigen Morgen im Mai. Es ist eine angenehme Geburt, keine Betäubung bitte, sagt Edda, die nicht will, daß ihr etwas entgeht, und für die jede Wehe einen Triumph darstellt. Sie sei zum Gebären geschaffen, sagt die Hebamme und streicht ihr über ihr flaumiges Kinn.
Als Wladimira am Vormittag auf die Entbindungsstation kommt, schläft das Mädchen in seiner Wiege, gesund, schön, rund und anmutig. Die Haare über den Pausbacken sind pechschwarz. Das Kind sieht in jedem Fall nicht seiner Mutter ähnlich, aber wem es ähnelt, ist eine andere Frage.
»Muß sie nicht fest gewickelt werden?«
Wladimiras Weltbild sieht nicht vor, daß Kinder Platz beanspruchen und sich entfalten dürfen, Freiheit solle Kindern in passender Dosis verabreicht werden, aber Edda schüttelt nur den Kopf und lacht. Hier strampeln Kinder, soviel sie wollen, während der hellen Nächte rennen sie noch spät draußen herum und spielen. Hier wird niemand eingesperrt.
Die Milch spritzt aus Eddas Brüsten, und das Mädchen gedeiht. Wladimira hält sich auf Abstand, während sie die Windeln im Bottich kocht und die Jacken und Strampelanzüge in heißem Seifenwasser wäscht. Die Wäscheleine auf dem Trockenspeicher hängt ständig voll. Glücklicherweise weht der Sommerwind durch die Dachfenster.
Edda schiebt den Kinderwagen zum Fotografen, und die Kleine zeigt sich von ihrer besten Seite. Lächelnd liegt sie bäuchlings auf der gehäkelten Decke, zu der jede von Eddas Freundinnen vierundzwanzig Quadrate beigetragen hat. Ein Abzug wird vergrößert und gerahmt auf die Kommode gestellt, was mit den anderen passieren soll, verrät Edda nicht.
Dafür hat das Kind jetzt einen Namen. Man hat Wasser über den Kopfvon Carolina Olafsdóttir gegossen, die aus diesem Grund wie ein gestochenes Schwein geschrien und fast die Orgel in der hellen Kirche, die selbst einer gigantischen Orgel gleicht, übertönt hat. Irgendwo muß es also einen Olafur geben, aber was hat das schon zu bedeuten, solange Edda zufrieden ist und Carolina Olafsdóttir wächst und sich wohl fühlt.
Wladimira steht in aller Herrgottsfrühe auf und tut, was sie zu tun hat. Auf dem Heimweg kauft sie ein und kann über die Preise nur den Kopf schütteln.
Das Kochen hat sie übernommen, und wenn Edda sich satt essen will, dann muß sie sich mit Kohlsuppe, Borschtsch und Pelmeni abfinden.
Verbissen reibt Wladimira Meerrettich und hackt Zwiebeln, während ihr die Tränen über die Wangen laufen, und es kommt vor, daß ein Schluchzer zwischen ihren zusammengebissenen Zähnen hervorbricht. Ihre Augen tupft sie mit einem Topflappen trocken, rasch, damit Edda nichts sieht und keine Fragen stellt.
Wladimira knetet Brotteig, weil das um einiges billiger werden müßte, als es zu kaufen, aber das Brot wird hart wie Stein, und man muß es in die Suppe stippen, wenn man sich keinen Zahn ausbeißen will.
Wladimira kocht Rote Bete, und die Küche sieht aus wie nach einem blutigen Verkehrsunfall.
Wladimira legt Gurken ein, und sie gären. Der Boden der Speisekammer ist mit einer sauren, klebrigen Flüssigkeit bedeckt. Schließlich muß Edda eingreifen.
»Ich koche, wenn du dich um sie kümmerst.«
Das Kind hängt im Arm seiner Mutter wie eine fette kleine Schlange und fuchtelt wild mit seinen dicken Ärmchen. Ehe Wladimira noch protestieren kann, hat sie es schon auf dem Arm.
Wladimira sind die Flektionsmuster verschiedener Sprachen vertraut, etymologische Spitzfindigkeiten sind ihr Spezialgebiet, aber was die Betreuung von Kleinkindern angeht, muß ihr Edda selbst die einfachsten Dinge beibringen.
Daß die Windel so und nicht anders sitzen muß, daß sie den kleinen Körper in ein Handtuch wickeln muß, damit das kleine Ding nicht friert. Sie muß an das Lätzchen denken und an das saubere Tuch, mit dem man die eigenen Kleider vor dem, was beim Aufstoßen aus dem Mund läuft, schützt und das jeden Tag gewaschen werden soll. Das sagt Edda, die Fähigkeiten und Wissen aus geheimnisvollen Quellen hervorzaubert und alles so selbstverständlich erscheinen läßt.
Eddas Fahrrad stellt eine übermäßige Herausforderung dar. Wladimira trabt auf ihren kräftigen Beinen durch das ungemütliche Herbstwetter, denn alles ist besser als die Geräusche und Gerüche des Säuglings in der Wohnung. Alles ist besser, als mit einem hilflosen Wesen auf dem Arm dazustehen und sich genauso hilflos vorzukommen.
Einmal in der Woche ruft sie auf dem Heimweg von einer Telefonzelle aus den Vorsitzenden der Schachunion an und erhält immer den gleichen Bescheid: Nichts Neues. Einmal in der Woche schreibt sie ihm einen Brief, oder ist er an sie selbst? Zwei Bögen liniertes Papier, nicht mehr und nicht weniger. Bald braucht der Briefstapel, mit Gummibändern fest zusammengehalten, mehr Platz als der Rest ihrer bescheidenen Habseligkeiten. Solange es ihn gibt und er zunimmt, sind sie zusammen.
Bis auf weiteres kommt sie damit zurecht. Sie wartet ab.