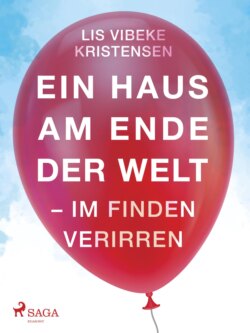Читать книгу Ein Haus am Ende der Welt - Im Finden verirren - Lis Vibeke Kristensen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Olivier
ОглавлениеJetzt, wo seine Mutter tot ist.
Jetzt, wo er niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist.
Jetzt, wo er sich ganz seinen Wünschen hingeben kann.
Jetzt.
Unmittelbar bevor ihm der Traum verriet, was er eigentlich begehrt, erwacht er.
Irgend etwas, vielleicht ein Donnern, hat ihn geweckt, ein rollendes Krachen, das weitergeht, sich verwandelt, sich zu etwas Mahlendem verstärkt, zu etwas Pfeifendem abschwächt und sich zu etwas Knirschendem verdichtet. Dann wird es still. Die Stille ist genauso ohrenbetäubend, wie der Lärm es war.
In seiner Kajüte riecht es nach seinem Erbrochenen. Seekrank tagsüber, seekrank in jeder Nacht der ganzen langen Reise. Das Fett hängt in schlappen Wülsten an seinem wenig beeindruckenden Skelett.
Eigentlich wäre es natürlich gewesen, zu bereuen, sich je auf diese Reise begeben zu haben. Olivier weiß nicht, ob er es bereut. Das Meer hat ihn davon abgehalten, darüber nachzudenken.
Die Dünung. Das Rollen. Die kurzen, kräftigen Wellen. Die schaumbedeckten Hügel, die brodelnden Täler.
Sein ganzes Leben lang hat er an Land gestanden und sie betrachtet. Jetzt erlebt er zum ersten Mal, welche Wirkung sie auf seinen Körper ausüben.
Er hat sich nie fürs Schwimmen begeistern können. Er wollte sein Fett nicht den Augen der Welt darbieten, es war so schon schlimm genug. Nie zuvor hatte er seinen Fuß auf ein Schiff gesetzt. Selbst wenn er Lust dazu gehabt hätte, hätte seine Mutter jeglichen Versuch unterbunden.
Wer hätte geglaubt, daß er sich erst mit achtundfünfzig seiner Mutter widersetzen würde.
Das Schiff liegt still. Jetzt merkt er es. Ein leises Schwanken, das ist alles.
Schlaf. Sich so ausgiebig wiegen lassen, daß man nie mehr erwacht. Vielleicht ist es ja das, wovon er sein Leben lang geträumt hat.
Ein Poltern an der Tür.
»Wir liegen im Hafen.«
Vor Durst klebt ihm die Zunge am Gaumen. Er trinkt fast eine ganze Flasche Wasser. Dieses Mal dreht es ihm ausnahmsweise nicht den Magen um. Er taumelt aus seiner Koje, zieht eine Hose und ein Hemd an und einen Wollpullover über den Kopf.
Oben haben sie bereits die Gangway in Position gebracht.
Sie befinden sich im Hafen. Lagerhäuser begrenzen die Sicht auf Kräne und Öltanks. Auf dem Kai haben sich stämmige Männer in Ölzeug aufgebaut, Blonde und Dunkelhaarige mit Schirmmützen. Der durchdringende Geruch von Fisch steigt ihm in die Nase.
Hier genauso wie zu Hause.
Auf der Brücke unterhält sich der Kapitän in Zeichensprache mit einem Mann, dessen unnatürlich breite Schultern seine blaue Uniform zu sprengen drohen. Auf einem Bord hinter ihnen stehen eine Cognacflasche und zwei geleerte Gläser.
So ist es recht. Olivier kennt die Methode. Ein kleines Glas kann einen Weg bahnen, der bis vor kurzem unpassierbar erschienen ist.
»Ich wollte mich eben noch verabschieden.«
Der verbindliche Händedruck. Der Kapitän weicht seinem Blick aus. Vielleicht glaubt er, Olivier würde einen Teil des Geldes zurückfordern.
Die Reise hat er im voraus bezahlt. Eine stattliche Summe, die auch die Rückfahrt umfaßt, auf die er lieber verzichtet hätte, wie auf all das, was er auf der Fahrt ohnehin nicht hatte essen und trinken können.
Auf dem Schiff hat er nichts mehr verloren. Für die Heimreise kann er sich ein Flugticket leisten, aber er wollte mit dem Schiff ankommen.
Der harte Koffer schlägt unangenehm gegen das rechte Bein, als er, nach dem langen Fasten ganz schwach, die Straße hochstolpert.
Außerhalb des Hafengebiets ist die Luft salzig und sauber. So weit das Auge reicht, gibt es keine hohen Gebäude und keine Fabrikschornsteine. Der Himmel über ihm ist mit dramatischen Wolken überzogen. Hinter ihm ragt jenseits der Bucht ein beeindruckender, schwarzblauer Gebirgskamm auf.
Ein fremdes Land. Er hat an dieses Land gedacht, jetzt ist es plötzlich da. Er weiß nicht, was er sich vorgestellt hat und ob er sich überhaupt etwas vorgestellt hat. Eis muß es geben, warum sollte es sonst Island heißen? Islandponys und isländische Vulkane kennt er. Er hat eine Fernsehsendung über eine Insel gesehen, die aus dem Meer aufgetaucht ist, eine Vulkaninsel.
Trockenfisch. Das Schiff, mit dem er gekommen ist, würde eine Ladung getrockneten, gesalzenen Dorsch mit zurücknehmen.
Der Dorsch hat seinen Vater das Leben gekostet. Jetzt ist es fast schon soweit, daß sich die Fischer wegen dieses Fisches gegenseitig umbringen. Dorschkrieg. Als ob es nicht auch so schon genug Kriege gäbe.
Über die Sprache, die hier gesprochen wird, weiß er nichts. Er beherrscht nur seine Muttersprache. Mit den zwei bis drei englischen Ausdrücken, die er sich mit Rücksicht auf die Touristen mühsam angeeignet hat, wird er nicht weit kommen.
In einem Hotel wird er sich wohler fühlen. Hotels sind überall auf der Welt gleich.
Ein Hotel wie sein eigenes zu Hause, wo er sich waschen und umziehen und etwas essen kann, jetzt wo die Übelkeit langsam in Hunger übergeht. Eine Flasche Wein. Schlafen, tief und lange. Ein breites Bett statt der unbequemen Koje. Frische Bettwäsche. Ein Boden, der nicht unter seinen Füßen schwankt.
Bereits morgen will er in den Norden. Vielleicht kann er ja mit der Bahn fahren. Oder mit dem Bus. Sein Führerschein steckt in der Innentasche seiner Jacke. Vielleicht kann er ja einfach ein Auto mieten und selbst dorthin fahren.
Er weiß den Namen des Ortes. Fáskrudsfjördur. Er hat ihn auf der Landkarte gefunden. Ein kleiner Flecken auf einer Landzunge, die nach Osten weist.
Im Hotel werden sie schon Bescheid wissen. In Hotels weiß man immer Bescheid. Dort werden Fremdsprachen gesprochen, vielleicht sogar Französisch.
Die Kleider schlottern ihm um den Körper. Unrasiert ist er außerdem. Vermutlich sieht er aus wie ein Landstreicher.
Die Stadt erinnert an den Fußboden im Kinderzimmer, wenn er die Kiste mit den Bauklötzen darauf ausgekippt hatte. Der schwarzgraue Asphalt der Straßen ist rissig. Schwarzer Splitt knirscht unter seinen Sohlen.
Die Straße, an der er wartet, um sie überqueren zu können, beschreibt einen leichten Bogen. Er steht auf dem Rücken eines gestrandeten Riesenwals.
Wale gibt es auch hier, fällt ihm plötzlich ein. Er hat Fotos von Harpunen auf großen Schiffen gesehen, von der blutigen Arbeit des Ausnehmens, von Speck und Tran.
Er kann sich nicht vorstellen, Walfleisch zu essen. Er will eine Suppe und Brot, um es in die warme Flüssigkeit zu tunken. Er braucht etwas, um seinen Magen wieder in Gang zu bringen. Gebratenen Fisch. Vielleicht etwas Käse zum Dessert, vorzugsweise einen weichen, tröstenden. Karamelpudding.
Im Kopf hat er das Menü bereits zusammengestellt. Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen.
Autos brausen an ihm vorbei. Schwere, flache Autos, wie er sie in amerikanischen Fernsehfilmen gesehen hat. Chevrolets und Chryslers und riesige Fords.
Auf dem kurzen Weg vom Hafen ist der Sprühregen in Sonnenschein übergegangen. Jetzt treiben von neuem Wolken vom Meer heran und pressen die Sonnenstrahlen zusammen, bis sie dem Licht aus einem Filmprojektor gleichen.
Auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig sieht er, wie eine Frau nach vorne springt und mit den Armen fuchtelt. Ihr Mund öffnet sich zu etwas, was ein Schrei sein könnte, aber im Lärm des Verkehrs untergeht.
Die Frau besteht nur aus Bewegung. Ihre Arme wirbeln herum.
Das Ganze spielt sich im Bruchteil einer Sekunde ab.
Ein Kind, sie packt ein Kind. Einen knubbeligen Jungen in kurzer Hose.
Das hätte er selbst in diesem Alter sein können, mit dem Unterschied, daß sich dieses Kind wehrt. Der kleine, kräftige Körper windet sich unter dem festen Griff der Mutter, und die Füße stampfen auf den Boden.
Es nützt nichts.
Die Mutter schüttelt ihn unsanft.
Ein dummes Kind, das nicht begriffen hat, daß Widerstand nur zu Strafe führt, und zwar nicht notwendigerweise in Form körperlichen Schmerzes oder böser Worte.
Sondern Kälte. Verlust von Geborgenheit.
Ein roter Ballon treibt an Oliviers Ohr vorbei. Der Junge streckt beide Arme nach dem Ballon aus, in Oliviers Richtung, aber noch ehe dieser seinen Koffer abstellen, sich mit seinen müden Gliedern umdrehen und den Arm nach dem fliegenden Rot ausstrecken kann, ist es zu spät.
Der Ballon wird in wiegendem Tanz von einer Bö weggetragen.
Es ist wohl kaum der erste und ganz sicher nicht der letzte. Aber man gewöhnt sich nie daran.
Erst jetzt bemerkt er den Bus, der nur einen Meter von ihm entfernt angehalten hat. Ein schweres Unglück wurde abgewehrt. So kann man die Dinge auch sehen.
Aber es erfüllt ihn Trauer, als er die Straße überquert, Trauer, die sich ihm an die Fersen geheftet hat, während er durch einen kleinen Park geht, in dem unerwarteterweise Blumen in ordentlichen Rabatten stehen.
Ihre Farben sind durchdringender als normal und glühen beklemmend in der klaren, kühlen Luft. Solche Blumen hat er noch nie gesehen.
Ihr Duft, ein bitterer Duft von Honig gemischt mit Teer, gehört zu einer anderen Welt, auch die Blumen gehören zu einer anderen Welt.
Er flieht vor dem Blumenduft auf die Straße, auf der die Autos entlangbrausen. Eines streift seinen Koffer, es ist nur ein leichter Stoß, und der Fahrer wirft seinen Wagen zur Seite. Der Koffer fällt ihm nicht aus der Hand, und das Auto fährt weiter.
Ein flacher und luxuriöser Citroën, der aus der Menge der protzigen Amischlitten hervorsticht. Ein Stück seiner Heimat, das ihm ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln sollte, das aber nur sein Gefühl der Trauer verstärkt und in einen pochenden Kopfschmerz verwandelt.
So ein Auto hatte er auch kaufen wollen. Nächstes Jahr.
Auf dem Bürgersteig stellt er seinen Koffer ab. Irgendwo in der Nähe funkelt Wasser, aber es kann nicht das Meer sein, denn das liegt hinter ihm.
Eine Bank. Wasser funkelt in den letzten Sonnenstrahlen, ehe ein Schauer die glatte Oberfläche aufpeitscht und den Enten, die dort ihre Kreise ziehen, das Gefieder aufwühlt. Das Wasser ist braun, grau, dann plötzlich wieder blau und weiß, eine Wolke spiegelt sich, und der Regen ist vorbei.
Seine Uhr zeigt die Zeit an. Aber ist das die richtige Zeit? Er weiß es nicht. Die Zeit hat auf dem Schiff stillgestanden, und er hat sich durch sie hindurchbewegt. Vielleicht in eine neue Zeit. Vielleicht hat er sich ja nur im Kreis bewegt, und die Zeit ist noch dieselbe.
Jemand spricht ihn in einer Sprache an, die er nicht versteht. Jemand stellt seinen Koffer neben ihn hin und sagt mehrere Worte.
Ein Mund spricht Worte aus, die er nicht versteht. Der Mund einer Frau. Er ist kräftig, in einem hellen Lila geschminkt und sitzt unter einer Nase, die dem Himmel entgegenstrebt. Es ist ein Gesicht, die Wangen sind hell und mit Flaumhaar bedeckt, ein Pfirsich spricht zu ihm durch eine kleine Öffnung, in der weiße Zähne schimmern und eine rosafarbene, feuchte Zunge.
Die Worte versteht er nicht. Das macht nichts.
Vor seinen Füßen steht ein Koffer. Vielleicht ist das seiner.
»Hotel«, sagt er. Das ist das einzige Wort, an das er sich erinnert.
Vielleicht versteht sie ihn, vielleicht nicht. Jedenfalls bleibt sie sitzen und legt eine Hand mit kurzen Fingern auf seine.
Er betrachtet seine Hand. Die dicke Hand eines zu groß geratenen Kindes mit Vertiefungen, wo die Knöchel hätten sein sollen. Sicher fühlt sie sich weich an, wenn man sie streichelt. Jedenfalls streicheln die kurzen Finger sie offenbar mit einem gewissen Genuß.
Früher hat ihn auch jemand gestreichelt, seine Hand, seinen drallen Kinderkörper, seinen fetten Jungenkörper. Jemand hat seine Nase in seinem Nacken vergraben und mit seinen Zehen gespielt. Weich und gut, Olivier. Weich und gut. Nicht am Daumen lutschen, es gibt anderes, was du dir in deinen kleinen Mund stopfen kannst, was schmilzt und Wohlbehagen bereitet und deinen hungrigen Magen füllt. Hier hast du, eine Brust, einen süßen, tröstlichen Geschmack.
Eine Brust im Mund eines Dreijährigen, eines Vierjährigen und immer so weiter.
Olivier, Sohn von Olivier. Das Kind eines Toten kann viel Trost gebrauchen.
Dem Kind eines Toten bürdet man viel auf. Das weiß er inzwischen.
Unter diesem Himmel wird alles klarer. Die Farben der Blumen. Das Licht auf dem See, das ihn in flüssiges Metall verwandelt. Eine Hand streichelt seine Hand, so als würde das nichts kosten.
Eine Hand hebt einen Koffer an. Ein Pfirsichgesicht lächelt, und er macht sich auf den Weg, geht neben ihr her, eine Straße entlang, um eine Ecke.
Ein gelbes Gebäude. Eine schwarze Uniform mit rotem Besatz hinter einem Tresen. Bleiche Wände. Christus, gequält und gemartert an seinem Kreuz.
Die Uniform deutet auf etwas, das sein Koffer sein muß. Über dem Uniformkragen ein Gesicht, hellgrau und ohne Lächeln.
Er will dort nicht sein. Er ist nicht arm. Das ist ein Ort für Arme. Ein Obdachlosenasyl. Oder ein Asyl für Kranke. Oder Verrückte.
Sie hat ihn dorthin gelockt. Wenn er dort bleibt, kommt er nie mehr raus.
Die Tür hinter ihm steht offen. Mit drei raschen Schritten ist er wieder auf der Straße, den Koffer läßt er stehen.
Es pfeift in seinen Lungen, als er den unebenen Bürgersteig entlanghastet, er kann sich nicht erinnern, wann er zuletzt gerannt ist. Er kommt nur ein paar Meter weit, da hält ihn ein stechender, linksseitiger Schmerz auf.
Jetzt ist sie wieder neben ihm, immer noch lächelnd. Sie hat seinen Koffer in der Hand und legt eine Hand auf sein Schulterblatt. Er hat zu starke Schmerzen, um sie abzuschütteln.
Die Hand drückt ihn weiter. Jetzt deutet sie auf sein Knie, und er hebt es automatisch. Der Schmerz läßt nach.
Die flaumige Haut eines Pfirsichs, ein leuchtender lilafarbener Mund. Ihr Haar hat sie unter eine Strickmütze geschoben, aber er sieht ihre Augen. Sie sind grau, graue Augen unter einer hellbraunen Mütze, das Himmelwärtsstreben der Nase, der Pfirsichflaum der Wangen, so jemanden wie sie hat er noch nie gesehen, ein freundlich gesinnter Troll, eine üppige, flaumige Elfe.
Eine Elfe, die auf ihn deutet.
»Edda«, murmelt er. »Edda.«
Sie schüttelt den Kopf, deutet wieder. Da versteht er.
»Olivier.«
Sie legt ihre Hand in seine, sie ist klein, fest und warm. Wie zwei wohlerzogene Kinder gehen sie die schmalen Straßen und an einer Friedhofsmauer entlang. Auf der anderen Seite schwanken niedrige Bäume mit dünnen, verkrüppelten, moosbewachsenen Stämmen. So sehen Bäume am Meer aus, so sehen Bäume aus. Er kann unbekümmert weiterwandern.
Vor einem grauen Haus stellt sie den Koffer ab.
Der ungleichmäßige Putz der Fassade erinnert an Elefantenhaut. Das Haus wirkt privat, es handelt sich um kein Hotel, aber auch nicht um eine beängstigende Einrichtung. Es lehnt sich schwer Richtung Straße, aber im Treppenaufgang riecht es gut nach Lack und Schmierseife. Mit einem Schlüssel an einem kleinen Schlüsselbund schließt sie eine grüngestrichene Tür auf, und er folgt ihr in ein freundliches Zimmer.
Er läßt sich wiegen. So gründlich, daß er nie mehr erwacht.
Aber er erwacht doch, und zwar in einem Bett, das zu schmal für zwei ist. Er erwacht in Armen, die ihm unbekannt sind, mit dem Geschmack einer unbekannten Brust in seinem trockenen Mund. Sein Glied liegt groß und schwer an einem unbekannten Körper und er gehört nicht einer der Dirnen, für die ihm seine Mutter Geld gab, als er für das andere zu groß wurde. Es ist eine Frau, die seine Hand nimmt und auf ihren Bauch legt, der groß und rund ist und von einer Furche geteilt wird. Ihre Schenkel sind biblische Säulen, und ihr Mund schmeckt nach Pfirsich, er schmeckt nach Sahne, und er läßt sich immer weiter wiegen, hinein in die gütige Dunkelheit.
Eine Stimme spricht. Die Worte versteht er nicht, aber er versteht das Glas Wasser in ihrer Hand. Er versteht die Hand, die ihm über das zerzauste Haar und über die unrasierte Wange streicht.
Sie ist jetzt angekleidet und trägt eine Strickjacke und eine Hose. Die Elfe ist verschwunden, er hat einen Frauenkörper vor sich, den Körper einer kräftigen Frau. Draußen vor dem Fenster ist dunkle Nacht. Während er hier lag, ist es Nacht geworden. Wenn er Glück hat, wird es nie Morgen.
Die Nacht kann man durchschlafen, nicht aber den Morgen.
Ein Mantel, sie zieht jetzt ihren Mantel an, aber er kann sie nicht gehen lassen. Eine Hand, um sich festzuklammern, das ist das mindeste. Zum Schluß gestattet sie ihm mitzukommen. Sie hilft ihm in die Kleider, gibt ihm frische Strümpfe und ein Hemd aus dem Koffer, der geöffnet auf dem Fußboden steht. Pullover und Jacke, und schon sind sie auf dem Weg.
Sie schiebt ein Fahrrad durch die schlafende Stadt, und er strauchelt hinterher, seine Beine wollen ihn nicht tragen. Der Weg ist weit, aber schließlich sind sie da.
Eine Halle.
Aus einem Schrank taucht ein Wagen mit einem Eimer, Besen und Flaschen auf. Sie läßt Wasser ein und legt los. Andere Frauen gehen mit ihren Wagen vorbei, sie begrüßt sie und deutet auf ihn, und sie lachen. Nicht bösartig. Laut und gut gelaunt.
Eine der Frauen faßt ihn mit ihren putzeimerfeuchten Händen an den Wangen, und er läßt es geschehen. Er ist eine Puppe in Frauenhänden, ein weiteres Mal.
Das macht nichts. Eine große Ruhe hat sich seiner bemächtigt. Er fühlt sich satt, obwohl er den ganzen Tag nichts gegessen hat.
Ein seltsamer Tisch steht auf der großen Bühne der Halle. Ein Tisch aus braunem Holz, in den ein Schachbrett eingelassen ist. Es gibt Fächer für Uhren und andere Dinge. Die beiden Stühle sind bequem gepolstert, einer hat Rollen. Er nimmt bereitwillig Platz, als sie darauf deutet. Er zieht auf der Bühne ein paar Kreise, und die Frauen lachen, bis sie sich aneinander festhalten und nach Luft schnappen müssen.
Die Sprache. Die Sprache kehrt zurück. Warum hat er nicht schon früher daran gedacht? Die Worte pflanzen sich in seinem Körper fort, so daß das Unverständliche verständlich wird.
Die Brust seiner Mutter in seinem Mund war eine Sprache. Sie sagte, ich habe Macht. Ich kann dir all die Geborgenheit geben, die du dir je wünschen wirst, und ich kann sie dir auch nehmen.
Der Finger, der auf das Knie deutet, das man nur beugen muß, damit der Schmerz verschwindet, ist eine Sprache.
Sein Körper übersetzte sie. Das war einfach.
Das Lachen ist eine Sprache. Das Pfirsichlächeln ist eine Sprache. Die Füße, die sich über den unebenen Asphalt des Bürgersteigs schleppen. Seine Hand, die den Koffer losläßt, damit sie diese und auch ihn finden kann. Alles ist eine Sprache. Sein Spiel mit dem Stuhl und das Lachen der Frauen sind Sprachen.
Sie brauchen keine Worte. Sie können sich unterhalten. Er kann ihr seine Geschichte erzählen und sie ihm die ihre. Das ist nicht schwer.