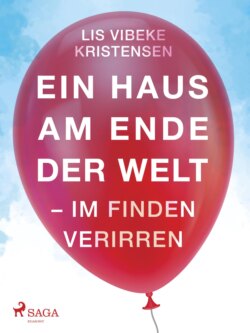Читать книгу Ein Haus am Ende der Welt - Im Finden verirren - Lis Vibeke Kristensen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Joyce
ОглавлениеIch bin im achten Monat, und der Arzt des Stützpunkts tätschelt mir das Knie unter dem Laken, das entweder mein oder sein Schamgefühl schonen soll, während ich mit den Beinen in den Schienen des Stuhls liege und mich darauf konzentriere, keinen fahren zu lassen.
Solche Probleme seien bei Schwangeren vollkommen normal, sagt er und lächelt sein zuvorkommendes Ärztelächeln.
Die Blähungen sind aber gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, daß ich gar nicht schwanger sein will. Ich will nicht in einem Kleidungsstück herumwatscheln, das einem Viermannzelt ähnelt. Ich will in voller Feldausrüstung auf verschneiten Bergpfaden marschieren. Ich will mich hinter einen Busch hocken können, meinen Durst mit lauwarmem Wasser aus einer Feldflasche löschen und die Nächte unter einem Moskitonetz verbringen.
Moskitonetze könnte man in diesem Land an und für sich auch gut gebrauchen, aber Mücken sind meine geringste Sorge an diesem Vormittag, an dem ich an einer Kreuzung in Reykjavík stehe und so diskret wie nur möglich einen fahren lasse.
Meine Gase riechen genauso schlimm wie die Schwefeldämpfe, die in diesem Land überall dort aus der Erde aufsteigen, wo man am wenigsten damit rechnet. Ich hoffe, die Umstehenden halten das für eine Naturerscheinung, während ich darauf warte, daß der Verkehr nachläßt.
Der Gestank aus meinem Inneren ist nur eines der Symptome meines Verfalls. Mein Gehirn ist ein Moorloch, aus dem nur Sumpfgas entweicht. Ich werde ausfällig gegen alle und jeden und besonders gegen den armen Bill, der nur das getan hat, was von einem Mann in seiner Situation zu erwarten war, nämlich mich zu heiraten, als es für die morgendliche Übelkeit und die ausgebliebene Regel keine Ausrede mehr gab.
Ich bin fünfundzwanzig und sitze in einer furchtbaren Falle. Wäre nicht alles so katastrophal, dann könnte ich an dieser Alliteration sogar Gefallen finden.
Bill, durchtrainiert und fürchterlich uninspirierend, hat von mir geträumt, seit wir in der High-School ein Liebespaar waren. Es ist nicht auszuschließen, daß er seit dem Moment, in dem ich sein Organ losließ, kurz bevor er auf der Rückbank des Pontiacs meines Vaters gekommen wäre, mit einer Erektion herumgelaufen ist.
Partner sind, wie meine Basisgruppe schon lange festgestellt hat, ein notwendiges mentalhygienisches Übel und nur dazu geeignet, die Spannungen abzubauen, die einen daran hindern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. In meinem Fall mein Fachgebiet, das ich mit unglaublicher Leidenschaft liebe. Sprache ist die Luft, die ich zum Atmen brauche, und die linguistische Anthropologie verleiht meiner Existenz ihren Sinn.
Als Bill also auf der Hochzeit meiner Schwester auftauchte, bei der ich eine etwas überreife Brautjungfer darstellte, sah ich das als reine Entspannung.
Marge rauschte in Taft und Tüll und auf Vaters Arm gestützt durch den Mittelgang, und ich stand in malvenfarbenem Musselin mit einem passenden Strauß Margeriten da, und meine Gedanken kreisten um meine Doktorarbeit, die zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Frage von Zeit und Fleiß war. Und dann stand er vor mir.
Mr. Middle America in frisch gebügelter Galauniform, mit glattrasiertem Nacken und glatter Haut, nach frischgeputzten Schuhen, Menthol und frischgereinigter Gabardine duftend.
Ein alter Beau. Wo fühlt man sich geborgener als in einer Umarmung, die man kennt und die man bequem auf der Suche nach neuen Abenteuern wieder verlassen kann?
Oder eben nicht.
Die Falle ist zugeschnappt. Es ist was unterwegs, und eine illegale Abtreibung ist keine Alternative. Obwohl ich das Geld vielleicht sogar aufbringen könnte, hat die Sonntagsschule trotz allem ihre Spuren hinterlassen. Und Höllenqualen erscheinen mir weniger reizvoll als der schöne, langweilige Bill. Es gibt jedoch keinen Grund, die Familie mit einer weiteren Hochzeit zu behelligen.
Ein Friedensrichter verwandelt in zweieinhalb Minuten Joyce Deirdre Dunne M.A. in Mrs. William D. Turnbull.
In meinem keuschen Jugendzimmer übergebe ich mich so geräuschlos wie möglich in eine Plastiktüte, wenn ich nicht gerade das Notwendigste zusammenpacke, vor allen Dingen meine Reiseschreibmaschine, und einen Artikel über die isländische Sprachpolitik plane, der mein geistiges Überleben sichern soll, bis das Kind auf der Welt ist.
Ich weiß noch nicht, daß jeder Ehrgeiz, der das morgendliche Sich-aus-dem-Bett-Quälen übersteigt, unausweichlich blasenziehend in dem mentalen Morast versinkt, den das Mutterwerden mit sich bringt.
Wenn schon etwas so Normales wie eine Schwangerschaft meine intellektuellen Fähigkeiten in diesem Ausmaß lähmt, wie sieht es dann erst aus, wenn daraus unausweichlich ein Kind mit seinem unbestreitbaren Anrecht auf Stillen, Baden, Wickeln, Wiegen und Trost resultiert?
Das Ergebnis meiner rudimentären Überlegungen über die Zukunft läßt sich in drei Worten zusammenfassen: Angst, Schrecken, Panik.
Der Verkehr rauscht an mir vorbei, so wie der Verkehr in dieser Einöde eben rauscht. Meist sind es klapprige Karren, die die Soldaten des Stützpunktes, die in die Heimat zurückgekehrt sind, mit Profit verkauft haben. Heckflossen und lila Lack dominieren. Auf den Schotterstraßen fahren alle schnell, wie richtige Wikinger eben.
Ein Bus keucht die leichte Steigung hinauf. Im Schutz des Lärms lasse ich noch einen fahren und verlagere dann mein nicht unbeträchtliches Gewicht auf das andere Bein.
Ich stehe an einer Kreuzung in einem Ort, bei dem es sich wahrscheinlich um Reykjavík handelt. Direkt nach meiner Ankunft, ehe meine Figur ihre gegenwärtigen nilpferdhaften Ausmaße annahm und mein Gehirnschwund einsetzte, wußte ich noch, was der Name der Stadt bedeutet. Ich legte mir ein Wörterbuch zu, machte mich mit den Deklinationen der Substantive vertraut und telefonierte mit dem nationalen Sprachinstitut.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Straßen über Namen verfügen oder Substantive Deklinationsendungen besitzen. Mein Horizont endet beim gegenüberliegenden Bürgersteig, wo ein roter Ballon im Wind treibt.
Ein roter Ballon. Keiner dieser eleganten, heliumgefüllten, die befreit in den Himmel fliegen, sondern einer, den irgendeine ermattete Mutter mit der letzten Kraft ihrer erschöpften Lungen aufgeblasen hat. Vielleicht kommt er direkt von meinem eigenen Stützpunkt. Ein echter amerikanischer Ballon, den ein Windstoß jetzt über die Straße treibt.
Ein kleiner Junge wirft sich bereits über die Bordsteinkante. Seine entsetzten Augen sind auf den Ballon gerichtet. Seinen Ballon, vermute ich. Den am heißesten begehrten Ballon in der Geschichte Reykjavíks, nach dem Geheul des Knäbleins zu urteilen, als ihn seine Mutter am Ärmel packt und davor bewahrt, sich vor den Bus zu werfen.
Zwei kräftige Windstöße schleudern den Ballon auf meine Seite, aber meine Körperfülle hindert mich daran, ihm nachzueilen, und er treibt weiter. Über den Rasen des kleinen Parks, über die nächste Straße und den Abhang hinunter auf den schwarzblauen Atlantik zu.
Der Junge heult. Seine Mutter schüttelt ihn. Der Junge stampft wütend auf. Die Mutter schüttelt ihn noch mehr.
Mit einem Quietschen hat der Bus gebremst. Vorn auf der Hose, die der Junge trägt, breitet sich rasch ein dunkler Fleck aus. Ein dünnes gelbes Rinnsal läuft aus seinem Hosenbein und bildet auf dem rissigen Asphalt des Bürgersteigs eine Pfütze.
Schwerfällig fährt der Bus an, und als er vorbei ist, sind die beiden fort. Vermutlich sind sie auf die unterirdische Toilette verschwunden, die auch ich ab und zu benutze.
Sie sind fort, aber ich habe genug gesehen.
Getrieben von dem Willen, mit dem ich auch mein Studium als Mitglied von Phi Beta Kappa in Rekordzeit mit Bestnote abgeschlossen habe, getragen von unsichtbaren Flügeln und ohne nach rechts und links zu sehen, lege ich die Meilen zurück, die mich von dem trennen, was man als die Freiheit bezeichnen könnte.
Statt die Schritte Richtung Stützpunkt zu lenken, biege ich zum Verkehrsflugplatz ab, und obwohl die Nachrichten am Morgen voll davon waren, habe ich vergessen, daß heute Bobby-Tag ist. Mr. Fischer, das Schachwunder, hat endlich eingesehen, was sich gehört, und sein Erscheinen angekündigt. Auf der anderen Seite des Globus bomben unsere Jungs die Kommunisten zurück in die Steinzeit, auf dieser Seite konzentrieren wir uns darauf, sie im Schach zu besiegen.
Eine größere Menschenmenge sammelt sich an, aber die Größe meines Bauchs verschafft mir freien Durchgang. Niemand hat den Mut, in der Nähe zu sein, wenn das Fruchtwasser abgeht. So kann ich ungehindert Bobbys wieselähnliche Gestalt in Augenschein nehmen, die sich in den Schutz eines niedrigen, europäischen Autos flüchtet, um sich zu der Arena zu begeben, in der er die sogenannte Zivilisation gegen die Barbaren verteidigen will.
Sie haben uns reingelegt, Bobby. Ich melde mich jetzt ab, was ist mit dir?
Als ich schließlich in der Abfertigungshalle stehe, fällt mir ein erschwerender Umstand auf. Ich habe kein Geld für ein Ticket.
In Colorado ist es mitten in der Nacht. Das hindert meinen Vater jedoch nicht daran, ein R-Gespräch anzunehmen.
»Hast du das Telegramm bekommen?«
Welches Telegramm? Etwas an Vaters Stimme, etwas Zerbrechliches, das ich nicht wiedererkenne, läßt meinen Atem stocken.
»Sie behalten sie vorläufig da.«
Sie behalten sie? Wen? Marge? Mutter? Die Großmütter haben schon längst das Zeitliche gesegnet, nur die engste Familie ist übrig.
»Marge ist unterwegs«, schluchzt Vater. »Niemand weiß, wie lang es noch geht.«
Die Verzögerungen der transatlantischen Telefonleitung lassen seine Stimme künstlich klingen, so wie die eines Roboters im Kino.
Marge ist unterwegs. Es muß sich also um Mutter handeln. Ist ihr etwas zugestoßen? Danach klingt es nicht. Es klingt nach etwas Schleichendem, Unberechenbarem.
Viele tausend Meilen entfernt putzt sich mein Vater die Nase.
Als ich drei Stunden später in der nächsten Maschine sitze, weiß ich alles, was es in diesem Stadium zu wissen gibt.
Die Betrachtung des Stuhlgangs und des Toilettenpapiers, mit dem meine Mutter ihr ganzes Umfeld terrorisierte, hat ein Ende. Sie braucht sich keine Gedanken mehr zu machen.
Es ist unter dem Radar hindurchgeschlüpft, während sie einen Augenblick lang unaufmerksam war, während sie noch eine Pille einnahm oder noch einen Schluck eines Spezialgebräus trank.
Jetzt ist es ernst. Krebs im Enddarm, offenbar fortgeschritten. Eine palliative Operation ist übermorgen geplant. Ein künstlicher Darmausgang ermöglicht es, alles im Beutel im Auge zu behalten.
Vielleicht hätte sie sich so einen schon längst zulegen sollen, vielleicht wäre ihr Leben dann glücklicher gewesen.
Jetzt wird es nur kurz.