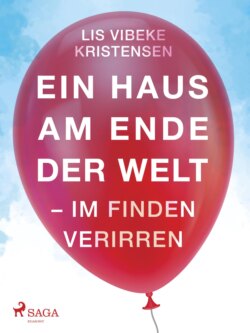Читать книгу Ein Haus am Ende der Welt - Im Finden verirren - Lis Vibeke Kristensen - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Olivier
ОглавлениеTagsüber liegt der Stein in seiner Hosentasche, immer in der rechten. Er findet ihn leicht. Nachts hat er seinen Platz unter dem Kopfkissen. Er ist seinen Fingerspitzen ein Trost und gibt seiner Handfläche Geborgenheit.
Das Hotel ist ein müder Motor, der schon lange nicht mehr geölt oder gewartet worden ist. Erst kam die lange Krankheit seiner Mutter, dann ihr Tod und seine plötzliche Abreise. Die Zeit ist einfach vergangen, und jetzt blättert die Farbe von den Fensterläden.
Im Schaukasten wellen sich die vergilbten Speisekarten. Der Halter für die Broschüren auf dem kleinen Empfangstresen ist gähnend leer, und das gilt auch für die Zimmer und das Restaurant, in dem die Kupferkessel über dem Kamin braun angelaufen sind.
Die Angestellten haben sich mit irgendwelchen Jobs durchschlagen müssen, während er weg war. Jetzt kommen sie nacheinander zu ihm. Er verspricht ihnen andere Arbeitsbedingungen und eine Lohnerhöhung, und zum ersten Mal hat er keine Lust, sich beim Weggehen umzudrehen, um zu sehen, ob sie ihn hinter seinem Rücken auslachen.
Olivier geht aufrechter. Wenn er seiner eigenen Stimme lauscht, erkennt er sie kaum wieder. Es ist die Stimme eines erwachsenen Mannes und kein zischender Diskant.
Er bezahlt gut, aber nicht zu gut. Der Respekt muß woandersher kommen, und er tut es auch, das merkt er.
Mit dem Dasein als ältlicher Junggeselle, der seiner Mutter am Rockzipfel hängt, ist jetzt endgültig Schluß. Freunde besitzt er keine, nur Angestellte und Lieferanten und ein paar Nachbarn, mit denen er ab und zu ein paar Worte wechselt. Es gibt niemanden, der andere Fragen als die absolut oberflächlichsten stellen könnte, beispielsweise, wie die Reise war oder ob er auf Island gefroren habe. Niemand erwartet Vertraulichkeiten. Sein Geheimnis dort hat das andere abgelöst. Das schwere Geheimnis, das ihn und seine Mutter betraf, darf er für sich behalten.
Das Geheimnis, daß er nicht mehr nur der Hotelbesitzer Olivier Créach ist. Eine Stütze der Gesellschaft, einer, der zum Wohlstand und guten Ruf der Stadt einiges beiträgt.
Er ist auch Olafur, der Liebhaber, der sich ein neues Auto leistet, eine flache und luxuriöse Limousine wie die, die ihn beinahe auf einer Straße in Reykjavík überfahren hätte.
Olafur setzt sich mit größter Selbstverständlichkeit ans Steuer. Er tritt aufs Gaspedal und schlägt den Kurs nach Rennes ein, um den besten Fotoapparat zu kaufen, der auf dem Markt ist.
Die Fotos macht er im Vorübergehen, während seiner täglichen Arbeit mit den Gästen, den Angestellten, dem Einkauf und der Planung. Es ist Winter, und die Saison ist längst zu Ende, es ist ruhig, und er hat genug Zeit.
Immer mehr gelbe Umschläge mit Abzügen treffen ein, während er sich mit Handwerkern darauf einigt, aus der Wohnung im Obergeschoß des Hotels alle Möbel und Erinnerungsgegenstände zu räumen. Sie sollen nicht im Weg sein, wenn sie kommt.
Zuerst will er sie bitten, den ganzen Plunder auf die Müllkippe am Rand der Stadt zu fahren, aber als es endlich soweit ist, verlangt er einen Preis und wird gut bezahlt. Geld kann man immer gebrauchen. Die Sachen werden auf einer Auktion in einer anderen Stadt verkauft, das ist ihm wichtig, denn er will es nicht riskieren, daß sie in den Häusern anderer Leute in der Stadt auftauchen.
Die gelben Umschläge mit den Abzügen türmen sich, und jetzt sind nicht nur die Häuser der Stadt, die Fassade des Hotels, die einlaufenden Boote der Austernfischer, die Fischer in ihrem Ölzeug unten am Speicher und die Kirche mit dem Namen seines Vaters auf einer Gedenktafel zu sehen, sondern auch Bilder eines Zuhauses, das mit der Zeit immer vollkommener wird. Lieferwagen liefern Polstermöbel, ein geblümtes Sofa und Lehnstühle, Tische, Vorhänge und Teppiche, Schränke und Wandborde, Kissen und Kommoden und ein breites, bequemes Bett.
Aus dem Speisesaal holt er den großen Spiegel mit dem Goldrahmen. Der Koch hilft ihm dabei, ihn die Treppe hoch zu wuchten, und das zu Oliviers Erleichterung wortlos. Jetzt hängt er oben in den Privaträumen direkt hinter der Tür. Ehe er morgens zur Arbeit geht, stellt er sich davor und übt, sich anzuschauen, ohne den Kopf abzuwenden.
In der Stadt wird geredet, das merkt er, aber nicht mehr voller Verachtung. Die Leute betrachten ihn mit einer Art Bewunderung im Blick, wenn er am Nachmittag, während die Stadt aus ihrem Mittagsschlaf erwacht, die steile Straße zum Meer hinuntergeht.
Die Flut läuft mit kleinen, runden Wellen an der Küste auf, die Möwen stoßen unter einem blauen, grauen oder weißen Himmel ihre Schreie aus, die an ein Lachen erinnern. Es ist derselbe Himmel, es ist dasselbe Meer. In diesem Augenblick sitzt sie vielleicht irgendwo und blickt darüber hin. Seine Hand sucht den Stein in seiner Tasche. Er ist so rund und glatt wie eine nackte Schulter.
Das letzte Foto soll ihn selbst zeigen. Er stellt den Selbstauslöser so ein, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Dann baut er den Fotoapparat sorgfältig auf einem Stuhl auf und setzt sich dann aufs Sofa hinter den niedrigen Couchtisch und die Vase mit den roten Rosen, die er extra gekauft hat.
Ein Lächeln. Er wartet. Es dauert zu lange, vielleicht hat er ja etwas falsch verstanden. Er will sich gerade erheben, da blendet ihn der Blitz.
Auf dem Foto ist er etwas unscharf. Seine Augen sind seltsam rot, aber es sind seine Augen, wenn sie auch rot sind. Seine glattrasierten Wangen und sein weiches Kinn, sein runder Bauch unter der blauen Wolljacke. Sein schwarzes Haar mit den grauen Schläfen. Das ist er. Olivier. Jetzt muß er es eben drauf ankommen lassen.
Der Stapel Fotos kann jetzt verschickt werden. Er hat die besten ausgesucht und in ein rotes Album mit goldenen Lettern geklebt. Den Brief hat er kurz gehalten. Er hatte schon immer eine schöne Schrift, jetzt ist jeder Buchstabe von seiner Sehnsucht erfüllt.
Die Frau auf der Post, die er seit seiner Kindheit kennt, zieht die Brauen hoch, als er das teure Porto bezahlt. Sie kommentiert es nicht, das wäre ja auch noch schöner. Sie sagt nur: »Guten Tag, Olivier, nett dich mal wieder zu sehen, uns hat das Hotel letzten Sommer gefehlt, aber unter diesen Umständen war das ja verständlich.« Und dann vielen Dank und auf Wiedersehen.
Hochzeiten und Begräbnisse lösen sich im Speisesaal des Hotels ab, dann ist Erstkommunion mit Unmengen von Schalentieren, Pâté und Lammbraten, und Olivier tritt in Carolines Fußstapfen, und es fällt ihm überraschend leicht, Bestellungen entgegenzunehmen, zu organisieren, einzukaufen, Anweisungen zu erteilen und Geld zu verdienen. Er weiß nur zu gut, daß seine Mutter das für ihn getan hat. Nachts liegt er wach und fragt sich, was das alles für einen Sinn haben soll, wenn sie nicht kommt.
Nachmittags, wenn er vom Strand zurückgekehrt ist und die Männer der Stadt zu ihrem Aperitif eintrudeln, steht er hinter der Bar, gießt ein, wischt die Tische ab, leert die Aschenbecher und hält ein Schwätzchen.
Seine Hand sucht nach dem Stein in der Hosentasche.
Er überlegt sich, was aus dem Päckchen geworden ist, das schon längst angekommen sein müßte. Es kann etwas schiefgegangen sein. Das Flugzeug kann abgestürzt sein, im Laderaum des Frachters kann es gebrannt haben.
Die Frau auf der Post kann es aus Ahnungslosigkeit oder Unwillen unterfrankiert haben, und das Päckchen könnte schmählich zurückkommen.
Oder Edda ist, enttäuscht von seinem plötzlichen Verschwinden, umgezogen. Sie hat den Bus nach Norden genommen, und das Päckchen verstaubt auf irgendeinem Postamt in Reykjavík.
Das Wetter wird stürmisch und ungemütlich und hält ihn vom Strand fern. Die Samstagsmesse in der kleinen Kirche wird zu seiner Zuflucht, wenn ihn die Einsamkeit zu sehr belastet. Zwei alte Frauen, die für die frischen Blumen auf dem Altar sorgen und den düsteren Raum fegen, nicken ihm zu und flüstern ein paar Worte in der alten Sprache, wenn er zu seiner Bank geht. Mit ihren Rosenkränzen setzen sie sich ganz nach vorn. Hinten in der Kirche ist er allein.
Dort oben am Altar wird das Wort Fleisch. Wortlos betet er: Werde Fleisch, meine Edda. Laß uns ein Fleisch werden wie Gott und seine Gemeinde. Das ist Blasphemie, aber das ist ihm gleichgültig.
Das harte Holz des Betstuhls drückt gegen seine Stirn und hilft ihm dabei, sich zu konzentrieren, aber der leidende Christus, die Heiligen und die schmachtende Muttergottes aus Gips haben keine Chance gegen eine üppige Frau mit einer Furche auf dem Bauch und appetitlichen Wangen, und wenn er jemanden anbetet, dann bestimmt nicht den Gott seiner Kindheit, der nie seinen wichtigsten Wunsch erfüllte, sondern einfach nur sein Antlitz abwendete.
Die bewölkte und stürmische Weihnacht ist vorüber. Die Natursteinfassade des Hotels ist graunaß, und das Regenwasser schießt die steile Straße zum Meer hinunter. Es tropft vom Mützenschirm des Briefträgers, als er seinen Poststapel auf den Hoteltresen legt.
Eine Tasse Kaffee, um sich die Nase zu wärmen, ist das mindeste, was er ihm anbieten kann. Der Mann läßt sich viel Zeit und berichtet umständlich vom Weihnachtsfest mit Frau, Kindern und Schwiegereltern, während er immer wieder mal einen Schluck trinkt.
Olivier murmelt etwas und legt wie zufällig seinen Zeigefinger auf den dicken Briefumschlag zuoberst.
Er fühlt sich irgendwie wärmer an als alles andere. Ein Herz schlägt darin. Oder er bildet sich das nur ein und ist ein alter Idiot.
Endlich wuchtet sich der Postbote vom Barhocker hoch. Aber dann klingelt das Telefon, der Koch will etwas wissen, und ehe er sich’s versieht, ist Mittag, und ausgerechnet heute gibt es Gäste, die essen wollen. Am Nachmittag kann er endlich schließen.
Unter zwei Schichten Packpapier findet er eine sorgfältig zugebundene Plastiktüte, in der eine kleine Dose liegt. Eine Dose, in der vielleicht einmal ein Stück Seife lag. Aber jetzt ist sie mit rosa Watte von einem Goldschmied gepolstert, feuchter Watte.
Unter der Watte befindet sich ein Lavastein, ein schwarzer, poröser Stein, zwei grüne Herzblätter schauen aus ihm hervor. Vielleicht hat ein Vogel einen Samen verloren, und dieser Samen hat gekeimt.
Etwas Erde braucht man vermutlich, damit eine Pflanze wachsen kann. Olivier hat noch nie in seinem Leben etwas gepflanzt. Caroline pflegte in die langen Blumenkästen unter den Fenstern der Fassade Geranien zu setzen, und diese schienen zu gedeihen, ohne daß man sich um sie kümmerte. Er nimmt einen der kleineren Kupfertöpfe vom Kaminsims im Speisesaal und gräbt dann in der dunklen, nassen Erde unter dem Baum auf dem Hotelparkplatz.
Er fotografiert den Topf und läßt die Aufnahme entwickeln. Sein Schatten ist auf dem Bild zu sehen, aber das macht nichts, dann legt er das Foto in seinen nächsten Brief. Er schreibt im Schnitt zwei Briefe in der Woche. Er zwingt sich dazu, die Zahl zu begrenzen, damit er sich eine Weile auf jeden Brief freuen kann.
Zwei Abende in der Woche sitzt er im Bett und benutzt das Telefonbuch als Unterlage. Die Bewegungen des Kugelschreibers lassen ihn innerlich ganz ruhig werden. Mit dem Kugelschreiber in der Hand spricht er hoffnungsvoll mit ihr, über das Wetter und die ereignislosen Tage, die sich unendlich aneinanderreihen, da sie nicht da ist.
Meist geht es um die Arbeit, aber in letzter Zeit schreibt er auch über alte Schulkameraden, die sterben. Sie hatten ihn als Kind gehänselt. Jetzt geht er auf ihre Beerdigungen. Sie sterben, weil sie jahrelang gesoffen haben. Er hat ihrem Niedergang zugesehen. Andere sterben an Krebs oder Herzkrankheiten. Von den meisten weiß er nicht, ob sie glücklich oder unglücklich gewesen sind. Jetzt nimmt er von ihnen Abschied. Ohne Schadenfreude und ohne Groll.
Jeden Tag beerdigt er ein Stück seiner Vergangenheit. Hinter einem Sarg herzugehen ist nur ein äußerlicher Ausdruck dafür.
Die Pflanze ist gewachsen. Sie hat jetzt einen winzigen Stamm und oben zwei richtige Blätter. Runde, gezackte Blätter, die so grün sind, daß sie fast schon gelb wirken. Birkenblätter. Auf seiner Fensterbank wächst eine Birke.
Das Frühjahr ist stürmisch, und es kommt zu Überschwemmungen und einem Schiffbruch. Von Edda kommt nichts, kein Brief, keinerlei Lebenszeichen.
Ende Mai weiß er, daß er sie verloren hat. Diese Einsicht überfällt ihn eines Nachts. Er erwacht mit pochendem Glied, nachdem er von ihr geträumt hat. In weniger als einer Sekunde ist der Traum wie weggeblasen. Sie ist weg. Nur er ist noch da. Ein törichter alter Mann in hellblauem Schlafanzug in einem viel zu breiten Bett, für einen alten Mann ein hoffnungsloses, lächerlich optimistisches Bett.
Das Bäumchen im Stein war der Abschied, der Ersatz für sie. Jetzt erst versteht er es.
Der Kupfertopf spiegelt das Licht der Straßenlaterne. Er taumelt über den Fußboden und stolpert über seine Pyjamahose. Er reißt den kleinen Baum mitsamt der Wurzel aus und zerbricht ihn mit zitternden Fingern.
Am nächsten Morgen kehrt er die Erde und die Pflanzenreste vom Fußboden auf. Der Topf kommt wieder an seinen Platz auf dem Kaminsims. Er nimmt dies zum Anlaß, das Zimmermädchen zu bitten, alle Kupfersachen zu putzen.
Einige Tage lang ist er erleichtert. Wenn er darüber nachdenkt, dann hat sie es ihm vielleicht erspart, sich hier in der Stadt lächerlich zu machen, wieder das Opfer von Spott, Hohn und Verleumdung zu werden.
Die Terrasse des Hotels muß neu ausgestattet werden, und er kauft elegante Metallmöbel und ersetzt die üblichen Reklamesonnenschirme durch rotweiß gestreifte. Niemand soll ihm nachsagen können, daß ihm Frauengeschichten zusetzen. Es weiß zwar niemand etwas, aber trotzdem. Zum ersten Mal in seinem Leben will er hocherhobenen Hauptes umhergehen können, und vielleicht hat sie ihm ja einen Gefallen getan.
Der Zorn kommt überraschend. Er lauert ihm in Form einer unbezwingbaren Lust zu weinen auf, ohne daß er eigentlich traurig gewesen wäre.
Erwischt sich die Tränen mit einem Geschirrhandtuch ab, während es in seiner Brust pocht und lärmt, seine Hände und Füße zucken und er die Faust auf den Tisch knallt und gegen Stuhlbeine tritt. Die Angestellten schleichen an den Wänden entlang. Inmitten eines Wutausbruchs feuert er den Koch, einen kleinlauten Mann, der schon seit einem Menschenalter erst für Caroline und dann für ihn gearbeitet hat. Diese Kündigung nimmt er einige Stunden später sehr reumütig zurück.
Unten am Strand wirft er einen Stein nach dem anderen ins Wasser, auch dann noch, als es wegen der Ebbe schon längst sinnlos ist. Als letztes wirft er den Lavastein aus seiner Hosentasche. Er wirft ihn so weit wie möglich. Er trifft seitlich auf einen flachen Felsen auf und kehrt in einem kleinen, höhnischen Bogen zu ihm zurück.
Zwischen Tangbüscheln und Muscheln bleibt er auf dem feuchten Meeresboden liegen, ein Fleck der Trauer in einem Ozean des Zorns.
An diesem Abend trabt er im ganzen Gebäude herum und zählt seinen Besitz. Stühle, Tische, die duftenden Wäscheschränke mit ihren Bergen von Tischtüchern und Bettlaken, die mit Geschirr und Gläsern beladenen Regale, die Schubladen mit schwerem Besteck aus Neusilber, die Kupfertöpfe in der Küche, die riesigen Siebe, Schüsseln und Schneebesen. Den Keller mit den Weinflaschen, die auf den Regalen hübsch geschichtet liegen. Der Kühlschrank mit seinen Butter- und Sahnemengen, mit seinem Fischfond und seinen sorgfältig eingedickten Saucen.
Olivier Créach ist ein reicher Mann. Wuchert er mit seinem Pfund, dann wird er noch reicher, und Edda läßt sich ein Leben in Polstermöbeln entgehen – ohne morgendliches Putzen und mit der Möglichkeit, eine flache, luxuriöse Limousine statt eines rostigen Fahrrads zu benutzen.
Die Hoteltreppe knarrt unter seinem Schritt, und der Zorn wächst, verzweigt sich in seinem Körper und verdichtet sich in seinen Hoden. Als er schließlich in seinem Bett liegt, hat er eine anhaltende, quälende Erektion.
Nichts hilft. Er schmiert eine kühlende Salbe auf sein Glied, schüttelt es und schlägt darauf ein, ohne dem Erguß dadurch näher zu kommen.
Es ist nach eins, als er sich in sein Auto setzt. Er kennt den Weg, er hat seinen Besuch telefonisch angekündigt. Die Stimme am anderen Ende war schlaftrunken. Es ist lange her seit dem letzten Mal, aber jetzt ist es nötig.
Der Preis sei gestiegen, sagt sie, als sie ihn eingelassen hat und sie die schmale Treppe hochgehen. An ihrem mageren, bleichen Körper hängt ein Kimono. Wegen ihres Körperbaus hatte er sie damals vor vielen Jahren ausgesucht. Dünn und sehnig mit kleinen Brüsten, ein alternder Mädchenkörper, keine mütterliche Fülle.
Sie sind beide seitdem nicht jünger geworden, aber sie hat sich zumindest die Mühe gemacht, sich die Lippen zu schminken. Die Augen unter den pechschwarzen Wimpern betrachten ihn neugierig.
»Das war wirklich nicht gestern, Olivier.«
Früher saßen sie immer ein paar Minuten da und tauschten Gemeinplätze aus, ehe sie sich den Schlüpfer auszog und sich auf dem Bett auf den Rücken legte. Jetzt nicht. Wenn er was sagt, besteht die Gefahr, daß die Tränen zurückkehren.
Dieses Mal soll sie es ihm mit der Hand besorgen. Diesen Entschluß trifft er spontan. Nie mehr in eine Frau hinein.
»Wie du willst.« Sie zuckt mit den Schultern.
Das Geld liegt auf dem Tisch. Er zieht den Reißverschluß herunter und läßt sie machen, aber er spürt nichts. Nicht einmal, als er sieht, daß sich sein Unterleib zusammenzieht und es in das Klopapier spritzt, das sie bereithält. Was da passiert, widerfährt einem anderen, der kaum zugegen ist.
Das lauwarme Wasser in ihrem Bidet befördert ihn in die Gegenwart zurück. Eine Idee nimmt in seinem Kopf Gestalt an.
Es dauert eine Weile, bis sie versteht, daß es nicht um Pornographie geht.
»Meine besten Kleider?« Sie lächelt. Eine Abwechslung, nicht die Alltagsroutine, obwohl sie nicht versteht, was er damit bezweckt. Gut bezahlt ist es auch.
Zwei Tage später ist er zurück. Sein Glied hat ihn seit dem letzten Mal in Frieden gelassen. Es ist auch nicht der Grund seines Kommens.
Ihr strenges schwarzes Kleid, das kompliziert gefältelt ist, läßt ihn an eine Beerdigung denken. Ein passender Gedanke. Er will seine Beziehung zu Ebba zu Grabe tragen, ein für alle Mal und wirkungsvoll.
Sie trägt rote Schuhe mit Pfennigabsätzen. An den Ohrläppchen baumelt ein Paar große Goldringe mit glitzernden Steinen, aber er protestiert nicht. Es ist, wie es ist. Es kann gar nicht anders sein.
Den Rosenstrauß hat er in einem Blumenladen auf dem Weg gekauft. Ein riesiges Bukett aus gelben, rosafarbenen und dunkelroten Rosen mit Grün dazwischen und einer glänzenden Schleife. Sie sucht eine Weile nach einer Vase, die groß genug ist. Schließlich muß sie bei der Nachbarin anklopfen.
Stocksteif sitzt sie auf dem Stuhl, auf dem während des Kundenverkehrs ihr Schlüpfer und ihre Strumpfhose landen. Der Fotoapparat steht auf dem Bett, und er hat sich hinter ihr aufgebaut. Besitzergreifend legt er ihr eine Hand auf die schwarze Schulter, die sie gerne mit einem Tuch aus Goldlamé bedeckt hätte, aber das war ihm zu weit gegangen.
»Lächeln«, kann er gerade noch sagen, da blendet der Blitz ihn.
Noch eins, zur Sicherheit. Hierher wird er nie mehr zurückkehren.
Die Fotos läßt er in Rennes entwickeln, während er in einem Café wartet und eine Fußballzeitung von vorn bis hinten durchliest. Jedes Wort, jeden Buchstaben.
Der Mann im Fotogeschäft bedauert. Nur zwei Bilder auf dem Film, falls ihm ein Fehler unterlaufen sei, brauche er nichts zu bezahlen.
Olivier begleicht die Rechnung. Er nimmt den Umschlag mit den Fotos und setzt sich in seinen Wagen. Ohne sich die Bilder anzusehen, fährt er auf demselben Weg nach Hause.
Es ist Dienstag, und das Hotel ist geschlossen. Das gedrungene Gebäude atmet schwer und regelmäßig, ein schlafender Koloß.
Irgendwo knarrt eine der alten Dielen. Ein Eisklumpen fällt von der Decke des Kühlraums krachend auf die Bodenfliesen. Mit kratzendem Geräusch fährt der Kugelschreiber über das Papier, das auf dem Telefonbuch auf seinen Knien liegt.
Leb wohl, Edda, du wirst verstehen, daß ich den Kontakt abbrechen muß. Viel Glück. Er faltet das Blatt zusammen und schreibt ihre Adresse auf einen Umschlag.
Die Fotos sind fast identisch. Ein dicker Mann in grauem Anzug und blauem Schlips mit der Hand auf der Schulter einer schwarzgekleideten, mageren Frau. Ein Strauß Rosen steht neben dem Paar auf dem Tisch. Ihre glänzende Schleife wirft den Blitz zurück. Das Paar hat vom Blitz rote Augen. Die Frau wirkt erschrocken.
Ein Mann in einem schlecht sitzenden Anzug, der über seinem viel zu dicken Bauch spannt. Die Knöchel seiner Finger sind vor Fett nicht zu sehen, und er hat die runden Schultern einer Frau. Die magere Frau mit kurzem, gekräuseltem Haar sieht ziemlich mitgenommen aus. Das Kleid ginge ja noch, aber die Ohrringe und die auffälligen Schuhe haben etwas Nuttiges.
Mit den roten Augen sehen beide aus wie verheulte Zombies.
Wie hatte er je glauben können, daß Edda etwas bereuen, daß sie eifersüchtig werden würde? Wenn er ihr diese Fotos schicken würde, dann wäre sie sicher aus guten Gründen erleichtert.
Er knüllt das Papier zusammen und wirft es in den Papierkorb. Seit er vor mehreren Jahren zu rauchen aufgehört hat, trägt er keine Streichhölzer bei sich. Er trottet die Treppe hinunter zum Tresen, auf dem die Schale mit den Reklamestreichholzbriefchen steht.
Die Post liegt zwischen der Schale und dem Ständer für die Broschüren des Fremdenverkehrsamts. Er klemmt sich den Pakken unter den Arm, während er die Fotos verbrennt und das Spülbecken von Asche reinigt.
Auf dem Weg die Treppe hinauf fällt ein Brief aus dem Packen.
Ein hellroter Umschlag. In einer Ecke klebt ein vierblättriges Kleeblatt aus Silberfolie, in einer anderen ein Hufeisen. Die Briefmarken kennt er schon.
Was er auch enthalten mag, es ist zu spät. Er sagt sich das immer wieder vor, während er den Umschlag mit zitternden Fingern öffnet. Niemand soll jemals über ihn bestimmen können. Soviel ist niemand wert.
Eine hellrote Klappkarte liegt in seiner Hand. In sie ist ein Foto eingeklebt, das Foto eines Säuglings. Schwarzes, gelocktes Haar über Pausbacken. Hellroter Strampelanzug mit einem schmalen weißen Kragen. Eine gestrickte bunte Decke. Ein ausgelassenes Babylächeln. Hier komme ich.
Auf der gegenüberliegenden Seite stehen ein Datum und zwei Worte.
Carolina Olafsdóttir.
Ein Schwert hat ihn entzweigehauen.
Irgendwo auf der Welt lebt sein Kind.
Irgendwo auf der Welt gibt es ein Kind, das den Namen seiner Mutter trägt.
Caroline lebt in dem kleinen Körper weiter, in der Nase, dem Mund und in der breiten Stirn. Der Ausdruck, das Unabweisbare, das Abweisende, das Einschmeichelnde, das zu Eindringliche strahlt ihn unerbittlich aus dem glatten Babygesicht an.
Er bildet sich das ein, das weiß er. Es ist nur eine Projektion, aber wo verläuft die Grenze zwischen dem Kind und ihm selbst? Er ist das Kind, und das Kind ist er.
An diesem Abend trinkt der maßvolle Olivier, der vorsichtige Olivier, bis er voll bekleidet auf seinem Bett das Bewußtsein verliert. Gegen Morgen erwacht er. Decke und Überwurf und er selbst sind eingenäßt. Sein Schädel dröhnt, und er ist von seinem eigenen Gejammer erwacht.
Er bezieht das Bett neu, allerdings mit gewisser Mühe, und bald liegt er frisch gewaschen in seinem blauen Pyjama da und starrt an die Decke, an die frisch gestrichene Decke über dem breiten, bequemen Bett, das für mindestens einen weiteren Bewohner breit genug wäre.
Das erste Morgenlicht fällt durchs Fenster. Die Scheiben müssen geputzt werden. Er muß daran denken, dem Zimmermädchen Bescheid zu geben.
Auf dem Nachttisch liegt die Karte. Auf dem Bild ist ein schmieriger Fingerabdruck, auf der hellroten Pappe sind Weinflecken, aber was spielt das schon für eine Rolle?
Edda hat ihrem Kind diesen Namen gegeben als ein Geschenk an ihn. Ein Sohn hat seine Mutter verloren und statt dessen eine Tochter bekommen. Ein Mensch, der die Begabung zum Glück besitzt, denkt so.
Seine Hände sind über der Pyjamabrust gefaltet. Er könnte in diesem Augenblick sterben. Carolina Olafsdóttir würde trotzdem der Welt beweisen, daß er gelebt hat.
Er hat mit seinen eigenen, pflichtbewußten Händen die Hände seiner Mutter auf ihrer eingesunkenen Brust gefaltet. Er hat an ihrem Sarg Tränen vergossen, aber nicht ihretwegen. Das ihm vorenthaltene Leben sank mit ihr ins Grab. Als sie starb, starb er selbst.
Jetzt ist es höchste Zeit wiederaufzuerstehen.