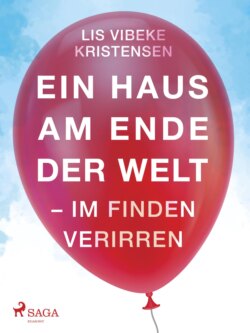Читать книгу Ein Haus am Ende der Welt - Im Finden verirren - Lis Vibeke Kristensen - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Joyce
ОглавлениеVielleicht erlebten es die Passagiere der Titanic genauso. Ein kleines Beben, während die Musik spielte und die Telegramme über den Atlantik hin und her gemorst wurden. Nichts, worum man sich kümmern mußte, und dann stand alles ganz plötzlich auf dem Kopf und verschwand in der Tiefe.
Ein Brief von Bills Anwalt unterrichtet mich, daß die Gegenseite die Vereinbarung hinsichtlich Joel neu verhandeln will, unter anderem auch mein Umgangsrecht.
Das klingt recht harmlos. Ich sehe es als eine Gelegenheit, zu erwirken, daß Joel mich gelegentlich auf eine Reise begleiten kann. Mein Sohn ist groß genug, um Gefallen daran zu finden, was ich ihm zu bieten habe, und es ist höchste Zeit, daß er eine andere, weniger konventionelle Seite der Welt kennenlernt.
Worum es bei diesem Brief in Wirklichkeit geht, nämlich ganz andere Dinge, stellt sich recht bald heraus.
Die Gegenseite möchte – und wenn ich daran denke, bekomme ich noch immer Lust, mit der Axt auf sie loszugehen – Joels Kindheit auseinanderreißen.
Sie will ihn aus der Familie nehmen, in der er als ein über alles geliebtes Mitglied aufgewachsen ist, sie will ihm die Geborgenheit nehmen, die er genossen hat, seit er als Neugeborenes in der Babytragetasche auf dem Rücksitz von Vaters Wagen abgestellt wurde.
Außerdem wünscht die Gegenseite, daß der Kontakt zwischen Joel und seiner Mutter ganz abgebrochen wird. Jedenfalls für einige Zeit und so lange, bis Joel sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt hat.
Bill hat zum zweiten Mal geheiratet, dieses Mal was Richtiges. Theresa ist bis ins Mark ihrer in Boston ansässigen Knochen Katholikin. Daß Bill überhaupt als Ehemann in Frage kam, liegt ausschließlich daran, daß sie selbst etwas schwer verkäuflich ist.
Theresa schielt zwar nicht und hat auch keine O-Beine, aber sie ist vier oder sechs Jahre älter als Bill.
Theresa ist vermögend. Dafür wohnt sie mit ihrer Mutter zusammen, die, wie es gerüchteweise heißt, nicht alle Tassen im Schrank hat.
Theresa war noch nie verheiratet. Sie hat sich sogar, fromm, wie sie ist, zeitweilig überlegt, ins Kloster zu gehen. Deswegen hat Theresa auch keine Kinder. Aber bevor ich mir noch einbilden kann, daß sich das gegen sie verwenden ließe, knallen sie schon ihren nächsten Trumpf auf den Tisch.
Die Person ist Kinderpsychologin, und das mußt du erst mal toppen, Joyce! Gutachter werden mit einem Mal überflüssig. Theresa hat speziell ausgebildetes Personal eingestellt, das sich um ihre Mutter kümmern soll, also ist auch sie zu nichts nütze.
Ich bin Theresa noch nie begegnet. In meinen Träumen tritt sie in Form einer Riesenkrake auf.
Als ich endlich begreife, worauf das alles hinauslaufen soll, vergehen nicht viele Minuten, ehe ich den Einsatz erhöhe.
Ich will mich nicht mit ein paar Stunden hie und da abspeisen lassen. Ich will das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn, nicht mehr und nicht weniger. Das mit dem Umgangsrecht werde ich recht großzügig handhaben, Bill, aber meine Geduld ist am Ende.
Am 17. Mai stehe ich in einem heulenden Schneesturm vor dem Gerichtsgebäude. Das Urteil ist gefällt. Vater ist da. Marge ist da. Es geht auch um sie. Um Gefühle. Um Bande, von deren Existenz ich keine Vorstellung hatte, ehe die Wanderung nach Golgatha der letzten Monate begann.
Ich habe kein Kind mehr. Marge hat eine amputierte Familie.
So viele Tränen, so wenig Trost.
Joel G. Turnbull ist mit seiner neuen Kernfamilie vereinigt, einmal abgesehen davon, daß das neue Familienoberhaupt nach Thule gefahren ist, kein geeigneter Ort für Frauen und Kinder, um in aller Ruhe seinen letzten Verpflichtungen dem Militär gegenüber nachzukommen.
Mutter Theresa, wie Marge sie getauft hat, hat freie Bahn. Der Verlust von Joel verbindet Marge und mich in einem Pakt, der noch unverbrüchlicher ist als der Bund der Kindheit, der aus Ohnmacht geboren wurde und gegen einen gemeinsamen Feind gerichtet war, der seine Anschläge als Rücksicht und gesunden Menschenverstand ausgab.
Es gelang mir, die Erlaubnis zu erwirken, meinen Sohn anrufen zu dürfen. Einmal pro Woche nach der Sonntagsschule. Wenn ich nicht zum ausgemachten Zeitpunkt anrief, mußte ich eine ganze Woche warten. Ein Kind muß sich auf die Erwachsenen verlassen können, darauf weist mich Theresa, die Kinderpsychologin, hin.
Marge hat keine Rechte. Sie ist so großmütig, mir keine Vorwürfe zu machen, aber ich sehe, daß sie leidet.
Wie es Joel geht, ist schwer zu durchschauen. Theresa macht sich während unserer Telefongespräche im Hintergrund zu schaffen. Sie verlaufen folgendermaßen:
»Hallo, mein Liebling.«
»Hallo, Joyce.«
Theresa legt wert darauf, daß er mich mit Joyce anspricht. Ich bin nicht mehr Joels Mutter, falls ich es je war. Ich bin eine von Joels erwachsenen Bezugspersonen.
»Geht’s dir gut?«
Wenn es ihm beschissen geht und er mir das sagt, was soll ich dann tun?
»Hast du irgendwas Nettes unternommen?«
»Ich hab’ im Pool gespielt.«
»Mit wem?«
»Kennst du nicht.«
Er hört geduldig zu. Sechsjährige sollen nicht geduldig zuhören. Aber statt mir Sorgen zu machen, verletzt es mich, und ich habe das Gefühl, eine Belastung zu sein.
»Lernst du schwimmen?«
»Ich kann gut schwimmen.«
»Wer hat dir das beigebracht?«
»David und ich haben uns das gegenseitig beigebracht. Dave und Marge waren zwar auch da, aber wir haben uns das selbst beigebracht.«
Er will noch etwas sagen, aber Theresa fällt ihm ins Wort.
»Joel G., denk dran, daß wir losmüssen, wenn wir rechtzeitig dort sein wollen.«
»Wo wollt ihr denn jetzt hin? Warum müßt ihr denn immer irgendwohin, gerade wenn ich anrufe?«
Meine Stimme droht sich zu überschlagen.
»Theresa will noch etwas sagen. Tschüs, Joyce.«
»Joel. Geh nicht. Joel.«
Mein Sohn ist geflüchtet, und ich verstehe ihn.
»Ich rufe nächsten Sonntag wieder an. Küßchen«, kann ich gerade noch ins Leere sagen, da ist sie auch schon am Apparat.
Theresas Stil ist beleidigend korrekt.
»Hallo, Joyce. Wir sind auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier bei einem von Joel G.s Freunden.«
Joel hat Freunde, und ich weiß nicht mal, wie sie heißen, weiß nicht, ob sie rothaarig sind oder dick und fett, weiß nicht, ob sie lieber Schokoladeneis oder Erdbeersorbet essen, ob ihnen rote Ballons gefallen oder ob sie lieber gelbe wollen, ich weiß überhaupt nichts.
»Joel G. ist ein sehr gefragter junger Mann, und darüber freuen wir uns«, fährt seine Stiefmutter fort. Bei dem Wort dreht sich mir der Magen um. »Joel G. veranstaltet nächste Woche seine eigene Party. Du denkst doch daran, daß er Geburtstag hat?«
Denke ich an den Geburtstag meines eigenen Sohns?
Das schlimmste ist, daß ich nichts tun kann, weder protestieren noch neue Diskussionen vom Zaun brechen. Theresa hat die Macht, Joels Vater, der nichts davon hält, die andere Backe hinzuhalten, hat sie ihr übertragen.
Ich haue mit der Faust auf den Putz der Küchenwand, der bereits herabfällt, und lege dann so besonnen wie nur möglich den Hörer auf die Gabel.
Die Monate vergehen, und die Restriktionen werden etwas gelockert. Es ist möglich, Joel einmal in der Woche spontan anzurufen, was unsere Gespräche aber auch nicht erschöpfender gestaltet.
Marges Versuch, auch nur einen einzigen Besuch zuwege zu bringen, stößt ständig auf Hindernisse, wichtige Ereignisse in dem, was Theresa als Joel G.s primäres Netzwerk bezeichnet.
So könnte es immer noch sein. In der Tat geht es auch wirklich einige Zeit so weiter, eine Zeit, in der ich mehr denn je arbeite. Die Arbeitslust stellt jedoch das verdrängte Verlangen dar, den Schmerz zu betäuben, die Sehnsucht zu übertönen und die Frustration und die Wut in Schach zu halten.
Um nicht von noch Schlimmerem abhängig zu werden, beschließe ich, eine neue Sprache zu lernen. Eine schwere Sprache, die sowenig wie möglich mit denen zu tun hat, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe.
Meine Wahl fällt auf das Keltische, das immer noch von alten Menschen in der Bretagne gesprochen wird. Eine Fischer- und Bauernsprache, eine Stein- und Mythensprache, in deren Zentrum das Meer, die Erde und die Sterne stehen.
Eine Sprache, die sich langsamer verändert als die Wirklichkeit, die sie umgibt, aber auch eine Sprache, die sich einer zweifachen Kolonialisierung ausgesetzt sah, und zwar von seiten der Zentralregierung und von seiten der globalen Sprachverflachung – das Ergebnis des schleichenden Kulturimperialismus, den das Land meiner Geburt so effektiv betreibt.
Ich beschäftige damit nicht nur meine Gedanken, sondern bekomme auch wieder Lust zu reisen. Das Reisen hatte ich bislang ad acta gelegt, weil ich meinte, mich auf demselben Kontinent befinden zu müssen wie Joel, um ihn nicht ganz zu verlieren.
In dieser Zeit entwickelte sich mein diplomatisches Talent von Null zu etwas, was auf irgendeiner bekannten Skala einen Ausschlag geben könnte. Bill ist wieder zu Hause, und es zeigt sich, daß mit ihm leichter zu verhandeln ist als mit Theresa.
Durch eine Verkettung von Wundern gelingt es mir, die Erlaubnis zu bekommen, Joel für ein langes Wochenende von seinem väterlichen Zuhause loszueisen. Natürlich unter der Bedingung, daß ich ihn abhole, allerdings nicht dort, sondern auf einem Flughafen, wo er von bevollmächtigtem Personal zu einem näher bestimmten Zeitpunkt angeliefert wird. Dort soll ich ihn nach beendetem Auftrag auch wieder abgeben.
Die Blumen der Wüste von Arizona blühen, und ich habe meine angespannten Nerven damit beruhigt, eine Entdeckungsreise zu planen. Sogar eine Schatzkarte habe ich gezeichnet. Hinter jedem Kaktus werden wir nach Gold suchen, dieses Gold werde ich verstecken, nachdem Joel abends im Hotel eingeschlafen ist.
Wir werden Limonensaft aus Feldflaschen trinken und Brot aus Maismehl, Pollo, Tacos und Guacamole essen, und ich werde Joel die ersten spanischen Worte beibringen.
Ich kann mir keinen Neunjährigen vorstellen, der sich nicht für eine Schatzkarte interessiert.
Mein Sohn ist dieser Neunjährige. Mein Sohn ist so wohlerzogen, daß es fast schon servil wirkt. Mein Sohn probiert vorsichtig und höflich von den exotischen Delikatessen. Mein Sohn spricht sein Tischgebet so diskret, daß mir klar ist, daß er seine Mutter, die sich nach ihrem ersten Hühnerschlegel bereits die Finger ableckt, nicht beleidigen will. Mein Sohn folgt seiner Mutter höflich, aber wenig enthusiastisch durch Sträucher und Büsche und läßt die Münzen, die sie aus dem Sand ausgräbt, rasch in seiner kleinen Gürteltasche verschwinden.
Abends bringe ich ihn ins Bett und liege dann in meinem eigenen, viel zu breiten, und lausche auf seine Atemzüge von dem anderen. Als er glaubt, daß ich eingeschlafen bin, wagt er es, sein Nachtgebet zu sprechen, in dem neben Vater und Tessie – erst glaube ich, daß es sich dabei um ein Haustier handelt, bis mir einfällt, daß Theresa eine Allergie hat – auch Großmutter Bernadette, Marge und Dave und alle ihre Kinder, eine Anzahl Fische aus dem Aquarium und zum Schluß jemand namens Joyce bedacht werden.
Mein Sohn schnieft in der Dunkelheit, aber ich wage es nicht, aufzustehen, um ihn zu trösten. Falls es sich wirklich um Weinen handeln sollte, was könnte ich denn tun, wenn ich das Problem wäre?
Am nächsten Morgen geht es weiter.
Mein Sohn macht Konversation und sagt absolut überhaupt nichts.
Mein Sohn ist neun und langweiliger als ein Büroangestellter.
In der Nacht, bevor wir zurückfliegen wollen, wache ich mit hohem Fieber auf und Mandeln so groß wie Hühnereier, und der Joel, der mit meinem kleinen Tauchsieder geduldig Wasser für meinen Tee erhitzt und mir kalte, nasse Waschlappen auf die Stirn meines schmerzenden Kopfes legt, erinnert mich an den Joel, den ich einmal gekannt habe.
Aber als ich mich auf zitternden Beinen winkend von dem kleinen Jungen verabschiede, dessen rotes Haar, mein rotes, irisches Haar, gut unter einer blauen Baseballmütze verborgen ist und der artig einer professionell lächelnden Bodenhosteß folgt, weiß ich, daß das so nicht weitergehen kann.
Stundenlange Telefongespräche mit Marge lösen keine Probleme. Joel befindet sich außerhalb unserer Reichweite. In meinen Gedanken ist er eine kleine, einsame Gestalt, die in Richtung Horizont trottet, während sowohl sein primäres als auch sein sekundäres Netzwerk in der Ferne verschwinden.
Aber vielleicht ist das nur Lüge und Wunschdenken, daß es ihm bei Marge oder sogar bei seiner Mutter mit ihrem nicht allzu strukturierten Privatleben besserginge.
Joel ist das einzige Kind einer wohlhabenden Familie. Er ist von Menschen umgeben, die ihn auf ihre Art mögen. Ich habe kein Recht, das zu bezweifeln. Er hat Freunde, ist aktiv und gesellig und lebt in geordneten Verhältnissen.
Zu guter Letzt sind es meine Zweifel, die die Sache entscheiden.
Was mich betrifft, ist der Kampf zu Ende. Ein Forschungsstipendium, das mir zwei Jahre Arbeit in Europa ermöglicht, rettet mich aus tiefster Depression. Nach einiger Überredung genehmigt die Universität mir Urlaub.
Die Telefongespräche mit Joel gehen weiter, genauso unsinnig und genauso mechanisch, bis ich aufbreche.
Irgendwo über dem Atlantik lasse ich ihn los.