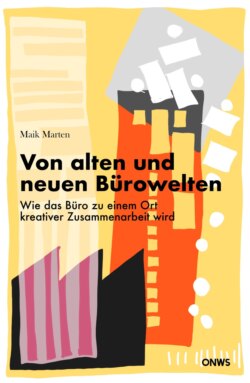Читать книгу Von alten und neuen Bürowelten - Maik Marten - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die protestantische Arbeitsethik
ОглавлениеDer Kapitalismus wirkte wie eine Urkraft, die die Gesellschaft in Arbeitgeber und Arbeitnehmer spaltete. Ein Trend, der besonders stark in den USA zu beobachten war. Über Generationen hinweg bestand Amerikas Wirtschaft größtenteils aus Kleinbetrieben und Selbständigen. Die USA waren das Land der Entrepreneure. Wer sein Glück finden wollte, baute sich eine selbständige Existenz auf. Auch wenn damit mehr Risiko und Unsicherheit verbunden war: Auf den eigenen Beinen zu stehen, galt als der amerikanische Traum schlechthin. Mit dem Wachstum der Unternehmen schien sich dieses Idealbild zu wandeln. Nun strömten die Menschen an die neu geschaffenen Arbeitsplätze in den Fabriken, Verwaltungen und Geschäfte. Dabei war die neue Arbeitswelt alles andere als perfekt. Zwar versprach sie mehr Sicherheit, steigende Einkommen und Teilhabe am wachsenden Wohlstand, aber die Industrialisierung sorgte mit ihrer gnadenlosen Spezialisierung und Rationalisierung von Arbeitsvorgängen auch für ein bisher unbekanntes Ausmaß an Eintönigkeit, Ermüdung und Abstumpfung. Man begann sich zu fragen, ob der Mensch das auf lange Sicht aushalte. Waren wir dazu geschaffen, die Mühen der fremdbestimmten Lohnarbeit auf uns zu nehmen? Führte uns die Rationalisierung nicht in eine zunehmende Entfremdung von der Arbeit? Machte sie uns nicht auf Dauer zu willenlosen Wesen?
Unter den Eindrücken einer im Jahr 1904 durchgeführten Reise durch Amerika, hatte der deutsche Soziologe Max Weber in seinem berühmten Werk Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus die These formuliert, dass die Wesenszüge des Kapitalismus eng mit der protestantischen Ethik verknüpft seien.1 Der Protestantismus, im Besonderen der Puritanismus, war seit dem 17. Jahrhundert die bestimmende Religion in den USA. Die Puritaner waren fromme, gottesfürchtige Menschen, deren Leben von Fleiß und Arbeit geprägt war. Für sie stellte Arbeit ein Mittel dar, Gott zu dienen und sich allem Weltlichen, Ausschweifenden und Müßigen zu entziehen. Wenn die Rationalisierung der Arbeit bedeutete, produktiver und sinnvoller als bisher mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen, sollte dies ganz im Sinne ihrer Religion sein. Folglich hatte man auch die mit ihr verbundenen Entbehrungen und Erschöpfungszustände zu erdulden.2 Technologie und Maschinisierung waren die Werkzeuge, um die moderne, bürgerliche Gesellschaft weiter voranzutreiben. Arbeit, auch wenn sie noch so langweilig war, wurde zur Pflicht eines rechtschaffenen Menschen.
Im Laufe der Zeit lösten sich Religion und Pflichtgefühl voneinander ab. Die puritanische Religiosität verschwand aus dem alltäglichen Leben der Amerikaner. Übrig blieb das Erbe einer „nüchternen Berufstugend“3, die die Menschen anhielt, die Bürden der Arbeit hinzunehmen. Der Charakter der Arbeit hatte sich für den Großteil der Erwerbstätigen geändert. Zwar waren viele Tätigkeiten monotoner und ermüdender als zuvor, aber die Rationalisierung der Wirtschaft sorgte gleichzeitig auch für steigende Gehälter, kürzere Arbeitszeiten und deutlich mehr Kaufkraft. So konnte man sich über die Langeweile am Arbeitsplatz und den Verlust von Autonomie durch zahlreiche neue Möglichkeiten des Konsums und der Freizeitgestaltung hinwegtrösten. Es begann sich ein veränderter Wertekanon unter den Menschen herauszubilden, der auf Technikglauben, Instrumentalismus, dem Segen der Rationalisierung und des Konsums beruhte.4