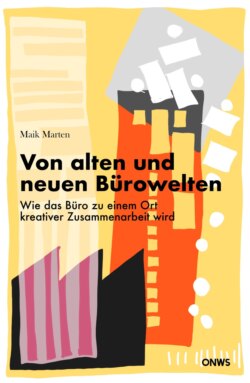Читать книгу Von alten und neuen Bürowelten - Maik Marten - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
White-Collar Factories
ОглавлениеDie Zeit der großen Männer geht zu Ende; die Epoche des Ameisenhaufens, des vielfachen Lebens fängt an. Das Jahrhundert des Individualismus läuft Gefahr, falls die abstrakte Gleichheit überhandnimmt, wahrhaftige Individuen aus dem Blick zu verlieren. Durch die ständige Nivellierung und die Aufteilung der Arbeit wird die Gesellschaft zu allem werden und der Mensch zu nichts.
(Henri-Frédéric Amiel, 1851) 1
Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert stieg der Bedarf an Büroraum sprunghaft an. Riesige Bürogebäude wuchsen in den Himmel, in denen hunderte, oft tausende Angestellte arbeiteten. Architekten, Bauherren und Manager setzten sich gemeinsam an den Tisch und erschufen systematische Grundrisse für die im Rahmen des Scientific Managements entwickelten Arbeitsvorgänge. Die Prämisse war die gleiche wie auch heute: Diejenigen Mitarbeiter, die viel miteinander kommunizierten, sollten möglichst dicht beieinander sitzen.2
Den Vorzug bekamen daher auch offene Grundrisse ohne störende Barrieren. Wände, Treppen und Etagen wurden, wenn möglich, vermieden. Zur optimalen Flächenausnutzung plante man lange, orthogonal ausgerichtete Tischreihen. An deren Enden gab es erhöhte Plätze für die Vorgesetzten und Kontrolleure. Von dort aus konnten sie die Arbeit ihrer Untergebenen leichter beobachten.
Abb. 6: Order Entry Department bei Sears, Roebuck & Co., Chicago, IL, ca. 1913, die Arbeiterinnen benutzen Schreibmaschinen von Oliver; Quelle: office museum
Der Schriftsteller Martin Walser, der als junger Mann selbst als Commis in einer Bank gearbeitet hatte, porträtierte in seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten immer wieder Angestellte und deren Habitate um die Jahrhundertwende:
Da sind in so einem Saal an die zehn bis fünfzehn Pultreihen mit Gängen zum Revuepassieren, an jedem Doppelpult arbeitet ein Paar Menschen, ….zuoberst im Saal steht das Pult des Vorstehers, …der Abteilungschef ist ein sackdicker Mann mit ungeheuerlichem Gesicht auf dem Rücken. Das Gesicht stemmt sich unmittelbar, ohne des Halsansatzes zu bedürfen, an den Rücken, und es ist brandrot und scheint immer zu schwimmen. Es ist zehn Minuten nach acht, Chef Hasler überfliegt mit ein paar gutgezielten Blicken den Raum, um zu überprüfen, ob alle da sind. Zwei fehlen, und das ist natürlich wieder der Helbling und der Senn.3
Das Mobiliar war schlicht, funktional und unpersönlich. Hochwertige Materialien, oder gar Luxus, suchte man vergeblich. Alles war auf das Zweckmäßige reduziert. Informelle Kommunikation sollte, zumindest direkt am Arbeitsplatz, vermieden werden. Mit prüfenden Blicken oder Rügen der Vorgesetzten war zu rechnen: „Der unaufhörliche Takt der Arbeit, das erbarmungslose Tempo der Produktion, zwang die Angestellten dazu, sich für jede Minute, die sie für etwas anderes als für ihre eigentliche Arbeit aufbrachten, zu rechtfertigen.“4 In den allermeisten Büros herrschte ein strenger Dresscode: Die Männer trugen dunkle Anzüge mit weißen Hemden und Krawatten, Frauen Röcke und weiße Blusen. Und da die Büroarbeit genauso erbarmungslos getaktet war, wie die Arbeit an den Maschinen in den Fabriken, nannte man die Arbeitsstätten der Angestellten auch white-collar factories.