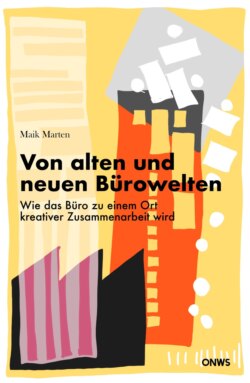Читать книгу Von alten und neuen Bürowelten - Maik Marten - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление… die Form folgt immer der Funktion,
und dies ist das Gesetz. Wo die Funktion sich
nicht ändert, ändert sich auch die Form nicht.
(Louis Sullivan, Architekt) 1
Von dem wohl bekanntesten Gestaltungsgrundsatz in Design und Architektur hat vermutlich jeder schon einmal gehört. Die meisten haben zumindest eine vage Vorstellung davon, was er besagt. Die Rede ist von form follows function. Vermutlich geht das Designparadigma, welches sich in Gebäuden, wie dem Guggenheimmuseum in New York oder der Berliner Philharmonie in Berlin widerspiegelt, und dem wir Produkte, wie den stromlinienförmigen Chrysler Airflow oder die minimalistischen Elektrogeräte der Firma Braun, zu verdanken haben, auf den amerikanischen Bildhauer Horatio Greenough zurück, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Einem größeren Publikum bekanntgemacht, hat ihn aber der amerikanische Architekt und Hauptvertreter der Chicagoer Schule, Louis Sullivan. In seinem im Jahr 1896 erschienenen Essay mit dem Titel The Tall Office Building Artistically Considered hatte er sich an den Versuch gewagt, um Verständnis für seine Bürogebäude zu werben. Dies war bitter nötig gewesen. Zu jener Zeit wurden überall riesige Bürogebäude auf den Sonnenplätzen aufgestellt, die die geschäftigen Straßen und schmucken Häuser der amerikanischen Innenstädte verdunkelten. Die Bürger verrenkten sich die Hälse, wenn sie hoch auf die eintönigen Fassadenraster schauten. Jedes Fenster glich dem anderen; jede weitere Etage, eine identische Kopie der vorherigen. Monströs, klobig und stumpf wirkten die neuen Nachbarn neben der bunten Vielfalt an Stadthäusern, Villen, Kirchen, Theatern, Museen und Warenhäusern. Unverständnis und Kritik an den neuen Formen machte sich breit. Architekten, Bauherren und Stadtväter gerieten in Erklärungsnot. Die neuartige Skelettbauweise machte es damals möglich, immer höher hinaus zu bauen. Typisch war eine Dreiteilung des Baukörpers: Das Erdgeschoss und die über breite Treppen erreichbare zweite Etage wurden für Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen geöffnet. Breite Fensterläden ließen viel Licht in das großzügig geschnittene und mit hochwertigen Materialien versehene Innere. Ganz oben, an der Spitze, befand sich die Attika, bei der die Architekten, wie schon in den beiden unteren Etagen, nochmals ihren Gestaltungswillen demonstrieren konnten. Dazwischen aber, vom dritten Geschoss bis fast unter das Dach, herrschte Monotonie. Nur wenig Abwechslung boten einige industriell vorgefertigte Ornamente auf den steinernen Fassaden. Hinter dem strengen Raster an Fenstern verbarg sich eine scheinbar unendliche Anzahl von Büroräumen. Je mehr Etagen die neue Bautechnik zuließ, umso trister und eintöniger wuchsen die neuartigen Riesen in den Himmel.
Theorien für die eigentümliche, dreiteilige Bauform wurden gesponnen; Vergleiche gezogen zu den klassizistischen Säulen mit ihrer Basis, ihrem Schaft und ihrem Kapitell; manch ein Theoretiker meinte, in ihnen die mystische Symbolkraft der Zahl Drei wiederzuerkennen; so wie sich zwangsläufig der Tag in Morgen, Mittag und Abend oder der Körper in Rumpf, Kopf und Extremitäten gliedere. Bestimmt, so meinte man, stecke die Trinität des Heiligen Geistes dahinter. Andere verglichen die in den Himmel wachsenden Gebilde mit der organischen Substanz von Blumen und Bäumen, mit ihren Wurzeln, Stängeln und Blüten.2 Viel zu weit hergeholt meinte Sullivan. Er suchte stattdessen nach einer universelleren Herleitung, nach etwas, dass man als eine Gesetzmäßigkeit betrachten konnte:
All things in nature have a shape, that is to say, a form, an outward semblance, that tells us what they are, that distinguishes them from ourselves and from each other. Unfailingly in nature these shapes express the inner life, the native quality, of the animal, tree, bird, fish, that they present to us; they are so characteristic, so recognizable, that we say, simply, it is „natural“ it should be so.3
Die Natur bildete die Vorlage. Ihre Mannigfaltigkeit, die millionenfachen Formen von Flora und Fauna waren allesamt Ausdruck ihrer spezifischen Funktionen. Und so ließ sich Sullivan auch von der Natur inspirieren und schaute auf das Innere der Gebäude, um von dort aus auf das Äußere zu schließen. Von den vielen einzelnen Büros, die sich hinter der Fassade befanden, nahm er an, dass sie alle die gleiche Funktion und mehr oder weniger der gleichen Größe, Höhe und natürlichen Belichtung bedurften. Neben- und übereinandergeschichtet wie einzelne, identische Waben in einem Bienenstock, wuchs so auf natürliche Weise das moderne Bürogebäude in die Höhe.4 Unerwähnt blieb der Einfluss moderner, industrieller Fertigungstechniken auf den Hochhausbau, unerwähnt blieb die stark angestiegene Nachfrage nach Büroflächen durch die rasant wachsende Industrie mit ihren administrativen Anforderungen und unerwähnt blieb auch, dass Bauherren und Vermieter ein großes Interesse hatten, die Büros einheitlich und flexibel zu bauen, um eine möglichst gute Vermietbarkeit der Flächen zu gewährleisten. Was später auch Carol Willis, die Gründerin und Kuratorin des Skyscraper Museum, dazu verleitete, aus Sullivans form follows function ein form follows finance zu machen.
Abb. 1: Wainwright Building in St. Louis, gebaut: 1891, Architekten: Adler & Sullivan; Quelle: Historic American Buildings Survey/Wikipedia
Sullivan hingegen konzentrierte sich in seinem Essay zunächst nur auf die Natur. Sie war Gesetz, nur ihr hatten alle Architekten streng zu folgen. Und aus ihr leitete er auch sein berühmt gewordenes Designparadigma ab:
Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows function, and this is the law. Where function does not change, form does not change.5
Sullivan war durch und durch Hochbauarchitekt. Wie viele seiner Kollegen, die später in seine Fußstapfen treten sollten, interessierte er sich in erster Linie für das Gebäude in seiner Gesamtheit: Technik, Statik und die Wirkung auf die Umgebung, standen klar im Vordergrund. Was im Inneren vorging, auf den vielen Büroetagen, war nur von zweitrangiger Bedeutung. Vielleicht machte er es sich auch deshalb etwas zu leicht, anzunehmen, die Funktionen der Büros wären überall gleich und würden sich auch nicht ändern. Andererseits lag er damit auch nicht gänzlich falsch. Von dem Zeitpunkt an, da Büroarbeit zu einem globalen Phänomen wurde, also ungefähr ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, bis weit in die 1960er Jahre hinein, glich sich die Büroarbeit auf ziemlich bemerkenswerte Art und Weise. Die Industrielle Revolution brachte die Massenfertigung mit sich, ließ die Verwaltungen in Betrieben und Behörden wachsen, sorgte für unermüdliche Effizienz- und Rationalisierungsmaßnahmen und auch für eine neue, einheitliche Form von Arbeitsabläufen. Unternehmer und Betriebswirte konnten sich überall auf der Welt auf ein allgemein gültiges Managementparadigma stützen, welches dafür sorgte, dass Funktion und Form der Büros über die Jahrzehnte hinweg mehr und mehr angeglichen wurden.
Während in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wichtige Schlüsseltechnologien und Verfahrenstechniken wie Dampfkraft, Eisenbahn und Elektrizität entwickelt wurden, stand die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zeichen eines bisher ungekannten Wirtschaftswachstums, des big business. Unternehmen, die den harten Unternehmenskampf der ersten Gründungsjahre überstanden hatten, wuchsen und eroberten einen Markt nach dem anderen; erst in der heimischen Wirtschaftsordnung, danach im Zuge der Expansion ins Ausland. Mit ihrem Wachstum skalierten die Unternehmen ihre Produktion und ihre Verwaltung. Heere von Angestellten wurden beschäftigt und damit betraut, die Prozesse ihrer Firmen zu organisieren, zu verbessern und auszudehnen. Sorgte die Industrielle Revolution für ein starkes Wachstum der Städte und das Entstehen der neuen Klasse der Fabrikarbeiter, ließ sich ab dem 20. Jahrhundert zunehmend der in Anzug, Hemd und Krawatte gekleidete Angestellte bzw. die in Rock und Bluse gekleidete Angestellte auf den Straßen der Städte beobachten. Es begann die Zeit des kleinen Mannes, der Kontoristen, Kommis, einfachen Buchhalter und Schreibkräfte. Höher gestellte Arbeitskräfte, die man mangels eines passenderen Begriffs zunächst oft noch Beamte nannte, stiegen auf und wurden alsbald zu Kontrolleuren, Vorstehern und Managern.
Die 1950er und 1960er standen im Zeichen des Konformismus. Nach den Erschütterungen des Zweiten Weltkrieges suchten die organization men die Sicherheit und Stabilität lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse in großen Konzernen. Karrieren wurden geplant und kompromisslos verfolgt. Ende der 1960er Jahre prägte der renommierte Unternehmensberater Peter Drucker den Begriff des Wissensarbeiters. Nicht Rohstoffe und Waren, sondern Wissen sei der zukünftige Wettbewerbsvorteil. Das Ringen um Fachkräfte begann. Mit ihnen vollzog sich zunächst zögerlich, ab den 1980er Jahren zunehmend beschleunigt, ein Wandel der Büroarbeit. Jetzt sprach man vermehrt von Informationsgesellschaft, Kreativität und Innovationsfähigkeit. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fand der große Transformationsprozess in der Büroarbeit statt. Kreative, schöpferische Tätigkeiten verdrängten nach und nach repetitive Aufgaben. Die Anforderungen an den Arbeitsplatz begannen sich zu wandeln. Ein Prozess, der in den letzten zwanzig Jahren nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Mittlerweile sprechen viele Firmen nicht mehr von Wissensarbeitern, sondern von ihren smarten Kreativen oder gar digitalen Bohemien.
Arbeiteten 1970 noch rund ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland in der Land- und Forstwirtschaft, sind es heute gerade einmal zwei Prozent. Dagegen sind mittlerweile zwei Drittel aller Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor beschäftigt.6 Seit 2011 wurden allein in Deutschland über 40 Millionen neue Jobs vorrangig in der Wissensarbeit geschaffen. Ein Trend, der weiter anhalten wird. Für 2020 halten einige sogar einen Anteil von 85 Prozent aller Erwerbstätigen für möglich.7
Die derzeitigen Fortschritte in der Automatisierung, Robotik und künstlichen Intelligenz veranlassen Ökonomen und Trendforscher dazu, davon auszugehen, dass ein Großteil heutiger Tätigkeiten zukünftig wegfallen und von intelligenten Maschinen übernommen werden wird. Die beiden MIT-Wissenschaftler Erik Brynjolfsson und Andrew McAffee sprechen demnach auch von einem zweiten Maschinenzeitalter, in dem wir uns derzeit befinden.8 Viele Berufsgruppen werden in den nächsten Jahren wegfallen. Potential für die menschliche Arbeitsleistung sieht man dafür weiterhin im Bereich der kreativen, schöpferischen Tätigkeiten. Ein Trend, der sich schon seit über 30 Jahren auch an den Löhnen erkennen lässt. Während gering qualifizierte Arbeitskräfte in diesem Zeitraum praktisch keinen Reallohnzuwachs zu verzeichnen haben, konnten Hochqualifizierte in derselben Zeit ihre Einkommen ungefähr verdoppeln.9
Die Zäsur fand in den 1980er Jahren statt. Davor war der Wissensarbeiter eher ein theoretisches Konstrukt; eine Ausnahmeerscheinung spezifischer Unternehmen und Branchen. Ab den 1980er Jahren begann die Informations- und Kommunikationstechnologie in ihrer Bedeutung die alten Industrien abzulösen. Wissen wurde zur neuen Ware, und mit ihr veränderte sich auch der Charakter der Arbeit und dessen Einfluss auf das Bürodesign – nicht nur für einzelne Unternehmen und Branchen, sondern für weite Teile der Wirtschaft.
Darum soll es in diesem Buch gehen; um die Evolution der Büros und um diejenigen Menschen, die einen Großteil ihrer Arbeits- und Lebenszeit in ihr verbrachten und verbringen. Es ist wahrhaft keine kleine Gruppe der Bevölkerung: Knapp acht Millionen Beschäftigte üben derzeit in Deutschland eine Bürotätigkeit aus.10 Das sind immerhin ein Fünftel aller Erwerbstätigen. Nicht mitgerechnet sind diejenigen, die zumindest gelegentlich vor ihrem Computer am Schreibtisch sitzen. Zudem gibt es immer häufiger fließende Übergänge zwischen den Tätigkeiten. Während beispielsweise in den Fabriken die Automatisierung weiter voranschreitet und viele Tätigkeiten wegfallen, gewinnt die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an Bedeutung. Ingenieure und Programmierer arbeiten in hybriden Arbeitsumgebungen und wechseln in hochautomatisierten Fertigungshallen zwischen festen und flexibleren Arbeitsplatzsituationen. Ihre Tätigkeit ist verstärkt von typischen Elementen der Büroarbeit geprägt.
Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die Anfänge der Büroarbeit beschrieben, bis zu jenem Moment, in dem sich ein sprunghafter Wandel im Charakter der Arbeit von repetitiven zu kreativen Tätigkeiten vollzogen hat. Es begann mit den familiären Kontoren und verstaubten Amtsstuben in der vorindustriellen Zeit. Mit dem rapiden Wirtschaftswachstum während der Industriellen Revolution entstanden dann im großem Maßstab Schreibsäle und white-collar factories für Millionen von Angestellten. Erst Jahrzehnte später folgten neue Konzepte, wie etwa das Action Office oder die Bürolandschaft. Dazu gab es auch schon immer regionale Unterschiede. In den USA und Großbritannien favorisierte man von jeher open plans und cubicles, auf dem europäischen Kontinent zieht man noch immer häufig das Einzelbüro vor.
Im zweiten Teil kommen die Entrepreneure, Visionäre, Sinnsucher, New Worker, Digital Natives und Kreative in ihren bevorzugten Arbeitsumgebungen zu Wort. Ihre Wirkungsstätten unterscheiden sich fundamental von den standardisierten Büros der ersten Phase. Vorgestellt werden Arbeitswelten, die die Kreativität und Innovationsfähigkeit fördern sollen. Hier geht es um Werkstätten, Labore und Ateliers; ebenso wie um Creative Hubs, Innovation Labs, Third Places und Coworking Spaces.
Während der erste Teil hauptsächlich einen Einblick in die historischen Arbeitsumgebungen der Büroarbeiter gibt, möchte ich im zweiten Teil auch die Hintergründe des aktuellen Bürodesigns beleuchten. Warum bevorzugen so viele Start-ups open spaces? Warum gleichen die Büros von Google, Facebook oder AirBnb mehr Club- und Sportanlagen? Was bedeutet der ganze Hype ums Coworking? Warum stellen einige Firmen den fun ganz oben auf ihre Prioritätenliste?
Lange Zeit über galt Arbeit als notwendiges Übel. Es gibt unzählige Abhandlungen von Soziologen, Philosophen, Historikern und Ökonomen, die nicht mit Erklärungsversuchen geizen und nach Möglichkeiten suchen, dem Zwang zur Arbeit zu entkommen. Für den österreichischen Philosophen Frithjof Bergmann und Mitbegründer des Zentrums für Neue Arbeit (New Work) war das im 18. Jahrhundert eingeführte Lohnarbeitssystem Schuld an allem. Arbeit versklave die Menschen und mache sie zu unmündigen Lebewesen, die vor lauter Last, Monotonie und Stumpfsinn bald selbst nicht mehr sagen können, was sie wirklich, wirklich wollen. Mangels Perspektive bleiben sie in ihrer Situation gefangen. Die negative Haltung zur Arbeit scheint sich aber in jüngster Zeit geändert zu haben. Zumindest für einige Teile der Beschäftigten gilt: Sie arbeiten gerne, oft auch trotz hoher Arbeitslast, langen Arbeitszeiten und permanenten Stresszuständen. Für sie ist Arbeit kein notwendiges Übel, sondern ein sinnstiftender Lebensinhalt. Auch hier scheint es eine enge Verknüpfung zwischen veränderten Tätigkeiten, dem richtigen Arbeitsumfeld und neuen Werten zu geben.
Das heutige Bürodesign wird von zwei besonderen Treibern bestimmt: Wettbewerbsdruck und schneller technologischer Wandel zwingen Unternehmen dazu, mehr Innovationsarbeit zu leisten. Das Bürodesign hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Kreativität und Innovationsfähigkeit seiner Nutzer und Nutzerinnen. Neben diesem Nützlichkeitsdenken geht es aber auch darum, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen wohlfühlen. Vorbei sind die Zeiten nüchterner, allein auf Effizienz getrimmter Arbeitsplätze. Wer heute um die Gunst der talentiertesten Wissensarbeiter kämpfen möchte, tut gut daran, schöne Arbeitswelten zu erschaffen. Der kolumbianische Philosoph Nicolás Gómez Dávila schrieb einst: „Wenn wir wollen, dass etwas Bestand hat, sorgen wir für Schönheit, nicht für Effizienz.“ Als Erwerbstätige verbringen wir rund ein Drittel unserer Zeit auf der Arbeit. Geht es uns nur um Produktivität und Effizienz und missachten wir dabei gänzlich Design und Ästhetik, verlieren wir einen wichtigen Teil unseres menschlichen Antriebes. Wir brauchen schöne Arbeitsumgebungen, um in ihnen inspiriert und erfüllt zu arbeiten. Gelungene Arbeitsumgebungen bieten daher auch immer beides: Funktionalität und Ästhetik.
So bunt und vielfältig die Welt ist, in der wir heute leben und die wir uns tagtäglich neu erschaffen, so verschiedenartig sind auch die Anforderungen an das heutige Bürodesign. Nichts steht still, alles ist in Bewegung: Wir arbeiten im Wechsel, allein oder im Team, und wir genießen die Freiheit, nach flexiblen Arbeitszeitmodellen und an verschiedenen Orten im und außerhalb des Büros zu arbeiten. Nur wenig haben Louis Sullivans gleichförmige Zellen noch mit den heutigen Bürowelten gemeinsam. Weitaus besser passt daher das damals von ihm postulierte Designparadigma form follows function in unsere Zeit. Von diesen neuen Arbeitswelten wird hier erzählt. Von den erfolgreichen und weniger erfolgreichen Konzepten, von Gewinnern und Verlierern. Nicht alles ist Gold, was glänzt, aber vieles scheint sich seit den white-collar factories zum Besseren gewendet zu haben. Das bestätigen Stimmungsumfragen unter Angestellten. Nach einer aktuellen Studie unter deutschen Arbeitnehmern mit Bürojobs sind über 80 Prozent zufrieden mit ihrem aktuellen Büroarbeitsplatz.11 Aber sind die Büros damit auch auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet?