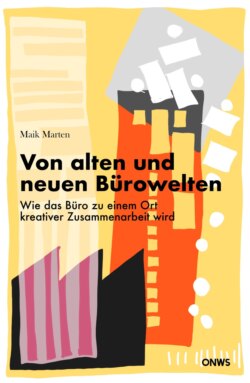Читать книгу Von alten und neuen Bürowelten - Maik Marten - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Entwicklung in Europa
ОглавлениеDer Bedarf an Bürofläche war in Europa für lange Zeit deutlich geringer ausgeprägt als in den USA. Die amerikanische Bürowirtschaft spielte den Vorreiter. Dort war der Geburtsort des Scientific Managements, dort hatte die Rationalisierungswelle die Fabriken und Büros als Erstes erfasst und von Grund auf umgekrempelt. Und dort war das finanzielle Kapital geschaffen worden, um alle Dimensionen der Wirtschaft größer zu skalieren. Natürlich hatte auch in Europa das Scientific Management viele begeisterte Nachahmer gefunden. Aber hier durfte alles eine Nummer kleiner sein: das Wachstum der Angestelltenzahlen, Anzahl und Dimensionen der Bürogebäude und die Begeisterung für offene, effizientere Bürokonzepte. Und auch wenn Bezeichnungen wie Großraumbüro oder Schreibmaschinensaal Größe suggerierte: Europäische Großraumbüros waren meist kleiner als ihre amerikanischen Pendants, und sie ergänzten auch nur die überwiegend konventionell geschnittenen Büroflächen. Kleine, enge, verwinkelte Büros in alten Gebäuden; schmale Korridore in der Mitte, von denen links und rechts, zu den Fenstern hin, die Büroräume abgingen, waren in den historischen Städten Europas weitaus üblicher.
Auch in Deutschland vollzog sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Wandel von einer Gesellschaft aus Bauern und Handwerkern zu einer Industrienation. Die Menschen verließen mit ihren Familien das Land und suchten Wohnraum und Arbeit in den wachsenden Städten und Ballungszentren. Das Ruhrgebiet wurde zur Kohlegrube, Sachsen zum Kompetenzzentrum der Textilwirtschaft und Berlin zum Hotspot der Elektro- und Lokomotivtechnik. August Borsig baute in seinem Berliner Feuerland Lokomotiven, Alfred Krupp schoss in Essen aus stählernen Kanonen, Friedrich Engelhorn bezeichnete seine neu gegründete Aktiengesellschaft die Badische Anilin & Sodafabrik, Carl Zeiss entwickelte in Jena Präzisionsobjektive und ein preußischer Ingenieur namens Werner von Siemens schaffte mit der Erfindung des Dynamos von Berlin aus die Voraussetzung für die weltweite Erzeugung und Verteilung von Strom. Die Liste ließe sich noch lange weiterführen. Viele bekannte, deutsche Marken wurden in jener Zeit gegründet. Besonders viele Gründungen erfolgten zwischen den Jahren 1848 und 1873. Später nannte man diese Periode deshalb auch die deutsche Gründerzeit.1 Der Wirtschaftsboom fand vor allem in den Städten statt. Während sich die Landstriche ausdünnten, platzten die urbanen Zentren aus allen Nähten. Hier fand man Arbeit, dafür nur spärlich Wohnraum. Es wurde eng in den Häusern und Straßen. Waren es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch hauptsächlich Kaufleute und Handwerker, stellten erst die Fabrikarbeiter, und mit etwas Verzögerung, die Angestellten, den Hauptteil der Erwerbstätigen. Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts klafften die Zahlen weit auseinander. Während sich die Menge der Arbeiter in den Fabriken immerhin noch verdoppeln konnte, verfünffachte sich in der gleichen Zeit die Zahl der Angestellten. Spätestens in den 1930er Jahren wurden sie zu einem Massenphänomen. So gab es 1930 in Deutschland über 3,5 Millionen Angestellte; knapp ein Drittel von ihnen waren Frauen.2 Von den 3,5 Millionen arbeiteten 2,25 als kaufmännische Angestellte, gefolgt von den Büroangestellten, Technikern und Werkmeistern, die jeweils etwa eine viertel Million ausmachten. Der überwiegende Teil der Angestellten war in der Industrie (1,5 Million) beschäftigt. Hier bestand der mit Abstand größte Bedarf an Bürotätigkeiten. Der Rest arbeitete in den Bereichen Handel, Banken und Verkehr.
Die Arbeit im Büro oder Geschäft war beliebt unter den Menschen. Sie galt als leichter, sauberer und angenehmer. Besonders junge Bewerber eiferten einem Job im Büro oder in einem der schicken Läden in der Innenstadt nach. Dabei ging es den einfachen Angestellten finanziell oft nicht viel besser als den Fabrikarbeitern, was ihnen auch den Spitznamen des Stehkragenproletariats einbrachte. Den Vätern und Müttern war dies aber gleich. Wünschten sie sich einst für ihre Kinder eine Lehre in einem angesehenen Handwerksbetrieb, hielt man eine Anstellung in der Verwaltung eines Betriebes nun für deutlich zukunftssicherer.