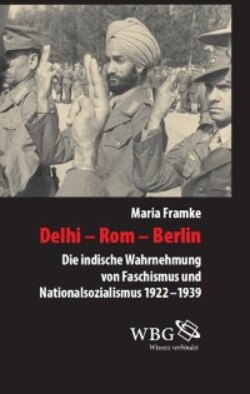Читать книгу Delhi - Rom - Berlin - Maria Framke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Untersuchungsgegenstand, Quellen und Methodik
ОглавлениеDie bisherige Forschung zum Thema Faschismus in Indien in der Zwischenkriegszeit hat sich schwerpunktmäßig auf den Hindunationalismus und sein Umfeld konzentriert. Die Positionen und Schriften von Einzelpersonen, wie Vinayak Damodar Savarkar, Balkrishna Shivram Moonje und Madhav Sadashiv Golwalkar8, aber auch die Resolutionen und Arbeitsunterlagen der Hindu Mahasabha (HMS) sollen hier in einen wesentlich breiteren Zusammenhang gestellt werden, nämlich die Debatten in weiteren Teilen der nationalistisch orientierten englischsprachigen Öffentlichkeit in Indien. Ein zweiter For schungsfokus lag bisher auf dem Politiker Subhas Chandra Bose,9 der im Zweiten Weltkrieg mit den Achsenmächten zusammenarbeitete, um auf diesem Wege Indien von der britischen Kolonialherrschaft zu befreien. Bose war bis 1939 führendes Mitglied des INC. In der Literatur wird er, trotz seiner Kollaboration mit Deutschland, Japan und Italien selten als Faschist, sondern überwiegend als (fehlgeleiteter) Nationalist beschrieben, womit auch die Darstellung des INC als monolithisch antifaschistischer Block unterstützt wird. Dieses in der Historiografie verankerte Bild des INC10 lässt sich zum einen durch die starke antifaschistische Rhetorik verschiedener Kongresspolitiker, wie z.B. Jawaharlal Nehru, sowie durch deren Einfluss auf die offizielle Ausrichtung der Partei erklären. Zum anderen scheint auch die den Faschismus und Nationalsozialismus ablehnende Haltung der Congress Socialist Party (CSP), die unter dem organisatorischen Schirm des INC arbeitete, zu dem Bild beigetragen zu haben. Im vorliegenden Buch wird die bisherige Darstellung des INC kritisch überprüft. Teilte der gesamte INC, der innerhalb seiner organisatorischen Grenzen nicht nur die linke CSP, sondern auch einen starken rechten Flügel umfasste, antifaschistische Ansichten? Wie repräsentativ waren die faschismuskritischen Stimmen in der Nationalbewegung? Diese Fragen sollen mit Hilfe eines umfangreichen Quellenkorpus beantwortet werden. Eine lebhafte Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus fand nicht nur im Rahmen der institutionalisierten Politik in Indien statt, sondern ebenfalls unter Angehörigen der bengalischen Intelligenzija, die persönliche Beziehungen zu beiden Regimen pflegten, z.B. im Kultur- und Bildungsbereich und die auf dem Subkontinent als wichtige politische Impulsgeber wirkten.
Die Gruppen bzw. die in dieser Arbeit ausgewählten Personen gehörten somit zum INC, zu den Hindunationalisten oder zur bengalischen Intelligenzija. Während die ersten beiden Gruppen politischen Organisationen bzw. Bewegungen entsprechen und trotz vorhandener personeller und inhaltlicher Überschneidungen in den 1920er, 30er und 40er Jahren11 getrennt behandelt werden sollten, umschreibt die dritte Gruppe eine heuristische Kategorie. Eine solche Einteilung wird der komplexen sozialen Realität notwendigerweise nur bedingt gerecht; eine einzelne Person konnte durchaus zu allen drei Gruppen gehören. Der Nutzen einer solchen Einteilung liegt jedoch darin, dass sie die Verschiedenartigkeit inmitten existierender Überschneidungen sichtbar machen kann. Das vorliegende Buch liefert keine allgemein gültigen Argumente für ganz Indien im konventionellen Sinn, allerdings beschränkt es sich auch nicht auf die Fallstudie einer einzelnen Gruppe oder einer einzelnen Region. Es umfasst die englischsprachige antikoloniale Öffentlichkeit und ist damit regional übergreifend.
Transnationale Geschichte beschäftigt sich meines Erachtens nicht einfach mit der Tatsache, dass verschiedene Staaten und ihre Bewohner miteinander in Kontakt standen. Viel eher besteht ein wichtiger Aspekt transnationaler Geschichte darin zu untersuchen, wie Menschen und Ideen miteinander verbunden waren; und das kann anhand der Quellen, die in dieser Studie benutzt wurden, nachdrücklich aufgezeigt werden. Die Verbindungen oder Verflechtungen (im Englischen auch entanglements genannt), denen das Buch nachgeht, machen deutlich, dass Intellektuelle unterschiedlichen Ideen folgten, dass sie vielfache und widersprüchliche Identitäten und Ansichten entwickelten und dass sie die rigiden Begrenzungen von Regionen, Provinzen, Nationen und Nationalismen in Frage stellten. Die Auswahl der Akteure wurde vor allem von zwei Faktoren bestimmt, und das sind die beiden Ideologien, mit deren Rezeption sich das Buch auseinandersetzt: Faschismus und Nationalsozialismus sowie Nationalismus. In der Zwischenkriegszeit existierten in Indien eine Reihe verschiedener Nationalismen. Das vorliegende Buch konzentriert sich vorrangig auf eine dominante Variante des Nationalismus, auf den ‚Mainstream‘-Nationalismus der Unabhängigkeitsbewegung bzw. des INC. Eine zweite Nationalismusvariante, die hier ebenfalls Beachtung findet, ist der Hindunationalismus. Abermals ist es wichtig festzuhalten, dass nicht immer politische Identitäten eindeutig abgegrenzt werden können und um eben diese Vielseitigkeit deutlich zu machen, werden in den folgenden Kapiteln nicht nur hochrangige Politiker des INC oder prominente nationalistische Intellektuelle ins Blickfeld genommen. Ziel des Buches ist es vielmehr, weniger bekannte und erforschte Personen zu untersuchen, die gleichwohl durch ihre Schriften und Lebensgeschichten in signifikanter Weise die Debatten des interkontinentalen intellektuellen Austausches geprägt haben.
Als Quellenmaterial zur Untersuchung der Wahrnehmungen von Faschismus und Nationalsozialismus der drei beschriebenen Gruppen (Hindunationalisten, INC, Intelligenzija) werden einerseits ihre publizierten Werke, unveröffentlichte Privatpapiere sowie die Parteiunterlagen des INC und der HMS herangezogen. Andererseits liefern die Aktenbestände des italienischen Außenministeriums, des Gentile-Nachlasses und die India Office Records der British Library wichtige auswertbare Materialien. Als dritter und umfangreichster Quellenkorpus werden in diesem Buch eine Reihe indischer Zeitungen und Zeitschriften analysiert. In ihnen publizierten Angehörige der drei Gruppen ihre Artikel, mit denen sie zur Diskussion beitrugen. Gleichzeitig ermöglicht aber die Analyse der ausgewählten indischen Medien Aussagen zur Wahrnehmung des Faschismus und des Nationalsozialismus unter Angehörigen englisch gebildeter indischer Kreise, die die Nationalbewegung bzw. die Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützten oder in ihr politisch aktiv waren und sich an den medialen Debatten beteiligten.
Die indische Presselandschaft kann in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts in drei breite Kategorien eingeteilt werden: in 1. englischsprachige Medien in britischem oder 2. indischem Besitz sowie in 3. indischsprachige Zeitungen und Zeitschriften. Während Zeitungen der ersten Kategorie größtenteils die Politik der Kolonialmacht unterstützten, vertraten die beiden anderen oftmals einen nationalistischen Standpunkt, standen der Unabhängigkeitsbewegung nahe oder wurden von Politikern des INC herausgegeben.12 Die englischsprachige nationalistische Presse gewann in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg auf dem südasiatischen Subkontinent an Einfluss und professionalisierte ihre journalistische Arbeit, was ebenfalls mit der Betonung ihrer inhaltlichen Eigenständigkeit einherging. Letzterer Aspekt galt nicht nur gegenüber den britischen Kolonialherren, sondern auch gegenüber den Führern der Nationalbewegung und verursachte unter Umständen widersprüchliche Interessenlagen oder brachte kritische Berichterstattungen mit sich, insbesondere nach der Regierungsübernahme des INC in sieben von elf Provinzen Britisch-Indiens 1937.13 Die Heterogenität und Komplexität der Debatten in den nationalistischen englischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften zu innerindischen, aber auch zu internationalen Themen war keineswegs nur durch die journalistische Professionalität begründet. Sie spiegelten ebenfalls die Diversität der indischen Gesellschaft – in diesem Falle vor allem der englisch Gebildeten – sowie die umfangreichen Interessenlagen, die sich unter dem organisatorischen Dach der Nationalbewegung versammelten, wider. Dem INC gehörten sowohl auf Landes- als auch auf Provinzebene Vertreter mit äußerst verschiedenen Haltungen hinsichtlich wirtschaftlicher, sozialer und politischer Fragen an. Dennoch bemühte sich die Führungsspitze des INC eine gemeinsame Stimme zu finden, diese publik zu machen und damit ihren Anspruch durchzusetzen, allein für die gesamte indische Nation zu sprechen. Die nationalistische englischsprachige Presse wurde von den führenden Kongresspolitikern dabei als Instrument gesehen, die eigene Vision von einem unabhängigen Indien zu verbreiten und somit die indische Nation unter Führung des INC zu einen. Die Darstellung konkurrierender politischer Meinungen sowie kritische Auseinandersetzungen der Medien mit dem INC führten nicht nur zu Konflikten, sondern liefen seinen Bemühungen, sich als die Stimme Indiens zu präsentieren, entgegen.14 Vor diesem Hintergrund eröffnet eine Auswertung der ausgewählten Medien in diesem Buch den Zugang zu heterogenen Debatten zum italienischen Faschismus und zum Nationalsozialismus in nationalistischen indischen Kreisen, die den exklusiven Deutungsanspruch der Führungsspitze des INC in Frage stellten.15
Als primäre Quellen für dieses Buch wurden Beiträge aus englischsprachigen Zeitungen (Bombay Chronicle, The Mahratta, The Hindu Outlook, The National Herald, Amrita Bazar Patrika und Forward/Liberty) und aus Zeitschriften (Modern Review, Calcutta Review, Congress Socialist und Harijan) herangezogen.16 Diese Zeitungen und Zeitschriften befanden sich nicht nur in indischem Besitz, sondern unterstützten die Nationalbewegung und ihre Ziele, insbesondere die Erlangung der indischen Unabhängigkeit. Sie nahmen somit an der Entwicklung nationalistischer Perspektiven teil und enthielten intellektuelle, oft widersprüchliche Reflektionsprozesse, die sich mit der Zukunft der Gesellschaft befassten. Englischsprachige Medien in indischem Besitz zirkulierten im Gegensatz zu indischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften durch die Wahl des Englischen über regionale Grenzen hinweg. Damit konnten im Englischen gebildete Leser im gesamten Land auf Informationen zugreifen und an Debatten teilhaben.17 Darüber hinaus ermöglichte es der Gebrauch der englischen Sprache, direkt mit der britischen Kolonialmacht und ihren Vertretern zu kommunizieren und die eigenen Vorstellungen und Meinungen zu präsentieren, ohne dass Übersetzungen nötig waren. Auch die indische Beteiligung an international geführten Debatten gestaltete sich durch englischsprachige Medien einfacher. Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser Medien ist durch ihre jeweiligen Publikationsorte gegeben. Mit Ausnahme des direkt durch führende Mitglieder des INC kontrollierten National Herald und von Gandhis Zeitschrift Harijan wurden sie in den Provinzen Bombay und Bengalen publiziert, was den regionalen Schwerpunkt ihrer Berichterstattung bestimmte. Obgleich die ausgewählten Zeitungen und Zeitschriften überregional zirkulierten und internationale wie auch nationale Themen besprachen, ist ihr regionaler Hintergrund im Zusammenhang mit den ebenfalls untersuchten Gruppen der bengalischen Intelligenzija und den aus der Provinz Bombay stammenden Hindunationalisten wichtig.
Bevor weitere, in diesem Buch verwendete mediale Quellen vorgestellt werden, sollen an dieser Stelle kurz einige Hintergrundinformationen zu den wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften gegeben werden. Der Bombay Chronicle wurde 1907 in Bombay (heute Mumbai) von Pherozeshah Metha mit der Absicht gegründet, der moderaten nationalistischen Politik der ‚westlich‘ gebildeten Wirtschaftskreise und der Intelligenzija eine Stimme zu geben. Unter dem britischen Herausgeber B. G. Horniman, der sich aktiv für die indische Unabhängigkeit einsetzte, verbreitete die Zeitung schon während des Ersten Weltkrieges radikale, modernistische Ansichten und übte einen immensen Einfluss auf die öffentliche Meinung Bombays aus. Bis 1930 bemühten sich die Herausgeber der Zeitung um einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Kräften innerhalb der INC-Führung und den regionalen Interessen Maharashtras (Provinz Bombay). Der Bombay Chronicle entwickelte sich in dieser Zeit zur wichtigsten englischsprachigen nationalistischen Zeitung in der Provinz Bombay mit einer Auflage von mehr als 10.000 Exemplaren in der Mitte der 1920er Jahre. Unter dem muslimischen Herausgeber S. A. Brevli (1923 bis 1949), der zwar keine eigenen politischen Ambitionen besaß, aber der Hindu-Muslim-Einheit sowie sozialistischem Gedankengut verpflichtet war, wurde der Bombay Chronicle zu Beginn der 1930er Jahre endgültig zum Befürworter des INC, allerdings mit eigenen Ansichten und einem selbstständigen Leben.18 Die Amrita Bazar Patrika, gegründet 1868 von der Ghosh Familie im Dorf Amrita Bazar, wurde zuerst als Wochenzeitung in Bengali herausgegeben. 1871 erfolgte der Umzug nach Kalkutta (heute Kolkata) und die Zeitung wurde zweisprachig, in Bengali und Englisch veröffentlicht. Um den Regulierungen des Vernacular Press Act von 1878 zu entgehen, wandelten die Herausgeber die Patrika zu einer rein englischsprachigen Zeitung um, die seit 1891 täglich erschien. Die Amrita Bazar Patrika entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer der führenden Zeitungen in der Provinz Bengalen. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts galt sie als Stütze der Nationalbewegung, als eine der wichtigen nationalistischen Zeitungen, deren Herausgeber allerdings neben der Politik der Kolonialregierung ebenfalls die Maßnahmen der verschiedenen indischen Sektionen der antikolonialen Bewegung kritisch hinterfragten, wenn diese den eigenen Vorstellungen zuwiderliefen. In den 1930er Jahren wirkte Tushar Kanti Ghosh als Herausgeber, der sich aktiv am indischen Unabhängigkeitskampf beteiligte und in diesem Zusammenhang von der Kolonialregierung inhaftiert wurde.19 Eine zweite englischsprachige Zeitung aus der Provinz Bengalen war der Forward. Gegründet vom Kongresspolitiker und Führer der Swaraj Party C. R. Das im Herbst 1923, wurde die Zeitung in der Anfangszeit von Subhas Chandra Bose betreut. 1929 wurde sie in Liberty umbenannt.20 The National Herald wurde 1938 als Zeitung des INC in den United Provinces mit dem Ziel gegründet, eine loyale Kongresszeitung zu schaffen. Dies war nach Ansicht der Kongress-Politiker aufgrund der vermehrten Kritik der nationalistischen indischen Presse seit der Regierungsübernahme in der Mehrzahl der Provinzen Britisch-Indiens durch den INC 1937 dringend nötig. Der National Herald hatte insbesondere in den ersten Jahren viele Probleme qualitativer, personeller und finanzieller Natur, was seinen Absatz negativ beeinträchtigte.21 Die Wochenzeitung The Mahratta wurde von Bal G. Tilak, einem bekannten Politiker der Unabhängigkeitsbewegung aus der Region Maharashtra, 1881 gegründet. Die Zeitung bemühte sich die gebildete englischsprachige Öffentlichkeit der Provinz sowie die überregionale Intelligenzija anzusprechen. Gleichzeitig hatte Tilak mit Kesari eine weitere Zeitung, die in Marathi publiziert wurde, gegründet. In den 1930er Jahren wurden beide Zeitungen von N. C. Kelkar herausgegeben, der sowohl im INC wie auch in der HMS aktiv war. Parimala Rao kommt in diesen Zusammenhang zu dem Urteil, dass The Mahratta in den 1920er und 1930er Jahren die Ansichten der HMS vertrat. Allerdings veröffentlichte die Zeitung auch Beiträge, die von Angehörigen des linken Kongressflügels verfasst wurden. The Mahratta hatte Ende der 1920er Jahre eine Auflage von 1.100 Stück pro Ausgabe.22
Die seit 1907 in Kalkutta erscheinende Zeitschrift Modern Review wurde in den 1930er Jahren von ihrem Gründer Ramananda Chatterjee herausgegeben. Chatterjee wollte mit seiner Zeitschrift die indische nationale Identität stärken.23 Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift Harijan wurde 1933 von Gandhi mit dem Ziel gegründet, seine Reformarbeit zur Verbesserung des Status und der Lebensbedingungen der sogenannten ‚Unberührbaren‘ (heute: Dalits) bekanntzumachen. Sie hatte Anfang der 1940er Jahre eine durchschnittliche Auflage von 10.000 Exemplaren pro Ausgabe. Die Zeitschrift, in der Gandhi die meisten Beiträge verfasste, wurde von Mahadev Desai, Gandhis Sekretär, herausgegeben. Sie umfasste neben vielfältigen sozialreformerischen Aufsätzen unter anderem Beiträge zu internationalen Angelegenheiten.24 Die Wochenzeitschrift Congress Socialist war das offizielle Parteiorgan der CSP und wurde ab 1934 herausgegeben. Sie hatte eine Auflage von 2.000 Stück pro Ausgabe.25 Die Calcutta Review, ursprünglich von Sir John Kaye 1844 gegründet, wurde ab 1921 von der Universität von Kalkutta als Monatszeitschrift herausgegeben und stellte eine wichtige Stimme im nationalistischen Diskurs dar.26
Trotz der größtenteils vorhandenen Auflagezahlen ist die Beurteilung der Rezeption und Wirkungskraft dieser Zeitungen schwierig. Die ermittelten Auflagenhöhen deuten auf eine teils bescheidene, teils breitere Zirkulation. Auskunft über die genaue Anzahl der Leser geben sie allerdings nicht, da eine Zeitung auch von mehreren Personen gelesen werden konnte. Trotzdem ist die Existenz der hier untersuchten Wahrnehmungen vor dem Hintergrund der vielfältigen Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus in nationalistischen indischen Kreisen von Bedeutung, da Debatten über die genutzten Medien weiter verbreitet und widersprüchliche und teilweise konträre Zukunftskonzepte reflektiert wurden.
Neben den systematisch untersuchten Medien berücksichtigt das vorliegende Buch auch vereinzelt Beiträge aus indischen Zeitungen und Zeitschriften, die für die 1920er und 1930er Jahre nicht in Gänze ausgewertet wurden. Sie wurden einerseits hinzugezogen, da sie Aufsätze von verschiedenen, hier relevanten Akteuren beinhalten (Indian Journal of Economics, Journal of the Bengal National Chamber of Commerce, Prabuddha Bharata, The Insurance and Finance Review, Bangiya Jarman Vidya Samsad, The Hindustan Review und Young India). Andererseits fand ein Korpus von Zeitungsartikeln Eingang in die Untersuchung, der von der italienischen Botschaft in Indien in der Zwischenkriegszeit zusammengetragen wurde. Der Korpus beinhaltet vor allem Beiträge aus einer Reihe englischsprachiger nationalistischer Zeitungen (Bombay Sentinel, The Leader, The Tribune, Sind Observer, The Hindustan Times), vereinzelt auch aus indischen Medien in englischem und jüdischem Besitz (The Jewish Advocate und The Jewish Tribune) sowie aus regionalsprachigen Zeitungen.27 Schließlich wurden ebenfalls eine Reihe europäischer Zeitschriften herangezogen, die Beiträge indischer Personen enthielten oder für die Fragestellungen in diesem Buch relevant waren (Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums – Deutsche Akademie, ab 1938: Deutsche Kultur im Leben der Völker – Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums – Deutsche Akademie, Young Asia und Asiatica).
In den systematisch ausgewerteten indischen Zeitungen und Zeitschriften fiel insbesondere die quantitativ hohe Anzahl an veröffentlichten Beiträgen zum Thema Faschismus und Nationalsozialismus auf. Beitragsarten umfassten einerseits Meldungen von Presseagenturen wie Reuters, Associated Press India (API) oder Free Press of India sowie den Abdruck von schon anderweitig publizierten Artikeln, andererseits Leitartikel, Leserbriefe, Karikaturen, Nachrichten sowie Berichte der im Ausland stationierten Korrespondenten.28 Auf eine Auswertung von Direkt-Meldungen der Presseagenturen, insbesondere von Reuters und API, die enge Verbindungen zur Regierung Britisch-Indiens unterhielten, wird verzichtet. Ein Einfluss der Presseagenturen auf die Wahrnehmungen und Diskussionen in den analysierten Beiträgen muss aber dennoch festgehalten werden, da ihre Meldungen nicht nur als Informationsquelle für die indischen Autoren dienten, sondern auch meinungsbildend wirkten. Kenntnisse über das Wesen von Faschismus und Nationalsozialismus sowie über die Ereignisse in Europa erhielten die sich an den Debatten beteiligenden Inder nicht nur über Zeitungen, sondern ebenfalls durch entsprechende Bücher29 sowie durch Erfahrungsberichte indischer Landsleute oder aufgrund eigener Reisen. In den Zeitungen berichteten regelmäßig indische Korrespondenten aus dem Ausland; so hatte die Amrita Bazar Patrika in den 1930er Jahren beispielsweise einen Berlin Letter, einen Rome Letter, aber auch einen Geneva Letter usw.30
Die Thematisierung indischer Auseinandersetzungen mit Faschismus und Nationalsozialismus verlangt nach einer Methodik, die Nationalismen und Internationalismen kontextualisieren kann, ohne in den Grenzen des Nationalstaates verhaftet zu sein. In den letzten Jahrzehnten ließ sich eine verstärkte Internationalisierung der Geschichtsschreibung beobachten, in der seit den 1990er Jahren transnationale Perspektiven und globale Beziehungen immer mehr in den Vordergrund treten.31 Transnationale Geschichte, wie sie bspw. Jürgen Osterhammel versteht, ist die Geschichte der Bewegungen von Menschen, Gütern, Wissen, die die Grenzen politisch oder ethnisch definierter ‚Kollektive‘ (zumeist Nationalstaaten oder Imperien seit dem 19. Jahrhundert) überschreiten.32 Kiran Klaus Patel fasst zusammen, dass transnationale Studien die verschiedenen Formen der Interaktion, Verbindung, Zirkulation, Überschneidung und Verknüpfung erforschen, die über die Grenzen des Nationalstaates hinausreichen. Dennoch spielt für Patel die Nation weiterhin eine wichtige, sogar definierende Rolle für die transnationale Geschichtsschreibung.33 Micol Seigel hingegen betont, dass transnationale Geschichte Einheiten untersucht, die sowohl größer, also auch kleiner als ein Nationalstaat sein können. Die Nation kann ihrer Ansicht nach nicht Referenzrahmen in transnationalen Studien sein, sondern ist nur eines von zahlreichen sozialen Phänomenen, die untersucht werden können.34 Phillip Gassert plädiert ebenfalls für eine weiter gefasste Definition von transnationaler Geschichte, die im Sinne von Wolfram Kaiser Beziehungen „über Grenzen hinweg in allen ihren Dimensionen“35 umfasst. Insbesondere im Hinblick auf die Thematik dieses Buches ist Gasserts Anmerkung wichtig, dass auf diesem Weg auch Austauschprozesse mit nicht-europäischen Regionen berücksichtigt werden können, die erst im Zuge der Dekolonisierung Nationalstaaten gebildet bzw. sich nicht als solche konstituiert haben.36 Transnationale Geschichte, wie sie in Anlehnung an Seigel zu verstehen ist, fördert Untersuchungen zu Personen und Akteuren, die nicht zur Elite gehören, und nimmt auch deren Handlungsfähigkeit (agency) verstärkt in den Blick.37
Transnationale Geschichte bedient sich verschiedener methodischer Ansätze, unter anderem aus der Komparatistik, der Kulturgeschichte und Kulturanthropologie und aus der Transferforschung.38 Von den genannten Methoden erscheint vor allem der Transferansatz im ersten Moment als Bezugsrahmen vielversprechend. Die Untersuchungsgegenstände von Transferforschungen sind dabei vielfältig und umfassen Ideen, Güter, Personen und Institutionen aller Art. Transfers werden in der Forschung oftmals als hochkomplexe Interaktionen verstanden. Im Zuge des Transfers von einer Einheit (Gesellschaft, Nationalstaat usw.) zu einer anderen bleiben die jeweiligen Elemente keineswegs unverändert; sie werden also nicht als ‚fremde Bausteine‘ in der ‚empfangenden‘ Einheit übernommen.39 Darüber hinaus finden Transfers in bi- oder multidirektionalen Prozessen statt, wobei sie auf den Ausgangspunkt zurückwirken können.40 Margrit Pernau hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Transfer gelingen, aber auch durch Ignorieren, Widerstand oder Verbot scheitern kann.41 Sie schreibt, dass ein Transfer gelungen ist, wenn eine Rezeption in der Zielkultur stattfindet und umschreibt die verschiedenen Formen der Rezeption. So kann
das Fremde [..] abgesondert werden und als Fremdes gekennzeichnet bleiben; es kann angeeignet werden, hier ist es zwar noch als fremd markiert, hat jedoch schon einen Transformationsprozess durchlaufen; es kann weiterhin durch Akkulturation in einer Weise und in einem Ausmaß in den neuen Kontext integriert werden, dass sein fremder Ursprung vergessen wird. 42
Im vorliegenden Buch stehen indische Auseinandersetzungen mit Faschismus und Nationalsozialismus im Mittelpunkt der Betrachtung. Die indischen Auseinandersetzungen produzierten eine Reihe sehr verschiedener Antworten, allerdings bewegten diese sich größtenteils auf theoretischer Ebene und erfuhren aufgrund der kolonialen Situation Britisch-Indiens keine einflussreiche praktische Umsetzung. Aufrufe und Verweise, bestimmte Aspekte von Faschismus und Nationalsozialismus in Indien zu übernehmen, theoretische Diskussionen über beide Phänomene sowie Kritik und Ablehnung (einer Aneignung) kennzeichneten die indische Beschäftigung. Transfers beinhalten auch Perzeptionen, die eine bestimmte Art von Transfer darstellen. Zur Untersuchung eines Transfers, der nur bedingt akkulturiert wurde, in diesem Fall der Transfer faschistischer Ideologie und politischer Maßnahmen, wird hier methodisch das Instrumentariums der Perzeptionsanalyse verwandt.
Mit Hilfe der Perzeptionsanalyse können anhaltende Debatten in einer Gesellschaft über Phänomene und Ereignisse in einer anderen Gesellschaft sichtbar und verfolgbar gemacht werden.43 Dabei bildet die ‚Perzeption‘ dieser Phänomene, die Wahrnehmung und Deutung von Entwicklungen in einem anderen staatlichen bzw. sozio-kulturellen Kontext, die Voraussetzung für die Rezeption, für ein potentielles Aufgreifen von für sinnvoll erachteten Modellen und dementsprechend für deren Aneignung.44 Die Perzeptionsanalyse eignet sich als Methode in diesem Buch allerdings auch in einem weiteren Sinne. Die indische Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus führte neben sympathisierenden auch zu ablehnenden bzw. kritischen Reaktionen, die eine Übernahme faschistischer Ideen und Praktiken für Indien ausschlossen. Aufgrund dieser Annahme ist die Untersuchung der Wahrnehmungen und Deutungen von entscheidender Bedeutung. Für die Perzeptionsanalyse, wie sie hier durchgeführt werden soll, ist es zudem wichtig, nach Kontinuitäten und Brüchen in der indischen Wahrnehmung von Faschismus und Nationalsozialismus zu fragen und diese in den Kontext sich verändernder politischer Konstellationen zu stellen. Darüber hinaus findet die Analyse physischer Interaktionen hier Anwendung. Die untersuchten indischen Akteure waren in ihrer Auseinandersetzung mit Italien und Deutschland nicht einfach Beobachter. Durch ihre Reisen und Aufenthalte in beiden Ländern waren einige von ihnen direkt in wechselseitige Wissenstransferprozesse involviert.
Innerhalb dieses Feldes der Geschichte transnationaler Austauschbeziehungen konzentriert sich das vorliegende Buch auf das Wissen über ein zentrales politisches Phänomen zweier europäischer Nationalstaaten, das sich in den Debatten indischer Kommentatoren formiert. Da diese sich zum Teil selbst in Deutschland und Italien aufgehalten haben, geht es auch um Reisende, die über die ‚fremde‘ Gesellschaft ‚zu Hause‘ Bericht erstatten – nun nicht mehr Europäer in Asien, sondern umgekehrt. Es ist dabei ein zentrales Interesse für die eigene „nation in the making“ zu erfahren, wie andere Nationen sich formieren, was dabei abstößt und auch was attraktiv erscheint.