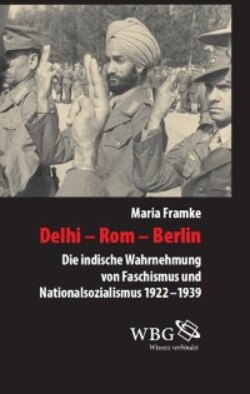Читать книгу Delhi - Rom - Berlin - Maria Framke - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Kulturaustausch oder Propaganda? Die Deutsche Akademie und ihre indischen Stipendiaten im nationalsozialistischen Deutschland
ОглавлениеIndische Studierende hatte es vereinzelt schon vor 1914 an deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen gegeben. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann ihre Zahl stetig anzuwachsen. Das hatte verschiedene Ursachen. So führte die Kampagne der Non-Cooperation, die Mahatma Gandhi Anfang der 1920er Jahre gegen die britischen Kolonialherren initiierte, zu einer Abkehr vom bisher bevorzugten Studienland, Großbritannien. Gleichzeitig stieg mit einsetzender Industrialisierung die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften. Da Deutschland zu den fortschrittlichen Ländern in den Bereichen Technik und Industrie gehörte und international eine gute Reputation als Wissenschaftsstandort hatte, entschieden sich immer mehr Inder und auch Inderinnen, hier zu studieren.66
Trotz der steigenden Studentenzahlen gab es in den 1920er Jahren zunächst kaum systematische Bemühungen, den wissenschaftlichen und akademischen Austausch zwischen Deutschland und Indien zu fördern. Dies änderte sich 1927/28, als die 1925 gegründete Deutsche Akademie67 in München aufgrund der Initiative von Taraknath Das und Karl Haushofer68 beschloss, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern voranzutreiben. Der Sekretär der Deutschen Akademie Franz Thierfelder69 wurde mit dem Aufbau eines India Institute (Indischer Ausschuß) beauftragt, der 1929 offiziell seine Arbeit aufnahm.70 Die Ende der 1920er Jahre initiierten Austauschbeziehungen stellten allerdings nicht die erste Kooperation zwischen indischen Nationalisten und Deutschland dar. Während des Ersten Weltkrieges hatte das deutsche Kaiserreich indische Revolutionäre, die sehr unterschiedliche politische und ideologische Hintergründe hatten, in ihren Bemühungen unterstützt, die britische Kolonialherrschaft unter Einsatz von Waffengewalt zu beenden und für Indien die Unabhängigkeit zu erlangen.71 Die dabei zwischen dem deutschen Außenministerium und den indischen Nationalisten geknüpften Netzwerke und die etablierten Infrastrukturen bestanden in der Weimarer Republik und im nationalsozialistischen Deutschland teilweise weiter.72 Auch Taraknath Das, der sich für die Errichtung des India Institute einsetzte, hatte während des Ersten Weltkrieges mit den deutschen Behörden als Mitglied des India Independence Committee zusammengearbeitet. Dafür war er 1917 in den USA im Rahmen des Hindu German Conspiracy Case zu einer Haftstrafe von 22 Monaten verurteilt worden. Nach seiner Freilassung distanzierte er sich von jeder Form des bewaffneten Kampfes.73
Das 1929 gegründete India Institute verfolgte nach eigenen Angaben explizit keine politischen Ziele. Im Vordergrund stand der deutsch-indische Kultur- und Bildungsaustausch und somit ein wechselseitiger Wissenstransfer, in dessen Rahmen Stipendien an indische Studenten für ein Studium an deutschen Universitäten vergeben, genaue Informationen über Universitäten und Technische Hochschulen in Deutschland bereitgestellt sowie Hilfestellung beim Finden von Praktika in deutschen Betrieben, Krankenhäusern und Laboratorien gewährt wurden. Darüber hinaus bemühte sich das India Institute, Studien zu Indien an deutschen Universitäten durch die Einladung indischer Gelehrter zu fördern und die „deutsche Kultur auf dem Subkontinent durch Kooperationen mit indischen Universitäten und Kultureinrichtungen zu verbreiten“.74 Von der Zusammenarbeit erhoffte man sich einerseits die Schaffung von Gastprofessuren für deutsche Wissenschaftler in Indien, andererseits ein erhöhtes Interesse am Erlernen der deutschen Sprache.75 Damit etablierten sich von deutscher Seite früher als vonseiten Italiens Austauschbeziehungen mit Indien.
Während Informationen über das IsMEO hauptsächlich über persönliche Kontakte nach Indien gelangten, veröffentlichte die Deutsche Akademie außerdem regelmäßig Mitteilungen in der Calcutta Review. Diese Beiträge, die darauf abzielten, die eigene Arbeit und die Zielsetzungen weiter bekanntzumachen, wiesen unter anderem auf die Stipendienausschreibungen hin oder stellten die ausgewählten Stipendiaten näher vor.76 Auch Taraknath Das bemühte sich die indische Öffentlichkeit, ähnlich wie im italienischen Fall, über die Initiativen des India Institute, in dem er lebenslanges Ehrenmitglied und Mitglied des Vorstandes war, zu informieren.77 Das, dessen Interesse und Aktivitäten hinsichtlich kultureller und Bildungskooperationen sich auch auf andere Länder richteten,78 räumte Deutschland und dessen Bewohnern, die er als „[…] the best educated and most civilised and highly cultured people of the world“79 betrachtete, trotzdem einen besonderen Platz ein. In verschiedenen Aufsätzen schlug er die „Verbreitung der deutschen Kultur“ in Indien vor.80
Die ‚Machtübergabe‘ 1933 beeinflusste die Arbeit des India Institute der Deutschen Akademie ebenso wie dessen Wahrnehmung in Indien. Im Folgenden wird zuerst die indische Auseinandersetzung mit dem Wirken der Akademie, vor allem anhand der Beiträge ihrer Unterstützer und der Geförderten untersucht. Im Anschluss werden Aktivitäten der Akademie auf dem südasiatischen Subkontinent vorgestellt und abschließend die Frage nach ihrer ideologischen Ausrichtung bzw. ihrer Nähe zum Hitlerregime beantwortet. Die Förderungszahlen der indischen Stipendiaten zeigen für die Jahre von 1933–1939 eine wechselhafte Entwicklung. Während die Zahl der indischen Stipendiaten der Deutschen Akademie in den letzten Jahren der Weimarer Republik stetig angestiegen war, verzeichnete das Jahr 1933/34 zunächst einen Rückgang, auf den aber 1934/35 wieder ein großer Anstieg folgte. In den Jahren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges schwankten die Zahlen, aber die Unterstützung Studierender durch Stipendien blieb bestehen.81 Damit lag die Förderungsrate der Akademie wesentlich höher als die des IsMEO, was einerseits mit ihrer finanziellen Ausstattung, andererseits an ihrem bis 1938 bestehenden Status als Nicht-Regierungsinstitution im Zusammenhang gestanden haben könnte.82
Das weiterhin bestehende indische Interesse an den Unterstützungsleistungen für ein Studium in Deutschland ist vor dem Hintergrund der Diskussionen über die Lebens- und Studienqualität indischer Studenten in Deutschland ab 1933 nicht selbstverständlich. Beiträge in der indischen englischsprachigen Presse informierten über Beleidigungen und rassistische Übergriffe auf Inder, aber auch über abwertende Berichte zu Indien in deutschen Medien.83 Besondere Aufmerksamkeit erregte der Fall des in Berlin lebenden Journalisten A. C. N. Nambiar.84 Nambiar, der in den 1920er und frühen 1930er Jahren enge Verbindungen zu kommunistischen und antikolonialen Bewegungen pflegte und politisch sehr aktiv war, wurde am 28.02.1933 ebenso wie J. Naidu, der Sohn der bekannten Kongresspolitikerin und Dichterin Sarojini Naidu, von der SA festgenommen. Er berichtete im Nachhinein über seine Erlebnisse in verschiedenen indischen Zeitungen und beschrieb dort, wie die SA seine Wohnung stürmte, ohne einen Haftbefehl vorzuzeigen alles durchsuchte und unter anderem seine Arbeitspapiere, private Korrespondenz und die Schreibmaschine mitnahm. Nach einem ersten Verhör, der Durchsuchung seiner Person, etlichen Beleidigungen und körperlichen Misshandlungen sei er zu einer Polizeistation gebracht worden und bis zum 25.03.1933 inhaftiert geblieben, während Naidu schnell wieder freigelassen worden war. Weiterhin berichtete Nambiar, dass ihm nach seiner Entlassung mitgeteilt wurde, dass er innerhalb von acht Tagen Preußen zu verlassen habe. Seinen Aussagen zufolge gab es keinerlei Begründung für den Überfall auf seine Wohnung; auch sei keinerlei offizielle Anklage gegen ihn erhoben worden. Die beschlagnahmten Gegenstände und Unterlagen habe er nicht zurückerhalten. Nambiar, der nach eigenen Aussagen, keinen Groll gegen Deutschland oder die Deutschen hegte, nutzte seinen Bericht aber, um explizit auf die keineswegs freundliche Gesinnung der nationalsozialistischen Führung gegenüber Indien hinzuweisen.85 Während augenscheinlich kein Mitglied der indischen Gemeinde Berlins zu seinen Gunsten bei den deutschen Behörden vorstellig wurde, erwirkte die Intervention des Britischen Konsulats in Berlin Nambiars Freilassung, und er verließ Deutschland in Richtung Prag.86
Die indischen Reaktionen auf solche Berichte, aber auch auf die Artikel über rassistische Äußerungen waren ambivalent. Einerseits bewirkten sie Aufrufe, die von einem Studium in Deutschland abrieten87 oder über Protestmaßnahmen von indischer Seite berichteten. Neben kritischen Beiträgen fanden sich andererseits in der indischen Presse aber auch Artikel, die von unveränderten Studienbedingungen sprachen oder ausführten, dass indische Studenten auch unter der nationalsozialistischen Regierung willkommen seien.88 Letztere Beiträge zur Diskussion kamen dabei vor allem von Personen, die der Deutschen Akademie nahestanden, so z.B. Dr. Subodh K. Majumdar, Dozent für Chemie am Ripon College in Kalkutta, der an der Universität München studiert hatte,89 sowie Taraknath Das und Franz Thierfelder. Thierfelder, der relativ frühzeitig auf die Frage reagierte, ob indische Studenten in Deutschland nicht mehr sicher seien, beteuerte im Juni 1933 im Namen der Deutschen Akademie „[…] that the safety of the Indian students pursuing their scientific work and refraining from interfering with politics is guaranteed at present and in future“.90
Ganz ähnlich argumentierte auch Taraknath Das. Unter Hinweis auf seine langjährigen Bemühungen, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien zu fördern, schrieb er in einem Beitrag in der Modern Review, dass sich indische Studenten und Besucher nicht in die interne oder internationale Politik des Gastlandes einmischen sollten.91 Während er auf die in den zurückliegenden Monaten gemachten positiven Erfahrungen in Deutschland – eigene und die indischer Studenten – hinwies, verharmloste er die Erlebnisse Nambiars als Ausnahmefall, der im Zuge einer Revolution vorkommen könne.92 Dessen politische Betätigung, vor allem seine kommunistischen Tendenzen, wurden von denjenigen, die eine Beibehaltung der indisch-deutschen Austauschbeziehungen unter den Nationalsozialisten befürworteten, als entscheidender Grund für seine schlechte Behandlung gesehen. Taraknath Das revidierte allerdings seine Einschätzung Deutschlands einige Monate später in einem privaten Brief, in welchem er schrieb, dass er wegen der rassischen und politischen Verfolgung in Deutschland untröstlich sei.93 Das, der nach einigen Monaten in der Schweiz und Italien im April 1934 in die USA zurückkehrte, war trotz seines persönlichen Unbehagens nicht bereit, die Arbeit bzw. Propaganda für eine deutsch-indische kulturelle Zusammenarbeit vollständig einzustellen.94
Dies zeigte sich im Zusammenhang mit erneuten negativen Schlagzeilen über die Deutsche Akademie im Sommer 1934. M. S. Khanna, ehemaliger Stipendiat des India Institute an der Technischen Hochschule in Stuttgart, berichtete in zwei Beiträgen im Bombay Chronicle äußerst kritisch über die Situation indischer Studenten in Deutschland. Khanna, der Präsident der Federation of Indian Students abroad in Wien sowie Präsident der Hindustan Students’ Association in München gewesen war, wies in seinen Ausführungen auf Beiträge in der deutschen Presse hin, die abwertende oder falsche Informationen über Indien verbreiteten und merkte das Fehlen adäquater indischer Gegenmaßnahmen an.95 Darüber hinaus äußerte er sich sehr negativ über die Arbeit der Deutschen Akademie, die er als Propaganda- und Kontrollinstitution gegenüber ausländischen Studierenden darstellte.96 Auf die Vorwürfe reagierend, veröffentlichte Taraknath Das im September 1934 einen ausführlichen Leserbrief im Bombay Chronicle, in welchem er den Bericht Khannas zurückwies. Das entwarf in seinem Brief ein positives Bild von der Arbeit der Akademie und führte aus, dass diese seiner Ansicht nach vor allem an der Etablierung kultureller Kooperationen zwischen Deutschland und anderen Staaten interessiert sei. Wichtig schien ihm der Hinweis, dass die Einrichtung keinerlei Interesse an innen- und außenpolitischen Vorgängen habe und sich nicht an politischer Propaganda beteilige.97 Das, der seine Vision von einer internationaler kulturellen Zusammenarbeit auch im Falle des nationalsozialistischen Deutschland nicht aufgeben wollte, führte aus:
[…] I earnestly request the Indian public to strengthen the work of cultural co-operation with all nations which are ruled by dictators – Russia, Italy, Germany, etc. – also those which have democratic institutions – Great Britain, France, the United States, Czechoslovakia, etc. All activities involving cultural co-operation should be conducted soberly; and one must not be too hasty to alienate cultural co-operation of a great nation like Germany.98
Nur auf diesem Weg, so glaubte der indische Nationalist, könne sein Heimatland langfristig von der britischen Kolonialherrschaft befreit werden. Er schien sich dabei der Sensibilität seiner Forderung nach einer Zusammenarbeit mit Hitlerdeutschland durchaus bewusst zu sein und erklärte wohl aus diesem Grund explizit, dass er weder ein Sympathisant der Nationalsozialisten noch ein Anhänger von Diktaturen sei und dass er jegliche Form von rassischer, religiöser und politischer Verfolgung ablehne. Als Erklärung für die gegen Inder gerichteten Vorkommnisse und die abwertende Berichterstattung in deutschen Medien nannte er die problematischen innerdeutschen Veränderungen seit der ‚Machtübergabe‘. Dennoch empfahl er indischen Studenten weiterhin ein Studium in Deutschland, allerdings nur unter der Prämisse, dass sie sich von jeglicher Einmischung in die internen Angelegenheiten ihres Gastlandes fernhalten.99
Die Berichterstattung in der indischen Presse über die Arbeit der Deutschen Akademie hielt in den folgenden Jahren an.100 So veröffentlichte der Bombay Chronicle beispielsweise 1935 einen Beitrag, der über die Ernennung des indischen Astro-Physikers Meghnad Saha zum lebenslangen Ehrenmitglied des India Institute101 sowie über eine durch die Akademie organisierte Vorlesungsreihe des Ökonomen Sudhir Sen informierte.102 Gleichzeitig hielten sich die Vorwürfe, dass durch das India Institute Propaganda für das nationalsozialistische Regime nicht nur unter indischen Studenten in Deutschland, sondern auch in Indien gemacht würde. So berichtete ein Beitrag im Bombay Chronicle im März 1939, dass die Akademie sechs- und zwölfmonatige Stipendien für Inder an deutschen Universitäten anbiete für ausgezeichnete Aufsätze zu dem Thema „Die arischen Ursprünge der Swastika und ihr gemeinsamer Gebrauch in Indien und Deutschland“.103 Die Einschätzung, dass es sich bei der Deutschen Akademie um eine nationalsozialistische Propagandainstitution handelt, wurde von den britischen Kolonialbehörden geteilt. Dazu muss angemerkt werden, dass die britischen Berichte des Judicial and Public Department aus den Jahren 1939 bis 1942 stammen und damit in die Zeit des Zweiten Weltkrieges mit Deutschland als feindliche Macht fallen. Die Berichte machen deutlich, dass die britische Verwaltung auf dem Subkontinent die Aktivitäten der Deutschen Akademie beobachtete.104 Dabei galt die Einrichtung explizit als Instrument der Hitlerregierung zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Indern und Deutschen und zur „[…] Verbreitung der nationalsozialistischen deutschen Kultur auf dem Subkontinent basierend auf einer Kenntnis der deutschen Sprache“.105 Die Berichte nannten als Hauptwirkungsorte Kalkutta und Benares und erwähnten die für die Akademie in Indien tätigen Deutschen Horst Pohle und Alfred Würfel. Während Ersterer an der Universität von Kalkutta als Dozent für die deutsche Sprache angestellt war, arbeitete Würfel ab 1935 an der Universität in Benares als Lektor und studierte dort auch Sanskrit. Beide Dozenten waren nach Aussagen der Deutschen Akademie nach Indien gesandt worden, um deren Ziele des Kulturaustausches voranzutreiben. Die britische Verwaltung hingegen schätzte ihre Tätigkeiten ganz anders ein und beschrieb sie als nationalsozialistische Propagandisten.106 Dass diese Vermutung im Allgemeinen durchaus eine Berechtigung hatte, zeigt das Beispiel Heinz Nitzschkes, der als Lektor der Deutschen Akademie vor Pohle an der Universität von Kalkutta gewirkt hatte.107
Nitzschke, der im November 1933 nach Indien kam, veröffentlichte einen zweiteiligen Beitrag in der Amrita Bazar Patrika, in welchem er zuerst die Geschichte der deutschen Jugendbewegung vorstellte, um dann allgemeiner auf die gesellschaftlichen Veränderungen nach der ‚Machtübergabe‘ einzugehen.108 Seine Ausführungen hoben die Legitimität und Wichtigkeit der Umsetzung nationalsozialistischer Ideale hervor, die er folgendermaßen zusammenfasste:
The individual has to sacrifice himself in service for this country. Obedience to a strong, socially minded authority, hard work, strict family discipline, chastity, self-denial, thrift, sobriety, leadership: these are the fundamental principles of new morals. 109
Die Bildung müsse der deutschen Jugend Schlichtheit, Loyalität und Stolz auf „ihre deutsche Rasse“ vermitteln. Diesen Idealen entsprechend konzentriere man sich in Deutschland verstärkt auf die „Charakter“- und „Rassenbildung“ sowie auf physical education.110 Abschließend wies er darauf hin, dass die gegenwärtigen Veränderungen in Deutschland nicht nur institutioneller Natur, sondern Ausdruck einer neuen Geisteshaltung seien. Diese neue ‚Gesinnung‘ sei es, die der „deutschen Revolution“ ihre weitreichende Bedeutung gebe und die das deutsche Beispiel auch für andere Nationen interessant mache.111
Nitzschkes Ausführungen stellen ein überzeugendes Beispiel für deutsche Propaganda in Indien in der Zwischenkriegszeit dar und dementsprechend verwundert es wenig, dass die Deutsche Akademie von einigen indischen Autoren und von britischer Seite als nationalsozialistische Propagandainstitution begriffen wurde.112 Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, inwieweit solche Einschätzungen zur ideologischen Ausrichtung der Deutschen Akademie und des India Institute von der Forschung bestätigt werden. Der Historiker Eckard Michels führt zum Beispiel aus, dass, obgleich die Deutsche Akademie offiziell parteipolitisch neutral gewesen sei, sie sich schon vor 1933 als eine politisch eher rechts stehende Organisation gezeigt habe, die die ‚Machtübergabe‘ an die Nationalsozialisten dann freudig begrüßt und unaufgefordert rassisch und politisch unerwünschte Führungsmitglieder entfernt habe.113 Auch Steffen Kathe weist auf die Annäherungsversuche der Deutschen Akademie ab 1933 hin und urteilt, dass sich die Leitung der Institution dem NS-Regime ‚angebiedert‘ habe, indem sie die eigene kulturpolitische Arbeit nach den nationalsozialistischen Vorstellungen ausrichtete.114 Ähnlich bewertet Edgar Harvolk die Aktivitäten der Münchner Institution und weist dabei auf die Veränderungen ihrer Ausrichtung hin, die sich von einem „mitmachen, um zu überleben“ unter Präsident Friedrich von Müller (bis 1934) zu einer Partei- und Regierungshörigkeit zur Amtszeit Leopold Kölbls (1937–1939) wandelte.115
Während die Forschung damit ein größtenteils konsistentes Bild von der Ausrichtung der Deutschen Akademie zeichnet, führt die Bewertung der Einstellung einzelner Mitglieder zu kontroverseren Ergebnissen. Bedingt werden diese unter anderem durch die schwierige Klärung der Frage, ob Propagandatätigkeiten von Vertretern der Deutschen Akademie auf Grundlage ihrer Überzeugung oder aus Opportunismus stattgefunden haben.116 Ein Blick auf manche Mitglieder der Deutschen Akademie, zu nennen sind hier die Indologen Walther Wüst und Jakob W. Hauer, lässt zwar kaum Zweifel an deren Nähe zum nationalsozialistischen Regime zu.117 Es gibt aber auch andere Fälle, die in der Forschung umstritten sind, wie das Beispiel Franz Thierfelder zeigt. Michels bspw. schreibt, dass dieser nie ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei, allerdings auch kein Gegner des Regimes.118 Steffen Kathe ist hingegen der Ansicht, dass Thierfelder zu einem Handlanger des Nationalsozialismus wurde, indem er aktiv an der Einsetzung des linientreuen Präsidenten der Akademie Karl Haushofer 1934 mitwirkte. Auch habe er verschiedentlich seine Loyalität zum neuen System ausgedrückt, z.B. 1933 als er die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten als notwendiges Mittel zur Befreiung der deutschen Literatur von „un-deutschen“ Werken verteidigte. Die Tatsache, dass Thierfelder niemals in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) eintrat, fällt für Kathe in seiner Bewertung kaum ins Gewicht.119 Völlig gegenteilig wertet Lothar Günther, der Thierfelder als einen Gegner der Nationalsozialisten beschreibt.120 Dieses letzte Urteil kann vor dem Hintergrund des zumindest als opportunistisch zu bezeichnenden Verhaltens Thierfelders nicht aufrechterhalten werden.
Die Bewertungen der Deutschen Akademie und ihres Sekretärs Franz Thierfelder, der sich auch nach 1933 intensiv für den Kulturaustausch zwischen Deutschland und Indien einsetzte, lassen ebenfalls nach dem Wirken und der Ausrichtung des India Institute sowie nach der Haltung der Akademie gegenüber Indien fragen. Giuseppe Flora weist darauf hin, dass in der Akademie und auch im India Institute Personen tätig waren, die stark mit Indien sympathisierten. Diese hätten ihre pro-indischen Maßnahmen unter ungünstigsten Bedingungen ausgeführt, wenn man die Verachtung bedenkt, die unter Teilen der Nationalsozialisten für Indien vorherrschte.121 Günther stellt fest, dass der Indische Ausschuss durchaus Konzessionen an die Nationalsozialisten machen musste. So habe die Akademie nun einige dem Regime gegenüber aufgeschlossene Inder nach Deutschland eingeladen, wie zum Beispiel Professor B. S. Guha.122 Dieser hielt 1935 zwei Vorträge, in denen er über „Die rassische Zusammensetzung in Indien“ und „Die rassische Grundlage der Indo-Arier und die Rassenmischung in Indien“ referierte. Organisiert wurden die Veranstaltungen durch das India Institute in Zusammenarbeit mit der Anthropologischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene.123 Solche Aktivitäten wurden ab 1933, Günther zufolge, zu notwendigen Voraussetzungen für eine Weiterführung des initiierten Studenten- und Wissenschaftleraustausches. Sie scheinen somit in Günthers Interpretation kein Beleg für die neue inhaltliche Ausrichtung des India Institute am Nationalsozialismus zu sein.124
Günthers Einschätzung steht im Gegensatz zu den Urteilen der britisch-indischen Verwaltung und zu denen verschiedener indischer Autoren, die die Akademie und das Institut als willfährige nationalsozialistische Propagandawerkzeuge begriffen. Für die Nähe des India Institute zum Hitlerregime bzw. zumindest für dessen im Zeitverlauf immer stärker werdende Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten gibt es allerdings weitere Beispiele. So bot es im Oktober 1938 zusammen mit der SS-Einrichtung „Lehr- und Forschungsgemeinschaft ‚Das Ahnenerbe‘“ ein Preisausschreiben an indischen Universitäten zu dem Thema „Symbolzeichen in Indien – Bedeutung, Entwicklung und Leben“ an. Als Preis wurde ein einjähriger Studienaufenthalt in Deutschland ausgelobt.125 Die Zusammenarbeit des India Institute mit dem ‚Ahnenerbe‘,126 das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den nordischen Abstammungsmythos zu erforschen und die proklamierte Superiorität der ‚arischen‘ Rasse wissenschaftlich zu belegen, ist einerseits durch personelle Überschneidungen in der Person Walter Wüsts erklärbar. Andererseits ist die Kooperation aber auch ein Indiz für die (kaum zu verhindernde) Einbindung der Münchner Institution in das nationalsozialistische Regime. So scheint hier das Urteil berechtigt, dass das India Institute der Deutschen Akademie eine Indien wohlgesonnene Einrichtung war, die sich nach 1933 allerdings schnell und ohne große Widerstände den neuen Gegebenheiten anpasste und im Rahmen ihrer Tätigkeiten auch Propaganda für das Hitlerregime betrieb.
Anzufügen ist in diesem Zusammenhang, dass die Deutsche Akademie trotz der zeitgenössischen Diskussionen und der (immer wieder aufkommenden) Berichterstattung über die schlechte Behandlung von Indern in Deutschland ihre Arbeit mindestens bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fortsetzte und ihr Angebot von indischen Studenten weiterhin angenommen wurde. Die Weiterführung des deutsch-indischen Bildungsaustausches scheint dabei nicht nur aus ganz pragmatischen Gründen (den angebotenen Stipendien) erfolgt zu sein, sondern aufgrund der Befürwortung und Anerkennung durch indische Politiker und Professoren.127 1937 besuchte beispielsweise der bengalische Kongresspolitiker Bidhan Chandra Roy Deutschland und wurde in Berlin von der indischen Studentenverbindung durch einen Empfang geehrt. Auf diesem sprach er anerkennend über den Aufstieg Deutschlands und riet den indischen Studenten, vom deutschen Beispiel zu lernen und ihm nachzueifern. Inder sollten, Roy zufolge, alles Mögliche tun, um das Verständnis zwischen Indien und Deutschland zu stärken.128 Die Veröffentlichung dieser Ausführungen in der indischen Presse scheint die Wahrnehmung des nationalsozialistischen Deutschland als Studien- und Bildungsort positiv beeinflusst zu haben.