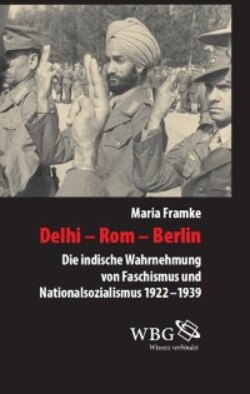Читать книгу Delhi - Rom - Berlin - Maria Framke - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Indische Faschisten? Zwei Fallbeispiele
ОглавлениеZwei indische Akteure – Subhas Chandra Bose und Benoy Kumar Sarkar –, die in den folgenden Kapiteln immer wieder eine Rolle spielen werden, sind wie oben erwähnt von der Forschung näher untersucht worden, wobei auch ihr Verhältnis zum Faschismus und zum Nationalsozialismus immer wieder thematisiert worden ist. In der Beurteilung Subhas Chandra Boses spielte dieser Aspekt schon für seine Zeitgenossen eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzung mit den beiden Fallbeispielen soll exemplarisch die Schwierigkeiten und Komplexität einer nachträglichen Beantwortung der Frage über die ideologische Ausrichtung indischer Nationalisten, die den Faschismus und den Nationalsozialismus bewunderten und als Vorbild empfanden, aufzeigen. Wie schon in der Einleitung dargelegt, verfolgt das vorliegende Buch keine abschließende Klärung dieser Frage, sondern untersucht, was in den ausgewählten Akteursgruppen als Faschismus und als Nationalsozialismus verstanden wurde, wie beide Phänomene wahrgenommen und diskutiert wurden und welche Aspekte als nachahmenswert galten und warum, wobei die Beantwortung letzterer Frage durchaus das Problem ideologischer und politischer Überzeugungen berührt.
Subhas Chandra Bose gilt in den meisten Monografien und Aufsätzen als ‚fehlgeleiteter‘ Nationalist, der durch seine Kollaboration mit den Achsenmächten zeigte, dass er für die Erlangung der indischen Unabhängigkeit bereit war, jede sich bietende Möglichkeit zu verfolgen.67 Bose, Politiker des INC, verbrachte in der Zwischenkriegszeit mehrere Jahre in Europa und studierte dort die politischen Institutionen und Philosophien. Dabei entwickelte er, Prayer zufolge, eine unabhängige, kreative Methode gegenüber den europäischen Ideologien. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und offiziellen Kreisen empfand Bose als ausschlaggebend für die Durchsetzung eines nicht-kolonialen Bildes von Indien; dementsprechend suchte er vielfältige Kontakte zu Geschäftsleuten und Intellektuellen, unter anderem in der Tschechoslowakei, in Österreich und Italien.68 Eine Aussage Boses, die immer wieder Zweifel an seinen ideologischen Vorstellungen aufkommen ließ und lässt, findet sich in seiner 1935 erstmals erschienenen Autobiografie „The Indian Struggle“. In ihr schrieb Bose: „Considering everything, one is inclined to hold that the next phase in world-history will produce a synthesis between Communism and Fascism. And will it be a surprise if that synthesis is produced in India?“69 Die Synthese der beiden Ideologien, Bose nannte sie Samyavada, kam seinem Erachten nach aufgrund der gemeinsamen Charakterzüge von Faschismus und Kommunismus zustande.70 Bose widerrief seine Aussagen 1938 in einem Interview mit dem britischen Kommunisten Rajani Palme Dutt und distanzierte sich in diesem vom Faschismus.71 Wie in den folgenden Kapiteln dargelegt wird, zeigte Bose bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein ambivalentes Verhältnis zum Faschismus und zum Nationalsozialismus. So lehnte er die deutschen Rassenvorstellungen ebenso wie die imperialistischen Ambitionen Italiens im Abessinienkrieg ab. Andererseits begeisterte er sich für die Idee eines autoritären Staates mit einem ‚starken Führer‘. Auch pflegte er, sowohl während seines Europaaufenthaltes als auch nach seiner Rückkehr nach Indien, Kontakte zu deutschen und italienischen Diplomaten und Beamten. Schon in den 1930er Jahren legte Bose ein überaus ‚pragmatisches‘ Verständnis zur Kooperation mit allen potenziellen anti-britischen Kräften an den Tag, die unter Umständen den indischen Unabhängigkeitskampf unterstützen könnten. Dieser Pragmatismus führte nach Kriegsausbruch zu seiner Zusammenarbeit mit den Achsenmächten als Gegner Großbritanniens.
Über Benoy Kumar Sarkar,72 den bengalischen Universalgelehrten und Professor an der Universität von Kalkutta, sind ebenfalls verschiedene Biografien und Aufsätze, die einzelne Aspekte seines Lebens untersuchen, erschienen.73 Mit seinen Beziehungen zum faschistischen Italien und zum nationalsozialistischen Deutschland haben sich dabei, wie kurz erwähnt, Giuseppe Flora und Mario Prayer, aber auch Swapan Bhattacharyya und Kris Manjapra ausführlicher beschäftigt.74 Während Bhattacharyya die starke Sympathie Sarkars mit Deutschland und dem Hitlerregime sowie mit dem faschistischen Italien konstatiert,75 sagt Prayer, dass Sarkars Annäherung an das zeitgenössische Italien eher kulturell als ideologisch oder politisch bedingt war. Auch die wirtschaftlichen und sozio-ökonomischen Entwicklungen des faschistischen Regimes hätten für den bengalischen Intellektuellen ein nachahmenswertes Modell dargestellt. Prayer führt aus, dass sich Sarkar durch die Analysen der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Geschichte des ‚Westens‘ bemühte, indischen ‚Staatsmännern‘ bei der Formulierung ihrer Politik für eine nationale Entwicklung sowie für einen effizienten zukünftigen Staat innerhalb eines gültigen theoretischen Rahmens zu helfen.76 Ähnlich wie Bhattacharyya deutet auch Flora auf Sarkars Glauben an die Vorbildwirkung des Faschismus und des Nationalsozialismus in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.77 Gleichzeitig aber weist er darauf hin, dass Sarkar bestimmte Merkmale faschistischer und nationalsozialistischer Theorien, wie den Antisemitismus oder Rassismus nie geteilt habe.78 Manjapra, der sich ausführlich mit Sarkars Beziehungen zu Deutschland und zum deutschen Rechtsradikalismus in der Zwischenkriegszeit beschäftigt hat, verneint einen entscheidenden Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Sarkars intellektuelle Vorstellungswelt, die durch den indischen Kontext geprägt worden sei.79
Wie die beiden hier näher vorgestellten Beispiele zeigen, sind nachträgliche Urteile über Personen, die sich intensiver mit Faschismus und mit Nationalsozialismus beschäftigt haben und dabei zu positiven Urteilen gekommen sind bzw. von solchen Akteuren, die Kontakte zu Vertretern beider Regime unterhielten, oft umstritten und verlangen nach einer genauen Kontextualisierung der lokalen politischen Kultur. In den folgenden Kapiteln wird die Frage nach der Nähe bzw. nach dem Verhältnis indischer Nationalisten zum Faschismus und zum Nationalsozialismus durch die Untersuchung, wie sie sich mit beiden Phänomenen auseinandergesetzt haben, welche Aspekte sie nachahmens- oder ablehnenswert fanden und welche Gründe es für ihre jeweiligen Reaktion gab, beantwortet.
1 Für Überblicksdarstellungen zu Faschismustheorien und zum Stand der Forschung siehe: Wippermann, Faschismustheorien; Bauerkämper, Faschismus, S. 18–46; Kershaw, Nazi; Larsen/Hagtvet/Myklebust (Hg.), Fascists.
2 Vgl. Payne, Fascism, S. 178; Bauerkämper, Faschismus, S. 18–27.
3 Vgl. Payne, Fascism, S. 191.
4 Vgl. Bauerkämper, Faschismus, S. 27.
5 Vgl. Nolte, Bewegungen.
6 Vgl. Griffin, Nature, S. 12ff.; Sternhell, Fascism, S. 280–290; Eatwell, Model, S. 161–194; Payne, History; Mosse, Introduction, S. 1–41; Laqueur, Fascism.
7 Griffin, Fascism, S. 1.
8 Vgl. Bauerkämper, Faschismus, S. 37.
9 Vgl. Griffin, Fascism, S. 2.
10 Payne, Fascism, S. 196.
11 Vgl. Nolte, Faschismus, S. 35–45; Bauerkämper, Faschismus; Payne, Geschichte.
12 Vgl. Bracher, Nationalsozialismus, S. 578 und 582ff.; Martin, Tauglichkeit, S. 48–73; Bauerkämper, Faschismus, S. 36f.
13 Payne, Fascism, S. 175.
14 Vgl. ebd. Als Vorbedingungen nennt Payne: „[…] (1) intense nationalist/imperialist competition among newer nations, formed mostly in the 1860s; (2) liberal democratic systems nominally in place in the same countries, but without deep functional roots on the one hand or a dominant elite or oligarchy on the other; (3) opportunity for mobilized nationalism on a mass basis as an independent force not restricted to elites or an institutionalized oligarchy, (4) a new cultural orientation stemming from the cultural and intellectual revolution of 1890–1914.“ (ebd.).
15 Vgl. Griffin, Nature, S. 146ff.; Eatwell, Model; Larsen, Fascism.
16 Vgl. Larsen, Fascism.
17 Larsen, Diffusion, S. 717.
18 Vgl. ebd.
19 Vgl. Kersten, Japan, S. 526f.
20 Vgl. Payne, History, S. 336.
21 Vgl. Kersten, Japan, S. 527.
22 Vgl. ebd.
23 Zachariah, Rethinking, S. 181f.
24 Vgl. ebd.
25 Vgl. Höpp/Wien/Wildangel (Hg.), Geschichte. Siehe dazu auch: Freitag/Gershoni (Hg.), Encounters, S. 310–450; Gershoni/Nordbruch, Sympathie.
26 Vgl. Nordbruch, Nazism. Eine ähnliche Herangehensweise verfolgt Peter Wien in seiner Arbeit, die nationalistische arabische Diskurse im Irak über Faschismus, Autoritarismus und Totalitarismus untersucht. Durch die Untersuchung der Perzeptionen und Debatten schlussfolgert Wien, dass keine Übernahme direkter faschistischer Gedanken, sondern eher Annäherungen an die faschistische Symbolik erfolgten (vgl. Wien, Nationalism).
27 Für die Frage, inwieweit bestimmte faschistisch anmutende Aspekte in Ländern des Mittleren Ostens, wie der Führerkult, Disziplin oder Jugendorganisationen als Teil eines weiter gefassten Zeitgeistes angesehen werden können, siehe: Wien, Terms, S. 319f.; Wien, Nationalism, S. 3 und 113–116.
28 Vgl. Zachariah, Rethinking, S. 190.
29 Vgl. Goswami, India, S. 7ff. und 165ff. Goswami bietet ebenfalls einen einführenden Überblick in die Historiografie zum Thema indischer Nationalismus (vgl. ebd., S. 288f.).
30 Vgl. Six, Hindi, S. 24.
31 Vgl. ebd., S. 33f.; Mann, Geschichte, S. 122, 126ff. und 136ff.
32 Vgl. Kishwar, Gandhi, S. 1691–1702; Amin, Gandhi, S. 288–348.
33 Das Gesetz führte ein spezielles konstitutionelles System namens Dyarchy ein. Das System umfasste eine Zentralregierung, die beinahe vollständig unter britischer Kontrolle stand, und Provinzregierungen, die den Provinz-Legislativen gegenüber verantwortlich waren. In den Regierungen auf Provinzebene gab es indische Minister, die bestimmte Ressorts leiten durften, allerdings solche mit wenig politischem Gewicht und geringen Geldmitteln (vgl. Metcalf/Metcalf, History, S. 166).
34 Vgl. Sarkar, India, S. 168–206. Auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkrieges, der Erlass des Rowlatt Act, der verschiedene Kriegsbestimmungen zur Einschränkung bürgerlicher Freiheiten permanent etablierte sowie die Khilafat Bewegung, die sich für die Beibehaltung des Kalifats einsetzte, wirkten auf die Non-Cooperation Kampagne ein.
35 Vgl. ebd.
36 Vgl. ebd., S. 226ff. In Chauri Chaura in den United Provinces verbrannten 22 Polizisten in ihrer Wache als verärgerte Bauern Feuer legten.
37 Vgl. ebd., S. 261ff.
38 Vgl. ebd., S. 237–252; Pandey, Construction, S. 233ff.
39 Vgl. Gordon, Hindu, S. 145–203; Jaffrelot, Hindu, S. 17ff.
40 Six führt aus, dass der Kolonialismus nicht nur den übergeordneten Rahmen der Entstehung des indischen Nationalismus bildete, sondern auch inhaltlich den wesentlichen Bezugspunkt (vgl. Six, Hindi, S. 34).
41 Vgl. Chatterjee, Thought, S. 48f. Chatterjee analysiert in seiner Studie die Ideengeschichte des postkolonialen indischen Staates, indem er drei dafür notwendige (diskursive) Phasen vorstellt: der „moment of departure“, der „moment of manoeuvre“ und der „moment of arrival“. Im „moment of departure“ werde das nationalistische Bewusstsein mit dem rationalen Gedankengut der Post-Aufklärungszeit konfrontiert, was zu der Annahme wesenhafter kultureller Differenzen zwischen dem „Westen“ und dem „Osten“ sowie der Rückständigkeit des Letzteren führe. Die Rückständigkeit des „Ostens“ könne allerdings durch die Übernahme der modernen Attribute der europäischen Kultur überwunden werden, wobei die negativen Auswirkungen der Moderne durch die spirituelle Überlegenheit des „Ostens“ vermieden werden könnten. Während der „moment of departure“ ein elitäres Programm sei, brauche der nächste Schritt, der „moment of manoeuvre“, die Mobilisierung der Massen für den antikolonialen Kampf und ziele gleichzeitig auf deren Distanzierung von den Strukturen des Staates ab. Der „moment of arrival“ stelle die letzte Phase dar, wenn der nationalistische Gedanke am vollsten entwickelt sei und als Ordnungsdiskurs im Sinne einer rationalen Organisation der Macht auftrete. Nun präsentiere sich der Diskurs als homogen und die vorherrschende ideologische Einheit hinsichtlich des nationalistischen Gedankens versuche sich als einheitliches Lebens des Staates zu verwirklichen (vgl. ebd., S. 50f.).
42 Vgl. Sarkar, India, S. 254f.
43 Vgl. Six, Hindi, S. 29f. und 34.
44 Vgl. ebd., S. 29ff.; Goswami, India, S. 1ff.; Chatterjee, Thought, S. 131. Die mit dem Nationenkonzept eng verbundene Frage nach dem Staats- und Entwicklungsmodell und die Debatten darüber werden im Kapitel 6.1.1 behandelt.
45 Six zufolge hatte die „allgemein humanistische Religion der Gewaltlosigkeit [..] für Gandhi […] primär integrativen Charakter und transzendierte die engen und letztendlich trennenden Grenzen der einzelnen Religionsgemeinschaften hin zu einem allgemeinen und übergreifenden Postulat einer menschengerechten Entwicklung (vgl. Six, Hindi, S. 32).
46 Vgl. Sarkar, History, S. 363.
47 Vgl. Mann, Geschichte, S. 126f. Einen Überblick über die Entwicklung hindunationalistischer, aber auch muslimischer Geschichtsschreibung und deren Auseinandersetzung mit den Themen Nation und nationale Einheit gibt: Mann, Geschichte, S. 71ff. Nationalistische Diskurse, die auf einer Hindu-Identität basierten und Muslime als entweder Ausnahmen einer ansonsten organischen Einheit oder als ‚Fremdkörper‘ innerhalb der Nation beschrieben, existierten schon in den 1870er/1880er Jahren (vgl. Goswami, India, S. 10 und 207). Siehe zu Savarkars Vorstellungen einer Hindu-Nation die Kapitel 5.1.2 und 7.2.2.
48 Vgl. Zachariah, Rethinking, S. 178f.
49 Ebd., S. 197.
50 Dazu gehören auch die folgenden beiden Standardwerke, die sich mit Indiens Rolle bzw. mit der Haltung indischer Nationalisten im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen: Voigt, Indien; Hauner, India. Mit der muslimischen Khaksarbewegung und ihrer Nähe zum Faschismus beschäftigt sich: Daechsel, Scienticism, S. 443–472. Die Haltung des wichtigen INC-Politikers Jawaharlal Nehru wurde unter anderem analysiert in: Framke, Nehrus; Weidemann, Nehru, S. 387–398.
51 Vgl. Sareen, Bose; Kuhlmann, Bose; Zöllner, Feind; Sareen, Nazi Germany; Weidemann, Bose, S. 317–329; Gordon, Brothers. Zur Indischen Legion, die 1941 von Bose geschaffen wurde und viele indische Kriegsgefangene für den Kampf an deutscher Seite gegen Großbritannien und für die Unabhängigkeit Indiens rekrutierte, siehe: Günther, Indien; Oesterheld, Legion, S. 209–226.
52 Vgl. Sharma, Reaction.
53 Vgl. Prayer, Search; Prayer, Regime, S. 256–259; Sofri, Gandhi.
54 Vgl. Delfs, Hindu-Nationalismus; Jaffrelot, Christophe, Ideas, S. 327–354; Bhatt, Hindu Nationalism.
55 Vgl. Casolari, Nazionalismo; Casolari, Hindutva’s, S. 218–228.
56 Die italienische Forschung hat sich ebenfalls mit Akteuren, wie Mahatma Gandhi und Subhas Chandra Bose beschäftigt (vgl. Martelli, L’India; Prayer, Gandhi, S. 55–83). Darüber hinaus wurden einzelne Personen bzw. Aspekte der italienisch-indischen Beziehungen untersucht, wie das IsMEO oder die indische Auseinandersetzung mit dem Abessinienkrieg (vgl. Ferretti, Politica, S. 779–819; De Felice, L’India, S. 1309–1363; Procacci, Parte).
57 Vgl. Flora, Sarkar; Flora, Essay; Manjapra, World.
58 Vgl. Prayer, Search. Auch in dem von ihm veröffentlichten Beitrag „Italian Fascist Regime and Nationalist India, 1921–1945“, der eine Analyse der italienischen Rezeption des nationalistischen Indien beinhaltet, gehört die benannte Thematik nicht zu Prayers Fokus (vgl. Prayer, Regime, S. 249–271). Zu den Personen, die in Prayers Forschungsbeiträgen eine Rolle spielen, gehören: Kalidas Nag, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Benoy Kumar Sarkar, Taraknath Das, Pramatha Nath Roy, Monindra Mohan Moulik und Subhas Chandra Bose.
59 Vgl. Prayer, Internazionalismo; Prayer, India, S. 236–259.
60 Vgl. Prayer, Internazionalismo, S. 105. Prayer zufolge bewunderten die bengalischen Intellektuellen Italien als erfolgreiches Modell eines modernen Staates, der die Fähigkeit besaß, die Massen zu mobilisieren und ihnen einen neuen Geist von Disziplin einzuflößen, der soziale Harmonie herstellen und in sich alle Aspekte des öffentlichen und individuellen Lebens aufnehmen konnte. Auch die Industrialisierung und die Dynamik im internationalen Bereich, die zur Rückgewinnung des Prestiges für das ehemals unterdrückte Land geführt hätten, seien positiv rezipiert worden. Dabei sei das faschistische Beispiel wie eine geglückte Wiederholung der Swadeshi-Bewegung erschienen (vgl. ebd., S. 107).
61 Vgl. Prayer, India, S. 254.
62 Ebd.
63 Vgl. Egorova, Jews, S. 35–54.
64 Vgl. Roland, Communities, S. 177–210.
65 Vgl. Bhatti/Voigt, Exile.
66 Vgl. Voigt, Emigration.
67 Vgl. Gordon, Brothers, S. 309; 370f. und 454; Voigt, Hitler, S. 33–63; Pelinka, Demokratie, S. 96ff. Pelinka schreibt, dass Bose durchaus gewisse Affinitäten gegenüber dem italienischen Faschismus pflegte, dass er aber kein Faschist im Sinne der faschistischen Bewegungen Europas war. Seine Einschätzung des Nationalsozialismus und Hitlers hingegen, war, Pelinka zufolge, von falschen Überlegungen geprägt. So habe im deutschen Falle die nationalsozialistische Ideologie, die rationale Zweckbündnisse ausschloss, gegen eine Annäherung und mögliche deutsch-indische Kooperation gewirkt. Auch nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges seien Boses Aktivitäten in Deutschland durch die nicht sympathisierende bzw. ideologisch stark geprägte Haltung der Hitlerregierung eingeschränkt gewesen (vgl. Pelinka, Demokratie, S. 96, 98, 100f. und 171ff.). In verschiedenen Veröffentlichungen, oftmals durch Wegbegleiter Boses, gilt der bengalische Politiker nicht nur als Nationalist, sondern als Held des indischen Unabhängigkeitskampfes. Als Beispiel siehe: Werth, Tiger. Es gibt allerdings auch Einschätzungen, die ihn als Nazi-Kollaborateur darstellen, der viele Aspekte der faschistischen/nationalsozialistischen Ideologie nicht nur bewunderte, sondern aus Überzeugung teilte (vgl. Rössel, Seiten, S. 29–32).
68 Vgl. Prayer, India, S. 242.
69 Bose, Subhas Chandra: The Indian Struggle, 1920–1942, hg. von Sisir Kumar Bose und Sugata Bose, New Delhi 1997, S. 351. Bose hatte schon 1930 in seiner Antrittsrede als Bürgermeister von Kalkutta positiv über Faschismus gesprochen, indem er eine Synthese aus Faschismus und Sozialismus für Indien vorschlug (vgl. Gordon, Brothers, S. 234f.).
70 Als solche benannte Bose die Unterordnung des Individuums unter den Staat, die Ablehnung parlamentarischer Demokratie, die Herrschaft einer Partei und die Unterdrückung jeglicher abweichender Meinungen sowie das Konzept wirtschaftlicher Planung (vgl. Bose, Struggle, S. 351f.).
71 Vgl. o.A.: ‚Interview with R. Palme Dutt (24.01.1938)‘, in: NCW, Bd. 9, S. 2. Dutt fragte im Interview, ob Bose einen Kommentar zu seinen Ansichten zum Faschismus, wie er sie im seinem Buch „The Indian struggle“ geäußert habe, machen wolle. Bose erwiderte: „My political ideas have developed further since I wrote my book three years ago. What I really meant was that we in India wanted our national freedom, and having won it, we wanted to move in the direction of Socialism. This is what I meant when I referred to ‚a synthesis between Communism and Fascism‘. Perhaps the expression I used was not a happy one. But I should like to point out that when I was writing the book, Fascism had not started on its imperialist expedition, and it appeared to me merely an aggressive form of nationalism.“ (ebd., S. 2).
72 Zu Benoy Kumar Sarkar siehe den biografischen Anhang. Eine ausführliche Darstellung von Sarkars Beziehungen und Auseinandersetzung mit dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland siehe Kapitel 6.1.2.1.
73 Vgl. Frykenberg, Sarkar, S. 197–217; Mukhopadhyay, Sarkar, S. 52–70; Mukherjee, Sarkar.
74 Vgl. Flora, Sarkar; Flora, Essay; Prayer, India, S. 236–242; Bhattacharyya, Sociology, S. 75ff.; Manjapra, World.
75 Vgl. Bhattacharyya, Sociology, S. 81. Bhattacharyya erklärt diese Sympathie mit Sarkars Wahrnehmung eines gemeinsamen Schicksals des im Ersten Weltkrieg besiegten Deutschland und des kolonial unterjochten Indien. Deutschland wäre von den Siegermächten unterdrückt und aus diesem Grund ebenso wie Indien kolonialisiert. Sarkar bewunderte Hitler und Mussolini, da sie, laut Bhattacharyya, für ihn Nationalisten par excellence darstellten, die ihre jeweiligen Länder wieder erweckt, von der Abhängigkeit ausländischer Mächte befreit und im Falle Italiens von wirtschaftlicher und kultureller Rückständigkeit erlöst hatten (vgl. ebd., S. 81 und 84f.).
76 Vgl. Prayer, India, S. 238f.
77 Vgl. Flora, Sarkar, S. 63ff. und 94ff.; Flora, Essay, S. 106.
78 Vgl. Flora, Sarkar, S. 100.
79 Vgl. Manjapra, World, o.S. (Kapitel 7). So weist Manjapra darauf hin, dass Begriffe, die Sarkar benutzte, wie jati (Menschen, Volk), Greater India und mahamanab (der große Mann, Führer), seit Ende des 19. Jahrhunderts im politischen Diskurs Indiens gebräuchlich waren. Sie brachten Sarkar in der Zwischenkriegszeit mit pandeutschen Denkern in Verbindung, die Ideen von Volk, Lebensraum und despotischer Herrschaft befürworteten. Manjapra schreibt, dass Sarkar die Grammatik der deutschen konservativ-revolutionären Gedanken ebenso wie die indische politische Philosophie zur Umsetzung seiner antikolonialen Zielsetzungen gebrauchte, verschmolz und veränderte. Dabei hätte der bengalische Intellektuelle durchaus entscheidende ideologische Komponenten des Nationalsozialismus missinterpretiert und nicht-existente Gemeinsamkeiten zwischen Indien und Deutschland konstruiert. Manjapra schlussfolgert „The experience of colonialism formed such a fundamental aspect of Sarkar’s Indian world that much of his writing about the Nazis and about Hitler must be read and understood as a critique and attack on the status quo system of colonial domination.“ (ebd.).