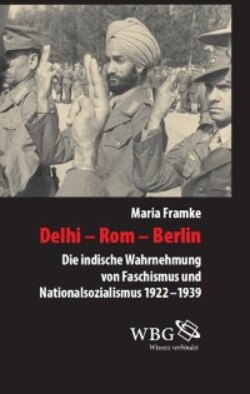Читать книгу Delhi - Rom - Berlin - Maria Framke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Faschismus in Indien: Zum Stand der Debatte 2.1 Faschismusforschung: Ansätze und Theorien
ОглавлениеDie wissenschaftliche Literatur zum Thema Faschismus und Nationalsozialismus ist in ihrer Breite kaum erfassbar und hat eine Vielzahl kontroverser Interpretationen hervorgebracht. Auch die Debatten darüber, was Faschismus genau ist, dauern bis zum heutigen Tag an. Bei den Faschismustheorien, die sich seit der Zwischenkriegszeit entwickelt haben, lassen sich verschiedene Herangehensweisen unterscheiden.1 So haben monokausale Erklärungsmodelle, die zur Entstehung von Faschismus jeweils eine zentrale Ursache zu bestimmen suchen, diesen zum Beispiel als Auswuchs des Kapitalismus, als Resultat pathologischer psycho-sozialer Impulse, als typische Manifestation der totalitären Strömungen des 20. Jahrhunderts, als Revolte gegen Modernisierung ebenso wie auch als radikaler Ausdruck von Moderne oder – im Falle des Nationalsozialismus – als Konsequenz eines nationalen ‚Sonderwegs‘ beschrieben.2 Vertretern eines generischen Faschismusbegriffes erscheinen solche monokausalen Ansätze als unzureichend, da es ihnen nicht gelinge „[…] a common or comparative category of diverse movements and regimes“ zu finden.3 Die Suche nach allgemeinen Merkmalen oder einem gemeinsamen ‚Wesen‘ des Faschismus lässt sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen. Die Frage war hier, inwieweit sich der Faschismusbegriff, der v.a. auf dem italienischen Fall basiert, auf andere Kontexte übertragen lässt. Seither zielt die generische Forschungsrichtung auf die Identifikation der strukturellen Kernelemente für eine allgemeine Faschismusdefinition.4 Im Verlauf der Zeit wurden dabei immer neue Charakteristika in den Mittelpunkt gestellt. In den 1960er Jahren schlug zum Beispiel Ernst Nolte das sogenannte ‚faschistische Minimum‘ vor, das aus folgenden Elementen besteht: Anti-Marxismus, Anti-Liberalismus und Anti-Konservatismus, Führerprinzip, Parteiarmee und Totalitätsanspruch.5
Während Noltes Konzept in Deutschland eine äußerst kritische Aufnahme fand, bemühten sich angelsächsische Forscher, wie Roger Eatwell, Roger Griffin, Walter Laquer, Stanley Payne und George Mosse, aber auch der israelische Politikwissenschaftler Zeev Sternhell weiterhin um allgemeine Faschismusdefinitionen.6 Zu der Frage, was das ‚faschistische Minimum‘– von Griffin zusammengefasst „the lowest common denominator of defining features to be found in all manifestations of fascism“7 – ausmacht, wurde von der Forschung bis heute kein Konsens erzielt. Obwohl dieses Problem fortbesteht und sich der generische Ansatz mit der Kritik auseinanderzusetzen hatte, dass er zu einer Vereinfachung sehr unterschiedlicher historischer Prozesse führe, wurde der Gattungsbegriff Faschismus keineswegs aufgegeben.8 Jedoch wendete beispielsweise Roger Griffin ein, dass es keine objektive Definition von Faschismus geben könne, da der Faschismusbegriff, wie alle Gattungsbezeichnungen in den Geisteswissenschaften, sich im Grunde auf einen ‚Idealtypus‘ beziehe.9 Stanley Payne, der ähnlich argumentiert, wies zudem auf die Notwendigkeit hin, neben dem gemeinsamen Kern die Diversität faschistischer Bewegungen im Blick zu behalten:
[..] when employing an inductive inventory of characteristics of generic fascism, individual movements should be understood to have potentially possessed (depending upon cases) further beliefs, goals, and characteristics of major importance that did not necessarily contradict the common features but went beyond them. 10
Diese zunehmende Flexibilisierung des Faschismuskonzeptes scheint auf den ersten Blick auch für den Umgang mit der Problematik des nicht-europäischen Faschismus hilfreich. Jedoch zeigt sich, dass auch die offeneren Ansätze Faschismus zumeist als ausschließlich europäisches Phänomen begreifen. Eine ‚Anwendung‘ des nur vermeintlich ‚allgemeinen‘ Faschismusbegriffs auf Bewegungen, Organisationen und Parteien außerhalb Europas scheint daher nach wie vor problematisch, wie unten noch auszuführen sein wird.
Selbst die Idee eines europäischen Faschismus, wie sie Ernst Nolte, Stanley Payne und Arnd Bauerkämper11 vertreten, ist keineswegs allgemein akzeptiert. Forscher wie Renzo de Felice, Karl Dietrich Bracher, Klaus Hildebrand, Bernd Martin und Gilbert Allardyce haben eingewandt, dass schon zwischen den beiden einzigen Staaten, in denen faschistische Gruppen die Regierung übernehmen konnten, nämlich Italien und Deutschland, unübersehbare Unterschiede bestanden hätten. Die generische Faschismustheorie ignoriere die spezifischen Charakteristika des Nationalsozialismus, vor allem dessen radikale Rassenpolitik und trivialisiere dadurch sein Terrorregime sowie den Holocaust.12 Die in diesem Buch untersuchte indische Auseinandersetzung mit beiden Regimen zeigt, dass sich beide Auffassungen (sowohl die Betonung der Gemeinsamkeit als auch der Differenz von Faschismus und Nationalsozialismus) bereits in der zeitgenössischen Wahrnehmung finden lassen. Da der weitaus größere Teil der Diskussionen sich nur jeweils mit einem der beiden Phänomene bzw. einzelner seiner Aspekte beschäftigte, wird hier die Wahrnehmung von Nationalsozialismus und Faschismus soweit möglich getrennt analysiert, um auf dieser Grundlage vergleichen zu können.
Im Zusammenhang mit diesem Buch ist nun vor allem interessant, inwieweit sich Faschismus als globales Phänomen verstehen lässt. Bei Stanley Payne (1987) findet sich das zirkuläre Argument, „[that, M. F.] the full characteristics of European fascism could not be reproduced on a significant scale outside Europe.“13 Seiner Ansicht nach habe es spezifische Vorbedingungen für die Entstehung des Faschismus in Europa gegeben, die in anderen Regionen nicht vollständig vorgelegen hätten.14 Dagegen plädieren neuere Forschungsbeiträge für eine offenere Definition von Faschismus, die Bewegungen und Regime auf anderen Kontinenten mit einbezieht, so z.B. Stein U. Larsen.15 Der von ihm herausgegebene Band „Fascism outside Europe“ versucht, einen systematischen Überblick über die globale Verbreitung faschistischer Ideen zu geben.16 Larsens Position, Faschismus sei auch außerhalb Europas zu finden gewesen, basiert auf einem Diffusionsmodell. So stamme Faschismus in außereuropäischen Regionen, Larsen zufolge, aus Europa, da „[…] much of the thinking and many of the organizational and political forms were diffused from European models.“17 Das europäische Modell habe sich dann in Asien und Lateinamerika mit verschiedenen lokalen und regionalen ‚Impulsen‘ zu neuen Bewegungen und Ideen verbunden.18
Die Vorstellungen des Faschismus als ausschließlich europäischem Phänomen bzw. Phänomen ausschließlich europäischen Ursprungs haben vor allem von Historikern mit Regionalexpertise Kritik erfahren. Rikki Kersten beispielsweise schreibt in ihrem Beitrag über Japan im „Oxford handbook of fascism“, dass Studien zum Faschismus in nicht-westlichen Gebieten oftmals entweder von der Suche nach nicht vorhandenen Eigenschaften und nach Mängeln gekennzeichnet sind oder dass sie nur hinsichtlich kultureller Differenzen Aufmerksamkeit erregen.19 An Payne20 kritisiert sie, dass bei ihm faktisch asiatische „Besonderheiten“ herangezogen würden, um zu erklären, warum es dort zu keinem Faschismus europäischen Typs kommen konnte.21 Diese Art eurozentrischer Geschichtsschreibung, in der Europa nicht Vergleichsobjekt, sondern Vergleichsstandard sei, liefe auf eine Form des intellektuellen Kolonialismus hinaus.22 Auch Benjamin Zachariah, der zu Indien arbeitet, weist die Vorstellung von Faschismus als einem europäischen Phänomen zurück. Zachariah hebt dabei die Schwierigkeit hervor zu entscheiden, welche Phänomene sich als genuin faschistisch definieren lassen und welche (wie z.B. „[…] the desire and ability […] to create movements of controlled mass participation and organized violence“23) sehr viel weiter verbreitet waren. Statt die Ursprünge faschistischer Ideen in Europa zu lokalisieren, spricht Zachariah von einem Zeitgeist, der auf älteren, ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Wissensbeständen basierte und sich in Debatten zwischen dem ‚Westen‘ und dem ‚Osten‘ formiert habe.24
Während Forscher wie Kersten und Zachariah in die theoretischen Debatten um einen allgemeinen Faschismusbegriff intervenieren, stellen andere Experten außereuropäischer Kontexte die Frage nach den Reaktionen auf Faschismus und Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Ein Beispiel ist der aufschlussreiche Band „Blind für die Geschichte“, der sich mit den vielfältigen Wahrnehmungen des Nationalsozialismus im Mittleren Osten und Nordafrika beschäftigt. Hier wird einerseits gefragt, inwieweit öffentliche Stimmen in der arabischen Welt faschistische und nationalsozialistische Ideologien teilten. Gleichzeitig tragen die Beiträge durch die Untersuchung der Rezeptionsformen und -wege zu einer Neubewertung des Faschismus als Phänomen mit globaler Reichweite bei.25
Auch Götz Nordbruch richtet in seiner Arbeit zum Nationalsozialismus in Syrien und im Libanon den Fokus weniger auf die Ermittlung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden zwischen lokalen und nationalsozialistischen Akteuren. Sein Hauptinteresse liegt vielmehr in der Rekonstruktion der lokalen Beschäftigungen mit Nationalsozialismus als Reflektion der politischen Kultur.26 An diese unterschiedlichen Einwände aus Sicht von regional-spezialisierten Historikern, die sich um ein nicht-europäisches Verständnis von Faschismus bemühen, knüpft das vorliegende Buch an. Dem entspricht auch eine Materialbasis, die vor allem Stimmen indischer Beobachter des italienischen Faschismus und des Nationalsozialismus enthält. Deren Aufmerksamkeit richtete sich, wie sich zeigen wird, teilweise gerade auf solche Aspekte, die man als ‚soft features‘ des Faschismus bezeichnen könnte bzw. auf Politiken, die zwar zum diskursiven Bereich von Faschismus gehören, aber ebenfalls als Teil eines breiteren Zeitgeistes gesehen werden können (z.B. Planwirtschaft, Jugendkult, Disziplin und Militarismus).27
Statt von einem idealtypischen (europäischen) Faschismus oder einem festen ‚faschistischen Minimum‘ auszugehen, an dem Entwicklungen in Indien gemessen werden können, soll auch in diesem Buch ein Perspektivenwechsel vorgenommen werden, der die europäische Erfahrung gewissermaßen ‚dezentriert‘. Zur Beurteilung von Faschismus als globalem Phänomen ist es nicht nur wichtig, Formen seiner Aneignung durch soziale und politische Bewegungen und Regime zu analysieren und nach Kollaborationen und Allianzen zu fragen. Ebenso wichtig ist es zu untersuchen, wie bestimmte intellektuelle und politische Gruppen Faschismus diskutiert und definiert haben, welche seiner Elemente positiv beurteilt und welche zurückgewiesen wurden, zu welchem Zeitpunkt dies passierte und warum. Ein universaler Faschismusbegriff wird dabei nicht verworfen. Vielmehr geht es darum zu sehen, inwieweit eine Einbeziehung außereuropäischer Wahrnehmungen einen Beitrag zur Charakterisierung des Faschismus leisten kann.
Daher ist die Frage, wie Faschismus in der indischen Öffentlichkeit definiert wurde bzw. was genau als ‚faschistisch‘ verstanden wurde, zentraler Bestandteil der hier vorgenommenen Untersuchung der Wahrnehmung von Faschismus und Nationalsozialismus in Indien. Wie zu zeigen sein wird, beschäftigten sich die Kommentatoren aus Indien dabei eher mit den Methoden und der Politik als mit der Ideologie von Faschismus und Nationalsozialismus. Beide galten in der indischen Auseinandersetzung oftmals als Modernisierungsbewegung, in denen ein ‚starker Führer‘ mit effizientem zentralisiertem Staatsapparat die Nation einte. Insbesondere der letzte Topos des erfolgreichen nation building, Faschismus als Variante eines übersteigerten Nationalismus, der sich gegen externe und interne Kräfte durchsetzen konnte, spielte eine herausragende Rolle.28