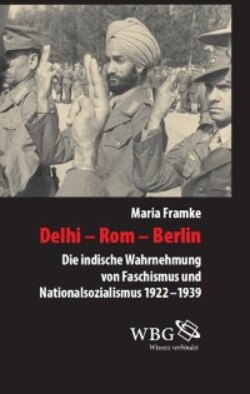Читать книгу Delhi - Rom - Berlin - Maria Framke - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Ausgangsthesen und Aufbau des Buches
ОглавлениеDas vorliegende Buch untersucht indische Diskussionen über das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland und vergleicht die indische Auseinandersetzung mit beiden Staaten, indem sie nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Wahrnehmung beider Regime fragt. Dabei werden zeitgenössische Debatten als Reflektion der politischen Kultur Indiens rekonstruiert und durch eine transnationale Perspektive kontextualisiert.
Zunächst zeigt das Buch, dass vor allem der italienische Faschismus in gewisser Hinsicht als Referenzmodell für den sich formierenden indischen Nationalstaat wahrgenommen wurde. Dies kommt sowohl in Debatten über die zukünftige Staatsform und Wirtschaftsordnung als auch für die Schaffung einer starken geeinten Nation und die Überwindung kommunalistischer45 Konflikte zum Ausdruck. Die Auseinandersetzung mit Italien und Deutschland und die Frage nach möglichen Aneignungen stellte gleichzeitig das britische Modell der parlamentarischen Demokratie und liberaler Wirtschaftsordnung in Frage und war, so lautet die These hier, stark von der eigenen kolonialen Erfahrung beeinflusst.
Wurden Italien und Deutschland im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich von indischen Autoren als Alternativen zum Modell der britischen Kolonialmacht diskutiert, trifft dies für den außenpolitischen Bereich, wie zu zeigen sein wird, jedoch nicht zu und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, so lautet die These, rief die Außenpolitik Roms und Berlins viel Kritik und Ablehnung hervor. Eine Aneignung entsprechender Maßnahmen schien hier kaum in Frage zu kommen. Zum anderen kommentierten die indischen Beobachter den faschistischen und nationalsozialistischen Expansionismus vor dem Hintergrund einer Kritik der imperialen Politik Großbritanniens und hoben dabei auch die Gemeinsamkeiten hervor. Darüber hinaus waren indische Diskussionen über die Außenpolitik Italiens mit Vorstellungen kollektiver Sicherheit, wie sie durch den Völkerbund repräsentiert wurden, verbunden. Die Auseinandersetzung mit der Politik der Genfer Organisation im Abessinienkrieg, so wird gezeigt, hatte zwei wesentliche Auswirkungen: erstens lieferte sie stärkere Impulse zur Initiierung einer eigenständigen Außenpolitik durch indische Nationalisten als bisher angenommen; zweitens förderte sie alternative Vorstellungen kollektiver Sicherheit, die auf globaler Ebene wirken und auf Gleichheit aller Völker basieren sollten.
Als die direkteste Form der Interaktion zwischen indischen Nationalisten und Italien und Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren können die Kooperationsbeziehungen im Bildungs- und Kulturbereich gelten. Im Rahmen des Buches wird gezeigt, dass über die Kooperationsbeziehungen wichtige Kommunikationskanäle entstanden, die die Zirkulation politischer Ideen und Beschreibungen der Maßnahmen beider Regime in Indien erleichterten. Der Erfolg der entsprechenden Initiativen bzw. Brüche in den Interaktionen wurden dabei auch von der indischen Auseinandersetzung mit anderen Aspekten des Faschismus und Nationalsozialismus geprägt.
In der indischen Beschäftigung mit den Regimen Mussolinis und Hitlers wurden auch deren Jugendbewegungen, Bildungspolitik und damit zusammenhängend Fragen nach einem ‚Führer‘ und dem ‚Dienst an der Nation‘ sowie der Disziplin und Körperkultur/-ertüchtigung (physical culture) diskutiert. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die Antworten von Kritik und Ablehnung über Bewunderung bis hin zu Vorschlägen einer Aneignung beinhaltete, spiegelte dabei, so lautet die These hier, kaum eine reale Integration faschistischer und nationalsozialistischer Politik und Ideologie wider, sondern muss eher im Zusammenhang mit eigenen, indischen Traditionen und im Sinne des Zeitgeistes verstanden werden.
Rassismus und Antisemitismus stellten konstituierende Aspekte von Faschismus und Nationalsozialismus dar.46 Sie wurden in den analysierten indischen Quellen ebenfalls recht unterschiedlich diskutiert. Italienischer Rassismus wurde von indischen Kommentatoren vor allem im Zusammenhang mit der faschistischen ‚Zivilisierungsmission‘ im Abessinienkrieg thematisiert und aufgrund der eigenen Erfahrungen mit der britischen Kolonialherrschaft, so hier die These, überwiegend kritisch zurückgewiesen. Der deutsche Rassismus und dabei insbesondere die Stellung der Inder in der nationalsozialistischen Rassentheorie und ihre Behandlung in Deutschland nahm in indischen Debatten, auch vor dem Hintergrund der deutsch-indischen Kooperationsbeziehungen im Kultur- und Bildungsbereich einen großen Raum ein. Viele der indischen Beiträge kritisierten, so wird hier argumentiert, die abwertenden Äußerungen, allerdings ohne dabei – wie im italienischen Fall – Solidarisierungsbekundungen mit anderen rassisch diskriminierten Gruppen zu äußern oder auf eigene Erfahrungen im kolonialen Kontext zu verweisen. Anders stellten sich die nationalsozialistischen Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung dar. Hier wurden, durch die Zuspitzung der Situation für mitteleuropäische Juden im Verlauf des Jahres 1938, verstärkt antisemitismuskritische Kommentare in indischen Debatten geäußert. Einer uneingeschränkten Solidarisierung mit deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, so wird hier vermutet, war durch die oft als kritisch wahrgenommene Einwanderung jüdischer Flüchtlinge nach Indien bzw. durch die kontroversen indischen Diskussionen Grenzen gesetzt.
Im Folgenden soll nun der Aufbau des Buches kurz vorgestellt werden. Vor der Analyse der Wahrnehmung des Faschismus und des Nationalsozialismus werden im zweiten Kapitel grundlegende Begriffe eingeführt. Hier wird einerseits ein kurzer Überblick über die für dieses Buch relevanten Debatten der Faschismusforschung gegeben und zusammengefasst, wie Faschismus und Nationalsozialismus in Indien definiert wurden bzw. welche konstituierenden Bestandteile in den indischen Debatten ausgemacht wurden. Andererseits wird im zweiten Kapitel die bisher vorhandene Literatur zu Faschismus in Indien vorgestellt. Abschließend wird am Beispiel zweier indischer Akteure, deren Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt, gezeigt, mit welchen Schwierigkeiten eine nachträgliche Beurteilung bzw. Beantwortung der Frage „Wer ist ein Faschist gewesen?“ verbunden ist. Da die Beschäftigung mit Faschismus und Nationalsozialismus immer politische Implikationen hat, möchte die Autorin an dieser Stelle nachdrücklich betonen, dass es hier keineswegs um ein ‚Reinwaschen‘ oder ‚Entschuldigen‘ indischer Faschisten und Faschismus-Sympathisanten geht. Sinnvoll scheint ihr eher eine Forschungsperspektive, die nicht die Kategorisierung einzelner Personen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, sondern der Frage nachgeht wie Faschismus und Nationalsozialismus sich für indische Beobachter darstellten, was genau ihnen ggf. attraktiv erschien.
In den sich anschließenden fünf Hauptkapiteln werden einzelne Aspekte des Faschismus und des Nationalsozialismus bzw. Themenbereiche analysiert, die im ausgewählten Quellenkorpus entweder umfassend diskutiert oder in der vorhandenen Literatur als wichtige Beispiele der indischen Beschäftigung mit Faschismus und Nationalsozialismus benannt worden sind. Im dritten Kapitel steht die Analyse der Austauschbeziehungen zwischen Indien und Italien sowie Indien und Deutschland im Kultur- und Bildungsbereich im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Ausführungen sollen zur Beantwortung der Fragen beitragen, wie Ideen zum und Diskurse über den Faschismus und den Nationalsozialismus nach Indien gelangten und inwieweit deutsche oder italienische Versuche, die öffentliche Meinung in Indien zu beeinflussen, nachgewiesen werden können, und wenn ja, auf welche Art und Weise. Dazu werden beispielhaft die Kooperationsbeziehungen des Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) sowie der Deutschen Akademie mit indischen Intellektuellen untersucht.
Das vierte Kapitel thematisiert indische Wahrnehmungen und Diskussionen der faschistischen und nationalsozialistischen Jugend- und Bildungspolitik sowie der Themen Körperertüchtigung, Disziplin, ‚Dienst an der Nation‘ und Militarisierung. Disziplin und Planung, so Zachariah in seinem wegweisenden Artikel „Rethinking (the Absence) of Fascism in India, c. 1922–1945“ waren womöglich „[…] the most explicit of the strands of pro-fascist arguments made in Indian circles“.47 Disziplin wurde einerseits als grundlegende Voraussetzung für die Errichtung einer (zukünftigen) indischen Nation wahrgenommen, andererseits als Methode zur Kontrolle und Mobilisierung der Massen.48 Im Anschluss an Zachariah wird im Kapitel 4 der Frage nachgegangen, inwieweit die faschistischen und nationalsozialistischen Jugendorganisationen, die Maßnahmen beider Regime zur Körperertüchtigung sowie ihre Praktiken zur militärischen und zivilen Erziehung von Jugendlichen im indischen Kontext als Vorbilder galten. Nach kurzen Darstellungen der Jugend- und Bildungspolitik im faschistischen Italien und im Nationalsozialismus werden entsprechende Wahrnehmungen und Beziehungen in hindunationalistischen Zirkeln, in der bengalischen Intelligenzija sowie in den nationalistischen Medien und im INC analysiert.
Schon zeitgenössische Autoren, Politiker und die Presse in vielen Ländern setzten sich intensiv mit den rassistischen und antisemitischen Theoremen und Praktiken des deutschen und des italienischen Regimes auseinander. Dies lässt sich ebenfalls für den südasiatischen Subkontinent und insbesondere in den Schriften der ausgewählten Quellenbestände feststellen. Im fünften Kapitel werden dementsprechend zuerst die nationalsozialistischen Rassentheorien in Bezug auf Indien vorgestellt und anschließend die indische Auseinandersetzung mit der deutschen Rassenpolitik untersucht. Ein Fokus der Analyse liegt dabei auf Diskursen zur Stellung indischer Staatsangehöriger in der ‚Rassenhierarchie‘ des nationalsozialistischen Deutschland sowie auf konkreten Maßnahmen von indischer Seite, die sich gegen die wahrgenommenen deutschen Diskriminierungen richteten. Die Verfasserin argumentiert in diesem Zusammenhang, dass in den indischen Debatten weniger die grundsätzliche Ablehnung der nationalsozialistischen Rassentheorien und -politik im Vordergrund stand, sondern dass vor allem der geringe ‚rassische‘ Status der Inder zurückgewiesen wurde. Die Frage nach Aneignungen nationalsozialistischer Rassentheorien in Indien bildet den zweiten Schwerpunkt in Kapitel 5.1. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei die hindunationalistische Auseinandersetzung mit Rassenkonzepten, die in der Sekundärliteratur schon umfassend ausgewertet wurde. Im Rahmen dieses Buches werden die verschiedenen Positionen von Christophe Jaffrelot, Tobias Delfs und Chetan Bhatt49 vorgestellt und analysiert.
Ein konstitutives Element der nationalsozialistischen Rassenpolitik war der Antisemitismus, der während des Zweiten Weltkrieges im Holocaust gipfelte. Die antisemitischen Maßnahmen des NS-Regimes, aber auch des faschistischen Italien wurden in medialen Debatten sowie von Politikern des INC und der HMS in Indien thematisiert und diskutiert. Die Wahrnehmung der deutschen Vorgänge in Indien zeigt dabei Brüche auf, die genauer hinterfragt werden müssen. Antisemitische Ideen spielten als historisches Phänomen in Indien nur eine äußerst untergeordnete Rolle und auch die Aneignung der nationalsozialistischen antisemitischen Ideologie konnte für die analysierten indischen Quellen kaum nachgewiesen werden. Nichtsdestoweniger gab es einen konkreten Berührungspunkt, der nicht nur eine umfangreiche Debatte, sondern auch vielfältige Hilfsinitiativen nach sich zog. Die durch die nationalsozialistische Rassenpolitik bzw. den fanatischen Antisemitismus ausgelöste Flüchtlingswelle mitteleuropäischer Juden unter anderem nach Indien wurde auf dem Subkontinent kontrovers diskutiert. Die Debatte um Vorteile und Nachteile einer jüdischen Immigration nach Indien war dabei einerseits vom Verständnis der kolonialen Situation des eigenen Landes, andererseits von Partikularinteressen beeinflusst.
Ein in Indien weithin wahrgenommenes und intensiv diskutiertes Thema stellte die Wirtschaftspolitik Italiens und Deutschlands dar, die im sechsten Kapitel den Bezugsrahmen der indischen Auseinandersetzung liefert. Konfrontiert mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise und auf der Suche nach einem passenden ökonomischen Modell für (das unabhängige) Indien konzentrierten sich nationalistische Debatten stark auf die Konzepte wirtschaftlicher und sozialer Planung. Zachariah hat darauf hingewiesen, dass entsprechende Überlegungen oftmals mit den Themen nation building, Modernisierung oder mit Diskussionen über die zukünftige Regierungsform verbunden waren. Wirtschaftliche Planung und Entwicklung wurden somit zu entscheidenden Faktoren für die Konstruktion und Gestaltung einer unabhängigen und vereinten indischen Nation.50 Dabei beobachtete und diskutierte man in Indien die wirtschaftlichen Entwicklungen und Planungsmaßnahmen in anderen Ländern, so unter anderem die des faschistischen Italien und des nationalsozialistischen Deutschland. Die wirtschaftlichen Erfolge beider Regime wurden von indischen Stimmen teilweise als nachahmenswerte Beispiele angeführt.51 Auch Mario Prayer weist in seinem aktuellsten Aufsatz auf die Verbindungen indischer Intellektueller zum faschistischen Italien hin. Dabei konstatiert er, dass Erstere den Dialog außerhalb des kolonialen Kontexts gesucht hätten, um eine eigene nicht-koloniale Identität für ihr zukünftig unabhängiges ‚Heimatland‘ ausarbeiten zu können.52 Zachariahs und Prayers Thesen zur Vorbildfunktion Italiens und Deutschlands in puncto wirtschaftliche Planung und deren Instrumentalisierung für den erfolgreichen Aufbau eines Nationalstaates aufgreifend, wird hier der bisher noch nicht geklärten Frage nachgegangen, welche wirtschaftlichen Maßnahmen des Faschismus und Nationalsozialismus im Einzelnen als nachahmenswert wahrgenommen wurden und warum. Aus diesem Grund werden nach einer einleitenden Vorstellung von indischen Planungsdiskursen die Debatten um Themen wie Arbeitslosenpolitik, Arbeitsdienst, korporativer Staat, Infrastrukturausbau, Landwirtschaftspolitik und soziale Dienstleistungen untersucht. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf jene Stimmen im indischen Diskurs, die sich für eine Übernahme deutscher und italienischer Maßnahmen aussprachen, sondern ebenfalls auf jene kritischen Meinungen, die dem faschistischen und nationalsozialistischen Beispiel ablehnend gegenüberstanden. Das sechste Kapitel schließt mit der Untersuchung der indischen Wahrnehmung der deutschen und italienischen Handelspolitik: einerseits die Auseinandersetzung mit den Autarkiekonzeptionen beider Regime, andererseits die realwirtschaftlichen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Britisch-Indien.
Das siebente Kapitel untersucht die indische Auseinandersetzung mit der italienischen und der deutschen Außenpolitik am Beispiel des Abessinienkrieges und der Sudetenkrise. Die indische Öffentlichkeit zeigte in den 1930er Jahren ein großes Interesse an den politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere an jenen, die von Italien und Deutschland ausgingen. Die Auswahl der beiden Fallstudien für die Untersuchung begründet sich folgendermaßen: der Abessinienkrieg prägte als „erster faschistischer Vernichtungskrieg der Geschichte“53 die indischen Wahrnehmungen des Faschismus entscheidend und definierte sie in vielen Fällen neu; die Sudetenkrise, die in der Zerschlagung der Tschechoslowakei im Frühjahr 1939 endete, stellte die letzte große Krise und Herausforderung vonseiten der Nationalsozialistischen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dar, in der noch die Appeasement-Politik als Leitfaden der britischen Außenpolitik diente. Für die Untersuchung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Wahrnehmung von Faschismus und Nationalsozialismus bieten sich die beiden Fallstudien außerdem an, da beide Konflikte jeweils nur vom einem der Regime ausgingen. Der 1935 ausbrechende Abessinienkrieg wurde intensiv von der englischsprachigen indischen Presse sowie von indischen Politikern und Intellektuellen diskutiert. Die Debatten konzentrierten sich einerseits auf die mutmaßlichen Motive des faschistischen Regimes, Krieg gegen Abessinien zu führen, andererseits auf die Fragen, wie sich Indien gegenüber Italien positionieren und ob man und wenn ja, in welcher Form, Hilfeleistungen für Abessinien organisieren solle. Im Zusammenhang mit dem italienischen Überfall auf Abessinien wurde in indischen Debatten ebenfalls die Politik Großbritanniens und des Völkerbundes thematisiert. Beide Machtzentren trugen in indischen Diskursen einen Großteil der Verantwortung für die imperialistische Eroberungspolitik des faschistischen Italien. Die Auseinandersetzung mit den britischen Maßnahmen und denen des Völkerbundes ließ die Formulierung eigenständiger außenpolitischer Positionen notwendig erscheinen. Diese vor dem Hintergrund des Abessinienkrieges vorgebrachte Forderung blieb auch in den folgenden Jahren in den nationalistischen Debatten ein prominentes Thema und führte im Rahmen der Sudetenkrise zu weitreichenden Diskussionen, wie sich Indien im Falle eines künftigen europäischen Krieges verhalten solle. Während die deutschen Bemühungen, das zur Tschechoslowakei gehörende Sudetengebiet zu okkupieren, in den indischen Medien, aber auch von Politikern des INC und der CSP umfassend und größtenteils kritisch thematisiert wurde, nahm die Kritik an der britischen Politik und die Feststellung seiner Verantwortung für den Ausgang der Krise wiederum großen Raum ein. Das Verhalten Großbritanniens, sein Imperialismus, wurde von verschiedenen Autoren dabei mit Faschismus gleichgesetzt, die Ereignisse in Europa globalisiert und mit der eigenen, der indischen Situation vergleichbar gemacht. Auf diese Weise lieferte die Auseinandersetzung mit der faschistischen und der nationalsozialistischen Außenpolitik neue, brisante Argumente im Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft ebenso wie Gründe für die Notwendigkeit eines erfolgreichen indischen nation building. Ein weiterer Schwerpunkt in den Debatten über das nationalsozialistische Expansionsbestreben spielte die Frage nach dem Status von Minderheiten, ein Thema, das auch in Indien, vor allem in Hinblick auf die Verteilung von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen unter den Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften Bedeutung erlangt hatte.
Zur besseren Übersichtlichkeit für die Leser enthält das vorliegende Buch einen biografischen Anhang. Dieser liefert in selektiver Form allgemeine Informationen über die wichtigsten Akteure, die in dieser Untersuchung behandelt werden.
1 Zu Jawaharlal Nehru siehe den biografischen Anhang.
2 Nehru, Jawaharlal: ‚Spain, China and India (31.07.1938)‘, in: SWJN, Bd. 9, S. 92.
3 Der Begriff ‚Machtergreifung‘ wurde von 1933 bis 1945 in der Presse und im allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland einerseits für die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 verwendet, andererseits für den längeren Prozess der nationalsozialistischen Demokratiebeseitigung und Herrschaftsfestigung. Die NSDAP und führende Nationalsozialisten hingegen gebrauchten vorrangig den Terminus ‚Machtübernahme‘. Seit Mitte der 1980er Jahre wird von der Forschung eher von ‚Machtübergabe‘ gesprochen (vgl. Frei, Machtergreifung, S. 136–145).
4 Siehe zu Mohandas Karamchand Gandhi den biografischen Anhang.
5 Kris Manjapra schreibt, dass es in der Kolonialzeit, vor allem seit dem späten 19. Jahrhundert, eine besondere Form von anti-kolonialem Internationalismus gegeben habe. Dieser habe Querschnittskategorien wie ‚die Kolonialisierten‘ oder ‚die unterdrückten Menschen der Welt‘ Priorität vor staatlichen Identitäten eingeräumt. Diese Art von Internationalismus strebte nach transkolonialer (antikolonialer) Solidarität. Manjapra untersucht in seiner Fallstudie vor allem den Kommunismus als ‚transkoloniale Ökomene‘. Seine Argumentation kann allerdings nur begrenzt Anwendung für den transnationalen Austausch zwischen Indien und Deutschland und Italien finden. Transkolonialer Internationalismus spielte allerdings eine wichtige Rolle in Hinblick auf ablehnende indische Reaktionen gegenüber Faschismus und Nationalsozialismus (vgl. Manjapra, Internationalism, S. 159 und 173).
6 Vgl. dazu Kapitel 3.2.
7 Vgl. Schneider, Darstellung, S. 87; Bhattacharya, Propaganda, S. 126ff.; Barrier, Banned, S. 65–154. Die Regierung Britisch-Indiens ergriff in der Zwischenkriegszeit gelegentlich Repressionsmaßnahmen gegenüber der Presse. Dabei kam vor allem während der durch Gandhi initiierten Kampagne der Nicht-Zusammenarbeit, aber auch gegenüber kommunistischen und kommunalistischen Veröffentlichungen ein weitreichendes Kontrollinstrumentarium zum Einsatz (vgl. Barrier, Banned, S. 108).
8 Siehe zu Vinayak Damodar Savarkar, Balkrishna Shivram Moonje und Madhav Sadashiv Golwalkar den biografischen Anhang.
9 Siehe zu Subhas Chandra Bose den biografischen Anhang.
10 Vgl. Prasad, Origins, S. 112ff.; Chandra, India’s, S. 392ff.; Sharma, Reaction, S. 2.
11 Vgl. Gould, Hindu. Gould führt überzeugend aus, dass der INC in der späten Kolonialzeit weniger eine Partei, als eine Bewegung war, die sich auf eine breite Basis stützen konnte. Er untersucht in seiner Studie, wie in den 1930er und 1940er Jahren angeblich säkulare Kongressangehörige in der Schlüsselprovinz United Provinces durch hindunationalistische Ideologie und Politiksprache beeinflusst waren. Während in den 1920er Jahren enge institutionelle und personelle Verbindungen zwischen dem INC und der HMS bestanden, waren entsprechende Beziehungen am Ende der 1930er Jahre viel weniger offensichtlich. 1938 beschloss der INC, dass Mitglieder des Arbeitsausschusses nicht auf ähnliche Weise mit einer ‚kommunalen‘ Organisation affiliiert sein durften. Trotzdem bestanden, wie Gould zeigt, weiterhin eine Reihe informeller Beziehungen, so zum Beispiel in der Zusammenarbeit zwischen Freiwilligenorganisationen (vgl. Gould, Hindu, S. 9 und 192ff.; Gould, Congress, S. 628f.). Zum Thema der inhaltlichen und personeller Überschneidungen zwischen INC und Hindunationalisten siehe auch: Bhagavan, Hindutva, S. 39–48; Pandey, Construction, S. 254.
12 Vgl. Sonwalkar, Murdochization, S. 823f.; Schneider, Darstellung, S. 89f. Die indische Presse, d.h. die Presse im indischen Besitz, entwickelte und konsolidierte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zunächst als Produkt der indischen Reformbewegungen und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch den antikolonialen Unabhängigkeitskampf. Schneider zufolge wird sie aufgrund ihrer spezifischen Entstehungsgeschichte als „nationales Medium“ betrachtet. Dabei beziehe sich national nicht nur auf ihren geografischen Verbreitungsrahmen, sondern vor allem auf „die Schlüsselrolle, die sie im Hinblick auf die Herausbildung des antikolonial begründeten Nationalismus sowie einer Öffentlichkeit im klassisch-liberalen Sinn in Indien eingenommen“ habe (vgl. Schneider, Darstellung, S. 82).
13 Vgl. Israel, Congress, S. 330 und 335.
14 Vgl. Israel, Communications, S. 156–215. Die vom INC proklamierte Einheit der indischen Nation war, Milton Israel zufolge, in der Zwischenkriegszeit noch keineswegs verwirklicht. Dementsprechend präsentierten die englischsprachigen nationalistischen Zeitungen und Zeitschriften nicht nur die Nation als vorgestelltes Ganzes, sondern ebenfalls bestimmte Teile derselben (vgl. ebd., S. 171).
15 Jawaharlal Nehru nahm bewusst im INC eine Stellung ein, die ihn in den Informationsaustausch zwischen dem Kongress, Indien und der restlichen Welt einband. Dabei erlaubten ihm sein Erfahrungsschatz, seine Ansichten und die langjährige Tätigkeit im Arbeitsausschuss des INC eine relative freie Kontrolle über die Informationspolitik des Kongresses auszuüben (vgl. Israel, Communications, S. 188).
16 Die Zeitungen und Zeitschriften wurden dabei für folgende Zeiträume ausgewertet: Bombay Chronicle und Amrita Bazar Patrika 1928–1939, The Mahratta 1933–1939, The National Herald 1938–1939, The Forward/Liberty 1923–1935, The Hindu Outlook 1938–1939, Modern Review und Calcutta Review 1922–1939, Harijan 1936–1939 und Congress Socialist Sept. 1934-Juni 1939.
17 Vgl. Israel, Communications, S. 21.
18 Vgl. Milton, Communications, S. 216–245; Hazareesingh, City.
19 Vgl. Israel, Communications, S. 45 und 89; Jeffrey, Bengali, S. 141f.; Rangaswami, Journalism, S. 257–261.
20 Vgl. Bose, Majesty’s.
21 Vgl. Israel, Congress, S. 334ff.
22 Vgl. Israel, Communications, S. 17; Ahuja, History, S. 156ff.; Rao, Foundations, S. 34 und 36ff.; o.A.: ‚List of Newspapers‘, in: Report on Newspapers published in the Bombay Presidency, Nr. 45/1929, S. 8.
23 Vgl. Israel, Chatterjee, S. 1–46.
24 Vgl. Ahuja, History, S. 76; Raghavan, Press, S. 49.
25 Vgl. Zachariah, India, S. 51 und 77.
26 Vgl. The University of Calcutta, University Press and Publications, The Calcutta Review, http://www.caluniv.ac.in/univpublication/Calcutta%20Review.htm, Zugriff 24.05.2012, 17:02 Uhr.
27 Aus dem Korpus gingen nur die nationalistischen englischsprachigen Zeitungen in die Analyse ein. Einzig drei Nachrichten aus der Times of India wurden als Beleg von Daten und Fakten herangezogen. Die von den italienischen Behörden zusammengetragenen Zeitungsbeiträge und Karikaturen behandelten vorrangig indische Wahrnehmungen und Debatten der faschistischen Außen- und Wirtschaftspolitik sowie der Rassengesetzgebung von 1938. Diskussionen über das nationalsozialistische Deutschland wurden nur vereinzelt gesammelt.
28 Vgl. Israel, Communications, S. 99–155.
29 Vgl. Nehru, Jawaharlal: ‚Letter to O. Urchs (03.09.1936)‘, in: SWJN, Bd. 7, S. 154.
30 Diskursstränge, die Einsicht in Perzeptionen und Positionen anderer Gruppen und Interessen gaben, so zum Beispiel aus der Perspektive verschiedener Religionsgemeinschaften, der britischen Regierung in Indien sowie der nicht (englisch) gebildeten Schicht, können über die benannten Quellen nicht rekonstruiert werden.
31 Vgl. Pernau, Geschichte; Budde/Conrad/Janz (Hg.), Geschichte; Clavin, Transnationalism, S. 421–439; Osterhammel, Gesellschaftsgeschichte, S. 464–479; Thelen, Nation, S. 965–975.
32 Vgl. Osterhammel, Globalgeschichte, S. 596. Osterhammel schreibt, dass der Begriff der transnationalen Geschichte für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert nur teilweise und in modifizierter Form anwendbar ist.
33 Vgl. Patel, Überlegungen, S. 628.
34 Vgl. Seigel, Compare, S. 63.
35 Vgl. Kaiser, Weltgeschichte, S. 65.
36 Vgl. Gassert, Geschichte, S. 1.
37 Vgl. Seigel, Compare, S. 63.
38 Vgl. Gassert, Geschichte, S. 10ff.; Osterhammel, Transferanalyse, S. 439–466.
39 Vgl. Tschurenev, Schulreform.
40 Vgl. Patel, Perspektiven, S. 631f.
41 Vgl. Pernau, Geschichte, S. 48f.
42 Ebd.
43 Vgl. Patel, Perspektiven, S. 632f.
44 Vgl. zum Konzept von Aneignung: Rothermund, Aneignung; Fischer-Tiné, Character, S. 432–456.
45 Unter Kommunalismus versteht man gewöhnlich die Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen verschiedener, hauptsächlich religiöser Gemeinschaften. Hintergrund der Konflikte ist dabei oftmals der Kampf um politische und wirtschaftliche Ressourcen.
46 Vgl. Hildebrand, Reich, S. 179f.; Benz, Deutschland, S. 42–52.
47 Zachariah, Rethinking, S. 190.
48 Vgl. ebd., S. 189f.; Guha, Dominance, S. 135ff.
49 Vgl. Delfs, Hindu-Nationalismus; Jaffrelot, Ideas, S. 327–354; Bhatt, Hindu Nationalism.
50 Vgl. Zachariah, India, S. 6.
51 Vgl. ebd., S. 7.
52 Vgl. Prayer, India, S. 254.
53 Vgl. Mattioli, Schlüsselereignis, S. 22.