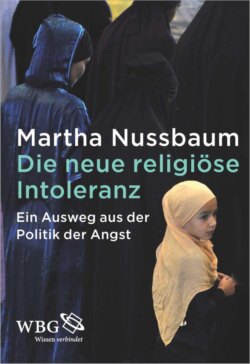Читать книгу Die neue religiöse Intoleranz - Martha Nussbaum - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT
ОглавлениеDie Idee zu diesem Buch kam auf, als man mich bat, eine Kolumne für den Stone zu schreiben, der Philosophieseite des Opinionator, dem Online-Kommentar der New York Times. Dort schrieb ich über das beabsichtigte Burka-Verbot in Europa; was ich dort schrieb, taucht in den Kapiteln 3 und 4 wieder auf. Ich war erstaunt über Ausmaß, Vielfalt und Intensität der Kommentare, die ich daraufhin erhielt. Zum Glück durfte ich darauf mit einem Text antworten, der so lang war wie der ursprüngliche Artikel. Ich danke den Herausgebern und den ungefähr 700 Lesern, die ihre Kommentare schickten, was mich in die Lage versetzte, manche der Ideen weiterzuentwickeln. Zu jenem Zeitpunkt wurde der Gedanke, ein Büchlein über dieses Thema zu schreiben, immer reizvoller. Daher danke ich Joyce Seltzer, meiner langjährigen Lektorin bei Harvard University Press; sie teilte meine Begeisterung und half mir, das Projekt weiter zu entwickeln. Chris Skene und Robert Greer steuerten unschätzbare Forschungsarbeiten bei. Rosalind Dixon, Aziz Huq, Saul Levmore, Ryan Long und Chris Skene danke ich für ihre ausführlichen und anregenden Kommentare zu einer frühen Fassung des Manuskripts. Mehrere Kapitel stellte ich bei einem Work-in-Progress-Workshop der University of Chicago Law School vor und habe, wie immer, viele Gründe, meinen Kollegen dankbar zu sein, die so viel Zeit darauf verwandten, den Text vorab zu lesen, und sehr gute und vielfältige Fragen stellten, die für die Schlussfassung wesentlich wurden: Dahwood Ahmed, Eric Biber, Jane Dailey, Lee Fennell, Bernard Harcourt, Richard Helmholtz, Todd Henderson, Brian Leiter, Richard McAdams, Eduardo Penalver, Ariel Porat, Eric Posner, Mike Schill, Geoffrey Stone, Laura Weinrib und Albert Yoon.
Ich widme dieses Buch dem verstorbenen Arnold Jacob Wolf, der ein Gigant des amerikanischen Reform-Judentums wie auch in meinem religiösen Leben war. Als einer der klügsten Menschen, die ich kenne, verband Arnold die Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit mit tiefer religiöser Sorge, beides vereint mit einer genialen Gabe zu lehren – unwirsch, zum Wahnsinn reizend, urkomisch, mit einer sokratischen Leidenschaft zur Auseinandersetzung und einer unsokratischen Fähigkeit zur Sympathie und zum Humor. Ich war sehr froh, als er mich anlässlich meiner Erwachsenen-Bar Mizwa im August 2008 segnete. Leider starb er im folgenden Dezember im Alter von 84 Jahren. Arnold war, in einer lange währenden Tradition des KAM Isaiah Israel wurzelnd, einer Reform-Kongregation, ein leidenschaftlicher Anwalt für interreligiöses Verständnis. Er rief gemeinsame Aktivitäten mit christlichen und muslimischen Gruppen ins Leben wie auch mit örtlichen afro-amerikanischen Kirchen, die ihrerseits selber christlich oder muslimisch waren. (KAM ist heute bekannt dafür, direkt gegenüber von Präsident Obamas Haus zu residieren, zugleich nahe dem Haus von Louis Farrakhan [AdÜ: Führer der afro-amerikanischen Bewegung und Neureligion Nation of Islam] und einer großen afro-amerikanischen Moschee.) Wichtige Teile der Liturgie wurden neu geschrieben, so dass die Gemeindemitglieder von den „Völkern der Welt“ singen konnten und nicht nur vom „Volk Israel“.
Wer Arnold zum ersten Mal sah, mochte meinen, er sähe einen der Trolle aus einem zentraleuropäischen Märchen: ein kurzes, rundliches, weißbärtiges Rumpelstilzchen, dessen barsche und schnarrende Stimme zu einem derart zänkischen Charakter passen mochte. Doch während Rumpelstilzchen, verzehrt von Abscheu und Neid, mit seinen matten Augen vorsichtig dreinschaute – so stelle ich mir es zumindest vor –, funkelten diejenigen Arnolds regelrecht, und man sah sehr viel Zuneigung zu den Menschen, jungen wie alten, die er ermahnte, die er schalt und über die er sich lustig machte. („Religion ist eine ernste Sache“, pflegte er zu sagen, „doch diese Gemeinde ist ein Witz.“) Rabbi Eugene Borowitz, sein Altersgenosse, sagte anlässlich der Beerdigung, dass Arnold zunächst und vor allem ein Liebender war – und er fügte hinzu: „Juden zu lieben ist keine geringe Leistung.“ Und diese Leistung sah man zunächst in den Augen Arnolds, weil sie vor allem in echter Neugier bestand und der Bereitschaft, nicht nur den Anderen so zu sehen, wie er war, sondern auch, mit seinen eigenen Fehlern und Schwächen gesehen zu werden. Es gab keine Kritik an Arnold, die er nicht zuerst und höchst schneidend selbst vorgebracht hätte.
Die beiden folgenden Begebenheiten über Arnold erscheinen zunächst widersprüchlich. In seinen Bar-Mizwa- und Bat-Mizwa-Klassen meinte er, wenn sich die Kinder über irgendetwas beklagten: „Es geht nicht um euch.“ Und doch sagte er oft, wie man bei seinem Begräbnis erfuhr, in seinen Tora-Lehrveranstaltungen mit Rabbiner-Kollegen: „Es geht immer um euer Leben.“ War er also inkonsequent? Ich denke, wir können diese beiden Begebenheiten zusammenbringen, wenn wir uns Folgendes klarmachen: In einem höheren Sinne geht unser eigenes Leben nicht um uns selbst. Arnold glaubte an die Introspektion. Er wollte, dass der Text die Menschen zu tieferer Selbsterkenntnis und Selbstkritik brächte. Doch am Ende sagt einem jede Selbsterkenntnis, die diesen Namen zu Recht trägt, dass auch andere Leben so real sind wie das eigene und dass das Leben nicht um einen selbst geht. Man muss vielmehr die Tatsache akzeptieren, dass man die Welt mit anderen Menschen teilt und so handeln, dass es anderen zugutekommt. Gegenüber mit sich selbst beschäftigten Teenagern betonte Arnold den Fokus auf den Nächsten, gegenüber intellektualisierenden Rabbis betonte er die Notwendigkeit der persönlichen Selbstprüfung. Doch die Botschaft ist am Ende die gleiche: Erkenne dich selbst, damit du aus dir heraustreten kannst; diene der Gerechtigkeit und fördere den Frieden.
Das ist auch die Botschaft, die ich in diesem Buch zu übermitteln hoffe.