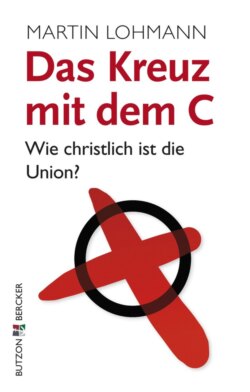Читать книгу Das Kreuz mit dem C - Martin Lohmann - Страница 13
Fundament, kein Fundamentalismus
ОглавлениеWarum das wichtig ist? Wichtig gerade für unser Thema? Weil sich genau an diesen Fragen beziehungsweise deren aktueller Konkretisierung und dem mit dem C im Parteinamen verbundenen Anspruch vielfach jene Diskussion entzündet, die nach der Christlichkeit der Unionsparteien fragen lässt. Wer sich dieser Diskussion aber stellt, sollte – bei aller Kritik an den C-Parteien – sich zunächst einmal vor Augen führen, dass die mit dem besonderen Anspruch gegründeten Parteien niemals vorhatten oder hätten vorhaben können, gleichsam politische Kirchen zu sein oder zu werden. Weder war geplant, kirchliches, also katholisches und evangelisches Gedankengut eins zu eins in die Politik zu übersetzen, noch war und kann geplant sein, losgelöst von kirchlichen Überzeugungen eine Art Kirchenersatz auf politischer Bühne zu sein. Es gibt also letztlich so etwas wie eine abgefederte Unabhängigkeit der Abhängigkeiten. Was zu den keineswegs nur von C-Politikern definierten Grunderkenntnissen des deutschen Staates und seiner Fundamente gehört, ist von Politikern erklärt worden. Im Parlamentarischen Rat saßen politisch Interessierte und Politiker, nicht aber Moraltheologen oder Dogmatiker. In ihrer christlichen Freiheit oder – um Martin Luther zu bemühen – in der Freiheit eines Christenmenschen legten sie das Fundament für die gesellschaftliche Ordnung wie auch das Fundament für die Parteien.
Dieses Fundament ist aber weder eine Einladung zum toleranzfreien Fundamentalismus noch eine von jeder Vorgabe freie losgelöste Neudefinition dessen, was das C bedeutet. Hinzu kommt auch dies, worauf nicht nur Oswald von Nell-Breuning hinwies: Den Gründern, die „ihre Partei als christlich bezeichneten und das C in deren Namen aufnahmen, war es zweifellos darum zu tun, im Gegensatz zum integralistisch überbetonten Konfessionalismus den interkonfessionellen Charakter ihrer Gründungen herauszustellen; insofern brachte das C mehr das Negative, die Absage an die konfessionelle Trennung, zum Ausdruck als ein positives Bekenntnis zu christlichen Normen und Werten, die man ganz selbstverständlich als verbindlich ansah und annahm, sodass es eines eigenen Hinweises darauf nicht bedurfte.“
Diese Selbstverständlichkeit ist offenbar weithin verdunstet. Heute erscheint es daher schwieriger als früher zu sein, beurteilen zu wollen, was gut und böse, was richtig und falsch nach christlichem Glauben ist. Christliche Sittenordnung – das ist ein nicht mehr verstandener Begriff. Vergessen werden darf übrigens nicht, dass die in der Präambel des Grundgesetzes definierte Verantwortung vor Gott und den Menschen nicht ausdrücklich als ausschließlich christlich gemeint war und ist. Diese Verantwortung schließt alle Gottgläubigen ein, jedenfalls alle, die sich dem alttestamentlichen Gott verpflichtet wissen. Das sind Juden, Christen und Muslime. Letztlich sind es alle, die davon überzeugt sind, dass die Menschenwürde unantastbar sein und bleiben muss und es unverletzliche wie unveräußerbare Rechte geben muss. Der Staat kann nur als humaner funktionieren, wenn er die Natur des Menschen und seiner ihm vorgegebenen Rechte und Pflichten berücksichtigt, sie also nicht der Beliebigkeit anheimstellt. Wo aber sind die Grenzen? Wie weit geht die Freiheit eines Christenmenschen? Wie christlich darf, wie christlich kann und wie christlich müssen die Unionsparteien sein? Gestern, heute und morgen?
So gesehen und weil es keinen Fundamentalismus auf der Grundlage des so beschriebenen Fundamentes geben kann, ist stets zu Recht betont worden, dass es eine christliche Politik nicht geben kann. Wohl aber eine Politik aus christlicher Verantwortung. Wenn schon der Staat mit seinem Grundgesetz weltanschaulich neutral, aber keineswegs wertneutral ist, um wie viel mehr darf und muss ein Anspruch an die C-Parteien formuliert und eingefordert werden? Müssen, dürfen und sollen sie sich unterscheiden von anderen? Wenn ja, wo und wie? Haben sie mehr zu bieten als andere? Können und sollen sie klarer und zugleich toleranter sein als andere politische Parteien? Stehen sie nicht vor einer neuen Herausforderung zur Klarheit, wenn allenthalben erkannt wird, dass – wie es selbst die Zeitschrift „Stern“ bemerkt – es eine neue Sehnsucht nach alten Werten in der Gesellschaft gibt? Stimmt die Beobachtung des Bundesverfassungsrichters di Fabio, dass vor allem die 68er-Bewegung traditionelle und bewährte Werte deformiert und zerstört hat und zu einer „fatalen gesellschaftlichen Bindungslosigkeit“ führte? Ist seine Beschreibung richtig, dass es unserer Gesellschaft „an Identität und innerer Stärke“ fehlt, um in der „Auseinandersetzung mit anderen Kulturen bestehen zu können“?