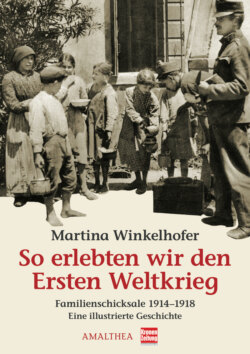Читать книгу So erlebten wir den Ersten Weltkrieg - Martina Winkelhofer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wer bezahlt den Krieg?
ОглавлениеJeder Krieg kostet enorm viel Geld. Die ungeheuren Summen, die ein Krieg verschlingt, können auf drei Arten aufgebracht werden: durch Anleihen, Steuern oder mit Hilfe der Notenpresse, sprich: durch Inflation. Österreich-Ungarn finanzierte den Krieg zu drei Fünfteln aus Kriegsanleihen, das heißt, der Staat borgte sich das Geld für die Kriegsführung von seinen Bürgern. Die österreichische Finanzverwaltung legte acht Kriegsanleihen auf, mit 5,5 Prozent bis 6,25 Prozent verzinst, die zwischen 1920 und 1930 zurückgezahlt werden sollten. Mit diesen acht Kriegsanleihen konnte der Staat rund 35,1 Milliarden Kronen einnehmen. Die Anleihen waren vor allem zu Beginn ein enormer Erfolg, schon die erste österreichische Kriegsanleihe erbrachte viermal so viel Geld wie die erfolgreichsten Anleihen in Friedenszeiten.
Österreich-Ungarn finanzierte den Krieg zu mehr als der Hälfte über Kriegsanleihen. Die Helden der Lüfte – ein beliebtes Propagandamotiv
Die Aufteilung der Anleihezeichner ergibt ein aufschlussreiches Bild: Von allen Nationalitäten der Habsburgermonarchie kauften die Deutsch-Österreicher die meisten Anleihen, sie hatten auch das meiste Geld. Und bei dieser Gruppe war es das hohe Bürgertum, das – vereinfacht gesprochen – den Großteil des Geldes aufbrachte, das der Staat für die Kriegsführung benötigte. Das Bürgertum (und zwar das mittlere wie das sehr vermögende Großbürgertum) war im Besitz von 80 Prozent aller Kriegsanleihen, während die kleinen und ganz kleinen Zeichner nur 20 Prozent der gezeichneten Summe deckten. Diejenigen, die die Kriegsanleihen zeichneten, gehörten nach dem Krieg zu den größten ökonomischen Verlierern. Das Bürgertum, das sein gesamtes Vermögen in die vermeintlich sicheren Schatzpapiere gesteckt hatte (schließlich glaubten alle an einen sicheren Sieg), verlor nach Kriegsende, neben allen persönlichen Tragödien, die es zu bewältigen galt, auch sein gesamtes oft über Generationen angehäuftes Vermögen.
Über 35 Milliarden Kronen wurden durch Kriegsanleihen aufgebracht
Den Krieg über Steuereinnahmen zu finanzieren, kam von Anfang an nicht in Frage. Das alt-österreichische Steuersystem basierte vorwiegend auf Verbrauchersteuern, nicht auf Vermögens- oder Einkommensteuern. Die großen Einnahmen wurden nicht bei den Vermögenden eingehoben, sondern fast ausschließlich über Massensteuern. Jedes Genussmittel war extrem hoch besteuert (deshalb führte etwa auch jede Erhöhung des Zuckerpreises stets zu Ausschreitungen), die Steuerlast war extrem ungleich verteilt. Geringverdiener zahlten indirekt einen höheren Steuersatz als Vermögende. Diese indirekten und extrem hohen Steuern konnten kaum mehr erhöht werden. Und Kriegssteuern einzuführen, war unpopulär und hätte die offizielle Propaganda konterkariert, schließlich rechnete man fest mit einem Sieg. Die Kosten hätten dann natürlich die Kriegsverlierer in Form von Reparationszahlungen zu tragen gehabt.
Also blieb nur mehr die Kriegsinflation: Zu zwei Fünfteln wurden die Kriegskosten in Österreich-Ungarn über die Geldschöpfung finanziert. Die Regierung machte von Anfang an von der Möglichkeit der Verschuldung bei der Notenbank ausgiebig Gebrauch, und zwar viel stärker als andere Staaten. Bereits in den ersten Kriegsmonaten hatte sich die Geldmenge verdoppelt, dafür stiegen im ersten Kriegsjahr die Lebenshaltungskosten um 70 Prozent. Schließlich war das Geldvolumen in den vier Jahren zwischen Kriegsbeginn und Kriegsende von 3,4 Milliarden auf 42,6 Milliarden Kronen gestiegen.
»Konnt’ ich auch nicht Waffen tragen, half ich doch die Feinde schlagen« – Kinderanleihen
Kriegsanleihen waren eigentlich für Kinder unerreichbar, schließlich mussten mindestens 100 Kronen erlegt werden. Aber 1915, in der dritten Runde der Kriegsanleihen, fand man einen Weg, wie man sogar aus den Kindern Geld pressen konnte: Manche Banken boten Kindern und ihren Eltern an, den fehlenden Betrag auf diese 100 Kronen über ein Darlehen zu finanzieren. Die Kinder konnten dieses Darlehen dann in den kommenden 15 bis 30 Jahren zurückzahlen. In Wien und Niederösterreich zeichneten über 80 000 Kinder diese Kinderkriegsanleihe, für viele war es die erste Finanztransaktion ihres Lebens. Sie banden damit ihre zukünftigen finanziellen Ressourcen an den Habsburgerstaat. Unter dem fragwürdigen Motto »Konnt’ ich auch nicht Waffen tragen, half ich doch die Feinde schlagen« boten diese Anleihen so auch Kindern eine Möglichkeit, sich am viel propagierten »Dienst am Vaterland« zu beteiligen.