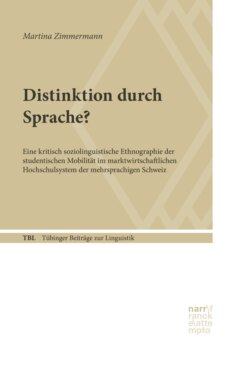Читать книгу Distinktion durch Sprache? - Martina Zimmermann - Страница 10
Die ersten Universitates im christlichen Europa: 1180–1400
ОглавлениеIhren Anfang nahm die Universität in Bologna und Paris. Die Universität Bologna (offizielles Gründungsjahr 1088) fasste die bereits bestehenden Rechtsschulen zusammen, die aufgrund von immerwährenden Konflikten zwischen Papsttum (Kirchenrecht), Bürgertum (kommunales Recht) und Kaisertum (Herrscherrecht) entstanden waren. In Paris hingegen wurden um 1200 verschiedene theologische Schulen organisatorisch zusammengefasst; der Papst erachtete Paris als künftiges universitäres Zentrum der europäischen Theologie und trug mit der „licentia ubique docendi“ dazu bei, dass alle Studenten, die den Magister erlangt hatten, an jeder europäischen Universität lehren konnten. Er animierte somit den Lehrkörper bereits in den universitären Anfängen zur Mobilität, erhoffte er sich dadurch doch eine Verbreitung seiner theologischen Lehre. Gemeinsam war den frühen Universitäten, dass sie aus einer bestimmten geistigen und sozialen Situation entstanden, als nämlich „herkömmliche Kloster- und Domschulen den fortschreitenden Erkenntnis- und Lehrmethoden der Scholastik und den Ansprüchen der wissenschaftstreibenden Bevölkerungsgruppen, vornehmlich Kleriker und in zunehmendem Masse auch Laien, nicht mehr genügten“ (Boehm & Müller 1983: 12). Lehrer und Scholaren schlossen sich zu Korporationen, also zu einer Art von Berufsgenossenschaften, zusammen. Daher kommt auch die Bezeichnung „universitas“, die für Kommunität steht. Auch wenn in Bologna und Paris Konflikte zwischen Hauptakteuren wie Papst, Bischof, Stadt oder Kaiser ausgetragen wurden, war das Modell der Universität rasch erfolgreich. Beide Universitäten hatten bald Ableger (z.B. in Padua, Siena), und es dauerte nicht lange, bis in Oxford die erste selbständige Gründung erfolgte. Im 13. und 14. Jahrhundert – es gab dann bereits über 30 Universitäten – festigte sich die Organisationsform, und mit der Gründung in Prag (1348) und später in Heidelberg und in Köln erreichte die Universität auch das „jüngere Europa“ (vgl. Moraw 1985). Zwar unterscheiden sich die lokalen Geschichten der einzelnen Institutionen voneinander, jedoch sind alle Gründungen mithilfe der Kirche entstanden. Zu dieser Zeit stand nämlich die Wissenssicherung und -verbreitung im Vordergrund, wobei es darum ging, die „doctrina sacra“ in ihrer Gesamtheit zu erfassen.
Dank der Kirche, dem aufstrebenden Stadtbürgertum und später der Höfe avancierten die universitären Titel und Abschlüsse „zu anerkannten sozialen Merkmalen, Ausweisen höherer Qualifikation und adelsnahen Rangs“ (Weber 2002: 69). Der Adel hiess das Prinzip „scientia nobilitat“ gut und begab sich ebenfalls – wenn meist auch ohne je einen Abschluss zu erlangen – an die Universität. Man könnte hier auch von einer ersten Bildungschance sprechen, die einem breiteren (aber durchaus zur Elite gehörenden) Publikum zuteil wurde und das Vorrecht des adeligen Blutes in Frage stellte. Die Studienvoraussetzungen formaler Art beschränkten sich nämlich darauf, dass derjenige, der zu studieren wünschte, getauft, ehelich geboren und unbescholtenen Leumunds war und ein Mindestalter hatte, in dem er fähig war, Verantwortung wahrzunehmen. Zu den tatsächlichen Studierenden zählten aber neben den Adeligen v.a. die Ober- und Mittelschicht aus dem städtischen Bürgertum. Schwinges (1986) unterscheidet neben den Adeligen, für die das Studium in erster Line einer „berufsunspezifischen Sozialqualifikation“ gleichkam (Seifert 1986: 619) und für die akademische Titel von geringer Bedeutung waren, verschiedene, für die Epoche charakteristische Typen von Studierenden. Der häufigste war der „scholaris simplex“, der während maximal zwei Jahren an der artistischen Fakultät Grundkenntnisse erwarb, ohne einen Abschluss zu erlangen. Schon seltener war der Student, der nach rund zweieinhalb Jahren eine artistische Grundausbildung mit dem Grad des „Bakkalaureus“ abschloss, manchmal sogar darüber hinaus studierte und den Magistergrad erreichte. In wenigen Fällen wurde dann das Bakkalaureat einer höheren Fakultät (Jurisprudenz, Medizin oder Theologie) erworben, im besten Fall verbunden mit der Lehrlizenz und der anschliessenden Doktorwürde. Abgänger der Universität (mit und ohne Abschluss) übernahmen nicht selten Funktionen in Verwaltungen und Kirchenbürokratien und forderten bereits im 13. und 14. Jahrhundert den Geburtsadel heraus (Verger 2000).
Gemeinsam war den Studierenden ihre Prägung aufgrund der Bildung. Das relativ einheitliche Sach- und Orientierungswissen, v.a. im Bereich der Jurisprudenz und der Theologie, fand in der „lectio“ (im vom Klosterbetrieb übernommenen 45-Minuten-Rhythmus) ebenso Verbreitung wie die Latinisierung und Standardisierung des Denkens und der Kommunikation (auf Grundlage der Schulung in Grammatik und Logik) (vgl. Weber 2002: 70). Die Studierenden nahmen zum Teil weite Wege auf sich, um in den Genuss universitärer Bildung zu kommen. Die studentische Wanderung war in den meisten Fällen auf das Fehlen einer einschlägigen Ausbildungsstätte in der Region zurückzuführen. So begaben sich bspw. deutsche Studierende und aufstrebende Junggelehrte vor der Errichtung der Universität Köln häufig nach Bologna, Paris oder Padua (Fisch 2015). Die gemeinsame Prägung, die Studierende an den Universitäten erfuhren, wurde durch die studentische Wanderung verbreitet und trug zur Europäisierung bei.
Unterrichtet wurden die Studierenden allerorts von einem Lehrkörper, der mehrheitlich aus Klerikern bestand und aus Pfründen bezahlt wurde. Im Allgemeinen war die Vergütung jedoch nicht prioritär, „Scientia donum Dei est, unde vendi non potest“1 stand im Vordergrund. Oft reichten diese Einkünfte aber kaum, weshalb die Lehrenden von ihren Studierenden „Collectae“ oder Examensgebühren verlangten (Verger 2000). Die Unterrichtenden waren somit immer abhängig von Herrschern und deren Mass an finanzieller Unterstützung. Ganz generell beeinflussten die Herrscher das universitäre Geschehen erheblich. Ihnen stand es zu, die Institutionen privilegiert zu behandeln, d.h. sie etwa bei den Steuern entlasten oder ihnen das Verleihen bestimmter akademischer Grade zu erlauben (Nardi 1993). Ebenso konnten sie Verbote aussprechen, an einer bestimmten Universität zu studieren (Kaiser Friedrich II. etwa verbot 1226 das Studium und die Lehre in Bologna im Zusammenhang mit seiner Absicht, in Neapel Kader fürs Königreich Sizilien auszubilden.) oder wichtige Vorschriften für den höheren Unterricht durchzusetzen (So schickte Papst Georg IX. 1234 Weisungen nach Bologna und nach Paris, wie die Lehre dort auszusehen habe.). In Anbetracht dieser (hier skizzenhaft dargestellten) Macht, die den Herrschern zukam, können Hochschulen bereits in den Anfangszeiten nicht als „autonome Gebilde, sondern müssen als gesellschaftliche Institutionen“ (Prahl 1978: 10) betrachtet werden, die in den damaligen Kontext der Weltmächte Papsttum und Reich eingebunden waren.
In der damaligen Eidgenossenschaft sind bis 1400 keine Universitätsgründungen zu verzeichnen. Gewiss existierten bereits institutionalisierte Gemeinschaften wie etwa religiöse Bruderschaften. Deren Lehrer und Scholaren schlossen sich aber bis 1400 nicht ausserhalb von Abteien oder Bischofskirchen zusammen. Studierende aus der heutigen Schweiz besuchten vorwiegend die bereits gegründeten Universitäten im heutigen Italien und Frankreich.