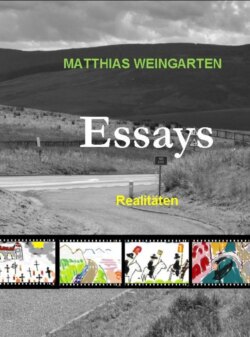Читать книгу Essays - Matthias Sprißler - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinkaufsgeschichte(n)
Milchmann
Oberschwaben 1975, vormittags 11 Uhr. Von der während der Arbeitszeit ruhigen Straße klingt mehrfach der Klang einer Glocke in die Häuser und Wohnungen der Umgebung. Verkehrslärm gab es kaum und die ihrer Hausarbeit nachgehenden Erwachsenen, damals fast nur Frauen, warteten um diese gewohnte Zeit schon auf den Klang der Glocke.
Der Milchmann war gekommen. In sich ruhend, freundlich, runder Kopf und grauer Arbeitsmantel So stand er vor der geöffneten seitlichen Schiebetür seines VW Busses, Modell 60er-Jahre „Bully“ und schwang seine Glocke.
Der Wagen selbst war bis auf den letzten Millimeter ausgenutzt und mit dem Sortiment eines gut sortierten Lebensmittelgeschäftes gefüllt. Wie es der Mann geschafft hat, ohne Computer den Überblick zu behalten, nachmittags die verkauften Dinge nachzufüllen und überhaupt zu wissen, wo was war, ist auch aus der Erinnerung noch erstaunlich.
Auf dem Beifahrersitz stand der Korb mit frischen Brötchen, den Vormittag über bei erhöhter Nachfrage immer wieder beim Bäcker aufgefüllt. Das Hauptprodukt, das ihm auch den Namen gab, die Milch, befand sich offen in einer sicher einen Meter hohen blechernen Milchkanne, die auf einem dämpfenden Brett offen im VW-Bus stand. Neben der Kanne lagen blecherne Schöpfbecher, ein Achtel, ein Viertel, ein Halb.
Dann kamen sie aus ihren Häusern, bei jedem Wetter. Frau Müller und Frau Maier, Frau Schulze und Frau Schmidt. Im Halbkreis standen sie an der offenen seitlichen Wagentür um den Milchmann, wie Planeten auf der Umlaufbahn. Und sie plapperten. Plapperten bis auf diejenige unter ihnen, die gerade bedient wurde. Frau Maier und Frau Müller redeten über ihre Kinder, Frau Schulze und Frau Schmidt über die Enkel. Frau Maier mit Dauerwelle, Frau Schulze mit Lockenwicklern. Frau Müller in Cordhose, Frau Schmidt im rosenbemusterten Hausarbeitsschürzenkleid. Falls die Themen erschöpft waren, kein Problem, der Milchmann führte auch Illustrierte. Und natürlich alles, was die Familie zum Überleben brauchte: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, und dazu auch Nudeln und Reis und vieles andere.
Mit seinen Schöpfgefäßen füllte er die kühle Milch in die Milchkannen der Kunden. Frische offene Milch, kurz zuvor in der Molkerei abgefüllt, nicht homogenisiert und auch nicht entrahmt. In der Henkelkanne wurde die Milch ins Haus getragen, danach in Porzellankannen umgefüllt und mit Plastikhäubchen verschlossen.
Nur samstags war alles anders. An diesem Tag kam der Milchmann nicht in die Straßen. Samstags kamen die Kunden und vor allem auch deren größere Kinder zu ihm, in seinen Laden. Fünf Stufen hinauf, Tür geöffnet, schon standen die Kinder mitten im Laden, kaum größer als der Bulli, Vollsortiment, frische Milch, große Waage, der Milchmann im grauen Mantel, seine Frau mit weißer Schürze. Gekauft haben die Kinder dasselbe wie die Mütter an den anderen Tagen: Eine Kanne frische Milch, die Kleinigkeiten, die in der Küche gerade fehlten und dann noch die Spezialität des Hauses: Brausestängelchen aus großen Gläsern, verpackt in kleine Tütchen wie aus dem eigenen Kaufladen. Und wenn gerade kein Kunde im Laden war, konnte Milchmanns Frau direkt durch eine offene Tür vom kleinen Ein-Raum-Laden zum Ausruhen, Kochen oder Bügeln in die Kaufmannswohnung wechseln.
Schulbeginn
Oberschwaben 1975, mittags. The same procedure as every year. In allen Räumen war sie zu hören, die Klingel. Heiß ersehnt, aber unbestechlich. Jeden Tag zur selben Zeit, auch am ersten Tag im neuen Schuljahr. Die Schulklingel. Wie eine Herde dahindrängelnder Rentiere verließen die Schüler ihre Schule. Gingen zum Mittagessen nach Hause. Mensen gab es nur für Studenten, deren Mütter konnten sie schließlich nicht mehr bekochen. Und so wie die Schüler in Herdengröße aus dem Schulhaus strömten, so folgten sie noch am gleichen Tag dem Ruf der Innenstadt. Allein, mit Freunden oder Geschwistern oder mit Eltern oder Großeltern. Jedes Kind führte eine Liste mit sich; die Gesamtheit der Listen deckte sich mit dem Katalog aller lieferbaren Schreibwaren oder übertraf gar das Lieferprogramm der deutschen Industrie. Je ausgefallener die Wünsche des Lehrers, je unerfüllbarer seine Erwartungen, je teurer seine Vorstellungen, desto höher fühlte er sich aus dem großen Kollegenkreis herausgehoben, in den Olymp der Bildung hinaufgehoben.
Notenhefte in A 5 senkrecht als Doppelheft – acht Geschäfte im 10 km – Radius hatte er abgeklappert, bis sich der neue Musiklehrer sicher war, am nächsten Tag die gesamte Klasse wegen unzureichenden Materials rüffeln zu können.
Klassenarbeitsumschläge in violett, rosa oder orange? Wer als Lehrer der üblichen Farben überdrüssig war und dennoch zur Erhaltung der Ordnung seines Arbeitszimmers ein auch von Analphabeten erkennbares Ordnungssystem benötigte, hatte keine andere Wahl. Nur die entsprechende Nachfrage würde die Industrie dazu bewegen, ihr Spektrum an Umschlagfarben lehrergerecht zu erweitern. Und wenn die Farbe, wie alle Umschläge in den Formaten A5 und A4 erhältlich, dann doch lieferbar war, wechselte man einfach auf A6. Das gab es dann doch nirgendwo.
Ansonsten war alles vorrätig, im großen Schreibwarenladen am Ort. Bis auf die Eingangsstufen und den Gehweg reichte die Schlange der Schüler und Eltern. Dann stand man endlich im Laden. Genauer gesagt man stand nebeneinander an einer langen Holztheke, hinter der eine ganze Reihe von Verkäuferinnen, meist ältere Damen, die Merkzettel der Kinder und die mündlichen Wünsche entgegennahmen. Kariert großes Karo, Doppelheft, Rand außen, Rand weiß; Bleistift 2 HB, Zeichenblock holzfrei A3, alles schafften die Damen herbei. Aus einer raumhohen Holzregalwand mit Schubladen hinter sich, bei der der Kunde nur die blauen Heftstapel der Monopolisten Herlitz und Staufen sehen konnte. Alles kam auf den Tisch, auch die Rollenware „Einbindpapier“, aus der sorgfältig die Einbände aus- und dann am Mittelfalz eingeschnitten werden mussten.
Siebenundzwanzig Artikel zusammenaddieren, bezahlen, Platz am Trog freimachen – und morgen mit den Wünschen der restlichen Lehrer wiederkommen.
Schuhe für das Kind
Oberschwaben 1975, später Nachmittag. Schon wieder waren die Schuhe kleiner geworden, mussten wohl oder übel für die schon seit Wochen verdrückten Zehen neue Schuhe gekauft werden. Discountschuhe? Gab es nicht. Amazon? Selbst von George Orwell nicht beschrieben. Blieb nur der Gang in die Stadt, der Vater mit dem Sohne dreißig Minuten, Mutter und Tochter …
Im Schuhgeschäft standen keine Regale zum selbständigen Herausgreifen eines einzelnen linken Schuhs, zu dem man nach Anprobe am linken Fuß und Gefallensbekundung aus der herbeigeschafften Schachtel das rechte Pendant zur abschließenden Probe erhielt. Stattdessen vernahm der Händler aus des Vaters Mund den Wunsch „Halbschuhe“, maß mit einem Kunststoffschieber des Kindes Fuß, stieg eine Leiter hinauf und kam mit zwei Schuhschachteln zurück: Ein Paar Halbschuhe in braun und ein paar braune Halbschuhe. Ein Paar teurer, ein Paar billiger. Das billigere Paar passte. Nahezu immer. Noch ein kräftiger Daumendruck auf die Großzehe und schon war der Kauf besiegelt. Zeigte das Kind Entscheidungsschwäche oder Anzeichen von Verschwendungssucht, musste der Verkäufer in wenigen Sekunden zu psychologischer Höchstform auflaufen. „Was sagen Sie, welcher Schuh passt am besten?“ Der Verkäufer prüfte sorgfältig, wog den Schuh in der Hand, drückte nochmals die Großzehe, ließ das Kind mit beiden Paaren dreimal zur gegenüberliegenden Wand laufen und gab dann sein fachmännisches Urteil ab. Es war der billigere Schuh. Der Kunde war schließlich der König und Kunde war der Vater.
Englische Kathedralen
Die englischen Kathedralen unterscheiden sich von italienischen Domen und deutschen Münstern in wesentlichen Punkten: Zunächst stehen sie oft frei, vom Grün der Domfreiheit umgeben. Keine Piazza liegt vor ihnen, sondern rund herum eine grüne Parklandschaft mit alten Laubbäumen oder einzelnen Grabdenkmälern. Dieses Areal wiederum wird regelmäßig von einem Kranz niedrigerer Collegegebäude begrenzt, bevor sich die städtische Bebauung anschließt. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Türme abgeflacht ohne Spitzdach, sowohl die beiden Frontfassadentürme als auch der typische, gedrungen massige Vierungsturm. Dieser teilt die Kirche auf, wobei der Chor meist auffällig lang ist. Als Material diente warmer heller Sandstein, nicht der dunkle Stein, wie man ihn aus Straßburg, Ulm oder Köln kennt. Erbaut wurden die Kathedralen, beginnend noch unter den Normannen, regelmäßig im 12. bis 13. Jahrhundert in frühem gotischen Stil mit gemäßigten Spitzbögen und zahlreichen Figuren. Zur gleichen Zeit wurde in Deutschland noch in romanischem Stil gebaut, während Italien bereits noch weiter vorangeschritten war. An die Kathedrale schließt sich meist ein Kreuzgang an, ebenso ein Kapitelsaal, das chapter house. Dieses war entweder an den Kreuzgang angebunden oder direkt an das Münster. Viele der Kathedralen verfügten auch über eine eigene Ausfertigung der Magna Carta; auch beherbergen sie häufig Königsgräber. Die meisten der Kathedralen wurden in späteren Jahrhunderten auch nicht zeitgemäß modernisiert: Keine barocken Seitenaltäre, keine Renaissance-Verkleidungen der Säulen. Überwiegend ist die originale Gotik in strenger Reinheit der Formen erhalten. Einem fast unverwechselbaren Fingerabdruck gleich präsentiert sich das große Fassadenfenster mit unterschiedlicher Gestaltung der Ornamente in der Spitze und bisweilen einer darüber liegenden Rosette. Leider ist das menschliche Gedächtnis nicht in der Lage, die Besonderheiten einer jeden Kathedrale nachhaltig zu speichern, weshalb die nachfolgende Zusammenstellung als Krücke für das Gedächtnis angelegt wurde.
Winchester
Winchester besticht durch besonders großzügiges Grün um den Dom und bunte Vierungssteine an der Kreuzgewölbedecke.