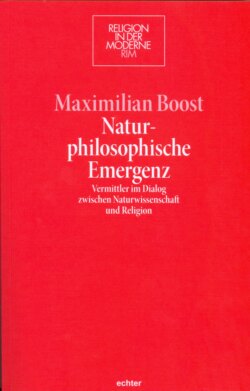Читать книгу Naturphilosophische Emergenz - Maximilian Boost - Страница 34
5 Wiederkehr des Emergenzbegriffs in die Philosophie
ОглавлениеDen Beginn der vierten Phase des Emergentismus – und damit den Start-punkt für die Wiederkehr des Emergenzbegriffs in die Philosophie – bildeten Karl Poppers „The Self and its Brain“ (1977) und Mario Bunges „The Mind-Body Problem“ (1980). Sie entwickelten Ende der 1970er Jahre als erste Philosophen wieder eigene Konzeptionen der Emergenz. Doch gibt es gute Gründe dafür, diese hier nicht näher zu betrachten: Karl Poppers Ansatz weist in verschiedenen Punkten gravierende Schwächen auf. Diese haben ihre Ursache vor allem darin, dass er mit den Werken der Britischen Emergentisten sowie ihrer kritischen Rezeption in keiner Weise vertraut zu sein scheint. Nirgends in Poppers Werk wird – weder inhaltlich, noch durch Zitate oder Rückbezüge – deutlich, dass er die klassische Emergenzdiskussion kennt. Dies führt jedoch zu erheblichen inhaltlichen Schwächen. Stephan hat deshalb ein hartes Urteil über Poppers Emergenztheorie gefällt: So habe Popper offensichtlich völlig unbeeinflusst von der älteren Emergenzdebatte einen eigenen Ansatz verfasst, der sich in keiner Weise in Subtilität und Klarheit mit den klassischen Ansätzen messen könne.194 Es ist zwar davon auszugehen, dass einige der Schwächen der Popperschen Emergenzkonzeption hätten vermieden werden können, wenn er die klassischen Emergenztheorien und die emergenzkritische Literatur in irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen hätte. Da er dies jedoch nicht getan hat, ist seine Emergenzkonzeption so problematisch, dass sich für die moderne geistesphilosophische Diskussion nicht daran anschließen lässt.
Ebenso kann auch Mario Bunges Emergenzkonzeption nicht als Anknüpfungspunkt dienen: Er sieht in seinem „rational emergentism“195 einen Mittelweg zwischen dem – von ihm als irrational empfundenen196 – klassischen Emergentismus und dem Reduktionismus. Doch hat Stephan diese Einschätzung scharf kritisiert: Zum einen ist es sehr weit hergeholt, die sorgfältig ausgearbeiteten Theorien der Britischen Emergentisten als ‚irrational‘ zu bezeichnen. Zum anderen geht Bunge von einem sehr schlichten Begriff des Reduktionismus aus: So behauptet er unter anderem, dass Reduktionisten in der Reduktion nicht die Struktur des Systems berücksichtigen würden, und ferner, dass kollektive Eigenschaften schon dann reduziert seien, wenn nur einige Bestandteile des Systems Eigenschaften dieses Typs hätten.197 Würde er von einem angemesseneren Begriff des Reduktionismus ausgehen, so müsste er einsehen, dass seine Theorie – entgegen seiner eigenen Überzeugung – keine mittlere Position einnimmt, sondern als Form eines reduktiven Materialismus zu sehen ist. Seine Konzeption der Emergenz ist nämlich zu schwach formuliert, um zwischen der explanatorischen Realisierung einer mentalen Eigenschaft und ihrer Emergenz unterscheiden zu können. Für Stephan steht jedoch außer Frage, dass eine mentale Eigenschaft im schwachen Sinne Bunges emergent ist.198
194 Vgl. Stephan (1999b). S. 178-182.
195 Bunge (1977). „Emergence and the Mind“. Neuroscience. Vol. 2. Oxford/New York/Frankfurt: Pergamon Press. S. 503.
196 Vgl. Bunge (1977). S. 502.
197 Vgl. Stephan (1999b). S. 184-185 und Bunge (1977). S. 503-506.
198 Vgl. Stephan (1999b). S. 184-185.