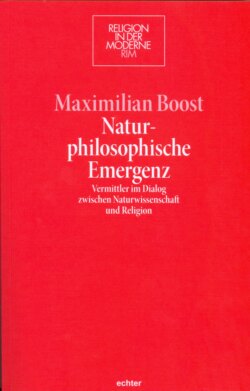Читать книгу Naturphilosophische Emergenz - Maximilian Boost - Страница 36
Оглавление6 Das Körper-Geist-Problem
Wenn über den jüngeren Teil der Wiederkehr des Emergenzbegriffs in die Philosophie gesprochen wird, so bezieht sich dies auf die Philosophie des Geistes. Hier kommt dem Emergenzbegriff in den letzten Jahren wieder vermehrt Aufmerksamkeit als nicht-reduktiv-physikalistischer Lösungsansatz zum Körper-Geist-Problem zu.199 Dieses Problem besteht darin, dass es unter Bedingungen eines naturwissenschaftlich geprägten Weltverständnisses – in dessen Rahmen die Welt als ein komplexes physikalisches System verstanden wird, dessen Grundstrukturen sich mittels der Physik und der auf ihr aufbauenden Naturwissenschaften beschreiben lassen – rätselhaft ist, wo hier der menschliche Geist zu verorten ist und wie dieser kausal wirksam sein soll.
6.1 Dualität von Physischem und Mentalem in der Erfahrung
Nach Godehard Brüntrup, mit dem das Körper-Geist-Problem im Folgenden ausführlicher dargestellt wird200, ist es eine fundamentale Grundannahme der Naturwissenschaften, dass der physische Bereich grundsätzlich durch Gesetzmäßigkeiten strukturiert ist. Diese lassen sich in physikalischer Terminologie formulieren und haben ihre Gültigkeit unabhängig von Zeit, Ort oder anderen Umständen. Sie gelten demnach universal. Dies bedeutet auch, dass gesetzmäßige Zusammenhänge lückenlos sind, da sie durch keinen ‚Bruch‘ in Raum und Zeit gekennzeichnet sein können. Gilt es nun, die Kausalerklä- rung eines physischen Vorgangs zu geben, so kann die Naturwissenschaft dies allein unter Bezugnahme auf Kausalgesetze leisten. Entsprechend ist jedes physische Ereignis allein mittels Kausalgesetzen erklärbar. Dies bedeutet, dass der Bereich des Physischen kausal abgeschlossen ist, da es für die Erklärung nur physischer Ursachen bedarf. Wenn der Bereich des Physischen kausal abgeschlossen ist, dann kann es keine nicht-physischen Ursachen geben, die physische Ereignisse bewirken. Und auch der menschliche Geist scheint in den Augen der Naturwissenschaften prinzipiell durch naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten erklärbar zu sein: So hat sich eine regelrechte ‚Naturwissenschaft des Geistes‘201 herausgebildet, die sich darum bemüht, den menschlichen Geist ebenso zu erforschen und zu erklären wie physische Körper. Unter den Wissenschaften, die hierbei eine Rolle spielen, hat in der letzten Zeit besonders die Neurobiologie – mit ihren zahlreichen neuro-wissenschaftlichen Ablegern – mit spektakulären Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht. Die entscheidende Frage ist, ob man davon überzeugt ist, dass es den menschlichen Geist gibt, und wenn ja, ob er zum physischen Bereich gerechnet wird oder nicht. Dafür, dass es den menschlichen Geist gibt, finden sich in unserer Alltagserfahrung überwältigende Indizien: Wir erfahren uns nicht nur als physische Körper, sondern auch als Träger von Emotionen, Gedanken, Wünschen und Erlebnissen. Doch kommt dieser Sphäre eine Besonderheit zu: So ist sie nicht nur subjektiv, sondern auch privilegiert. Sie kann nur aus der Perspektive der ersten Person erfahren werden und ist keinem Dritten in derselben Weise von außen zugänglich. Entsprechend kann keine noch so gründliche naturwissenschaftliche Beschreibung, die den mentalen Zustand einer Person in physikalischer Terminologie als neurobiologischen (d.h. physiko-chemischen) Zustand zu beschreiben versucht, sagen, wie sich die Person fühlt, was sie fühlt, was sie denkt. Der Bereich des Mentalen bleibt in physikalischen Beschreibungen offenbar in wesentlicher Form unberücksichtigt. Dass mentale und physische Beschreibungen tatsächlich von jeweils völlig unterschiedlichen Dingen sprechen, zeigt sich in solchen Überlegungen, in denen der eine Bereich zugunsten des anderen gedanklich eliminiert wird: Gäbe es keine physischen Objekte, so gäbe es nichts außer dem eigenen Bewusstsein, und die Welt würde zum Traum, zum bloßen Gedanken. Gäbe es dagegen keine mentalen, sondern nur physische Objekte, so würde die Welt nur aus Robotern bestehen, die kein eigenes Bewusstsein haben. Niemand würde diese Welt wahrnehmen. Diese Überlegungen – so absurd sie auch erscheinen mögen – zeigen, wie verschieden die Bereiche des Physischen und des Mentalen sind. Sie scheinen an sich nicht aufeinander angewiesen zu sein, bzw. ist zumindest die Terminologie der beiden Bereiche völlig verschieden voneinander. Andererseits erleben wir jeden Tag aufs Neue, dass beide Bereiche eng miteinander verknüpft sind: So können wir durch mentale Ereignisse Veränderungen in der physischen Welt hervorrufen. Außerdem können wir unseren eigenen Körper willentlich bewegen und über ihn in die Welt der physischen Objekte eingreifen. Umgekehrt verändern auch physische Gegenstände die mentalen Zustände: Dies geschieht vor allem in der Art und Weise, auf die die physische Welt über die Sinne auf unser Empfinden und Denken einwirkt.202
6.2 Formulierung des Körper-Geist-Problems
In der vorangegangenen Darstellung zeigt sich ein Widerspruch, der auf eine Spannung in unserem alltäglichen Weltbild hindeutet: Zum einen trennen wir die Bereiche des Physischen und des Mentalen voneinander und behaupten die kausale Abgeschlossenheit des physischen Bereichs. Zum anderen ist uns eine vielfältige Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen bewusst, bzw. nehmen wir diese als gegeben hin. Dieser Widerspruch lässt sich als Körper-Geist-Problem in einer Trias in Form dreier Prinzipien formulieren:
1. Der Bereich des Physischen ist kausal lückenlos abgeschlossen.
2. Aus der kausalen Abgeschlossenheit des physischen Bereichs folgt die kausale Wirkungslosigkeit mentaler Entitäten.
3. Mentale Entitäten sind kausal wirksam.
Der Widerspruch, der sich ergibt, wenn alle drei Prinzipien gleichermaßen gültig sein sollen, ist offenkundig. Sie können daher nicht alle zusammen wahr sein. Die philosophischen Ansätze, die das Problem des Verhältnisses von Körper und Geist zu lösen versuchen, beruhen deshalb in der Regel darauf, dass sie eines oder mehrere dieser Prinzipien aufgeben, denn nur so lassen sich die verbleibenden ohne Widerspruch für wahr halten. Entsprechend lassen sich die gängigen Lösungsstrategien zum Körper-Geist-Problem danach, welches der Prinzipien der Trias sie fallenlassen, grob in verschiedene Gruppen einteilen. Hieraus ergibt sich wiederum eine zweite Gliederung, gemäß der sich mit Brüntrup vier philosophische Hauptpositionen zum ontologischen Status des Mentalen in der Welt unterscheiden lassen203:
1. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind vom Bereich des Physischen unabhängig. (Dualismus)
2. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind nicht vom Bereich des Physischen unabhängig. Sie sind von den ihnen zugrunde liegenden physischen Entitäten abhängig, ohne auf diese reduzierbar zu sein. (Nicht-reduktiver Physikalismus)
3. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind nicht vom Bereich des Physischen unabhängig. Sie sind von den ihnen zugrunde liegenden physischen Entitäten abhängig und können vollständig auf diese reduziert werden. (Reduktiver Physikalismus)
4. Es gibt keine mentalen Entitäten. (Eliminativer Materialismus204)
Auch diese zweite Gliederung ist nur sehr grob. Sie ist nicht deckungsgleich mit jener aus der Trias. Doch zusammen ermöglichen beide Einteilungen eine differenziertere Einordnung geistesphilosophischer Theorien. Unter den vier Hauptpositionen zum ontologischen Status des Mentalen sind dabei besonders jene von Interesse, die sich als Spielarten des Physikalismus deuten lassen, der Basisontologie für den größten Teil der geistesphilosophischen Theorien des 20. Jahrhunderts. Seine große Attraktivität und weite Verbreitung genießt der Physikalismus dabei nicht zuletzt aufgrund seines Selbstbilds als adäquate philosophische Umsetzung eines naturwissenschaftlich geprägten und fundierten Weltverständnisses. In seinem Rahmen findet auch die Emergenz in der zeitgenössischen Philosophie wieder ihren Ort.
199 Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, die mit den Begriffen ‚Leib‘ und ‚Seele‘ verbunden sind und auf die besonders Heiner Hastedt hingewiesen hat, wird in der Terminologie – wie es heutzutage zunehmend üblich ist – nicht vom Leib-Seele-Problem, sondern vom Körper-Geist-Problem gesprochen und versucht, die problematischen Begriffe zu vermeiden. Dabei werden die Begriffe ‚Körper‘ oder ‚Physisches‘ auf der einen, die Begriffe ‚Geist‘, ‚Psychisches‘ oder ‚Mentales‘ auf der anderen Seite verwendet. [Vgl. Hastedt, Heiner (1988). Das Leib-Seele-Problem. Zwischen Naturwissenschaft des Geistes und kultureller Eindimensionalität. Frankfurt: Suhrkamp. S. 42-61 und auch Brüntrup (1996). S. 13.]
200 Die Ausführungen in diesem Abschnitt sind im Wesentlichen ein Destillat der besonders geeigneten Problembeschreibung durch Brüntrup [Vgl. Brüntrup (1996). S. 9-22. Besonders S. 9-11 und S. 18-20.].
201 Hier sind neben der Neurobiologie exemplarisch Neurolinguistik, Neuroinformatik, Neurophilosophie, Neurotheologie, Neuropsychologie und Neuropädagogik sowie auch die Künstliche-Intelligenz-Forschung zu nennen.
202 Vgl. Brüntrup (1996). S. 9-22. Besonders S. 9-11 und S. 18-20.
203 Vgl. Brüntrup (1996). S. 21.
204 Bei Brüntrup ist der ‚Eliminative Materialismus‘ als ‚Eliminativer Physikalismus‘ bezeichnet.