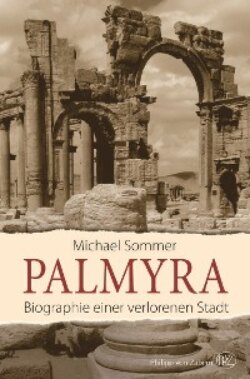Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Palmyra – eine Stadtgeschichte
ОглавлениеDiese Geschichte Palmyras ist sich ihrer Grenzen bewusst. Trotz jahrzehntelanger, intensiver Forschung ist unser Wissen um die antike Stadt lückenhaft und wird es immer sein. Das aber ist nur die eine Seite der Medaille. Jeder Versuch, Geschichte zu rekonstruieren, ist selbstverständlich um Objektivität bemüht. Doch diese Objektivität stößt dort an ihre Grenzen, wo der Horizont und das Erkenntnisinteresse des Forschers berührt sind. Er schafft durch seine Fragen und Begriffe erst das Prisma, durch dessen Brechung die Flut des Materials zu einer sinnhaften Erzählung wird. Die Fragen und Begriffe stammen aus unserer Welt, nicht jener der Antike. Sie sind notwendig inspiriert durch Grunderfahrungen, die jeden von uns betreffen: Globalisierung, Massenmigration, Integrationsprobleme, Entflechtung multinationaler Konföderationen wie der EU, religiöse Fundamentalismen – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Diese Kategorien sind zeitgebunden; eine neue Generation wird neue Fragen stellen und neue Konzepte benutzen. Deshalb wird sie eine neue Geschichte schreiben müssen. Die vorliegende trägt ihr Verfallsdatum wie jedes Produkt wissenschaftlicher Arbeit bereits in sich.
Der antiquarische Ansatz, man könne eine Geschichte um ihrer selbst willen schreiben, ist so unrealistisch wie uninteressant. Jede Geschichte bezieht Relevanz erst daraus, dass sie einer Gegenwart etwas zu sagen hat. Und jeder Historiker bezieht die Kategorien, mit denen er arbeitet, aus seiner eigenen Epoche; die Frage ist nur, ob er sich dies eingesteht oder nicht. Dringend geboten ist deshalb auch für die Geschichte Palmyras eine Hermeneutik mit der Einsicht, dass Erkenntnis nicht allein aus den Quellen entsteht, sondern belastbarer Begriffe bedarf, über die sich Forscher Rechenschaft ablegen müssen. Diese sind bis dato Mangelware. In der einschlägigen Forschung überwiegen, um mit Max Weber zu sprechen, die Stoffhuber, Sinnhuber sind dünn gesät. Die Sinnhuber können, wenn ihr Faktenwissen lückenhaft ist, die Bodenhaftung verlieren.25 Die Stoffhuber laufen Gefahr, sich mit ihren unscharfen Begriffen in hermeneutischen Zirkeln zu verrennen: Wer in Palmyra altorientalische Kulte sucht oder aber die Institutionen einer griechischen Polis, wird unweigerlich fündig werden, wenn er nur das Material befragt.
Doch weder die Polis und ihr Institutionengefüge noch ein Kult, gelte er dem Arṣu oder dem Bel, entsprechen historischen Wirklichkeiten. Sie sind bloße Idealtypen, die Forscher erst in ihren Köpfen schaffen, um die Wirklichkeit daran zu messen.26 An Schärfe gewinnen Idealtypen dann, wenn möglichst viele historische Phänomene in ihre Konstruktion mit einfließen. Das gelingt durch einen breiten historischen Horizont und durch Theorien als Hilfsmittel der Erkenntnis. Deshalb wird in dieser Geschichte Palmyras dem Variantenreichtum von politischen Ordnungen, sozialen Organisationsformen und Wirtschaftssystemen in der Levante und im Mittelmeer seit der Bronzezeit so viel Beachtung geschenkt.
Keine Geschichte erschließt sich ohne Kenntnis ihrer geographischen Bedingtheiten. Der spezifische Naturraum der Syrischen Wüste schaffte überhaupt erst die Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich hier ansiedeln, Viehzucht, Landwirtschaft und Fernhandel betreiben konnten. Das Relief machte die Wüstensteppe passierbar, Bodenqualität und Hydrologie legten in dem ariden Raum fest, wo die Grenzen menschlicher Siedlungstätigkeit lagen. Doch zeigte sich schon früh, dass solche Grenzen nur zum Teil durch die Geographie vorgegeben waren. Entscheidender Faktor war die Politik: Wo Imperien und gemischt sesshaft-nomadische – polymorphe – Gesellschaften stabile Bedingungen schufen, stieg die Wahrscheinlichkeit sprunghaft an, dass Menschen sich auch in marginalen Räumen häuslich niederließen. In der Oase Tadmur war diese Voraussetzung spätestens in der mittleren Bronzezeit gegeben (Kapitel II).
Indes lagen die großen Zivilisationszentren der Bronze- und noch der Eisenzeit nicht in der Levante, im Großraum Syrien, sondern anderswo: in Mesopotamien, Ägypten und später auch Kleinasien. Die Levante war in der Regel gleich mehrfache Peripherie großer Reiche, deren Machtbasis in den Flusstälern oder im anatolischen Bergland lag. Hier kreuzten sich allerdings die Fernhandelswege, auf denen Rohstoffe und Fertigwaren zwischen den großen Reichen hin- und hertransportiert wurden. Eine Schlüsselrolle spielten in diesem großräumigen Güteraustausch in der Bronzezeit Handelsplätze wie das anatolische kārum Kaniš und die großen Institutionen von „Palästen“ und „Tempeln“, deren Beauftragte die Händler waren. Gänzlich andere Wege gingen in der Eisenzeit die Phönizier, die, ausgehend von ihren levantinischen Hafenstädten, das Mittelmeer erschlossen. Die Initiative ging hier von Privatleuten aus. Eine historische Wasserscheide für die Region markiert die Zerschlagung des Perserreiches durch Alexander den Großen und die Etablierung der Diadochenreiche als Nachfolgestaaten, die strukturell die durch Rom erzwungene politische Einheit des Mittelmeerraumes vorbereiteten. Mit dem Hellenismus fasste der Stadttyp der Polis auch in der Levante Fuß, die seither, wirtschaftlich wie kulturell, mehr noch als zuvor den mediterranen Westen mit dem asiatischen Osten verklammerte (Kapitel III).
Palmyra wird als Siedlungszentrum zum ersten Mal just in der Zeit greifbar, als das Seleukidenreich als größte der hellenistischen Territorialmonarchien zwischen den expandierenden Reichen von Parthern und Römern zerrieben wurde, im 2. Jahrhundert v. Chr. Die Stadtwerdung bezog den entscheidenden Impuls aus der Belebung des Fernhandels entlang der Route quer durch die Syrische Wüste und Mesopotamien, zunächst zwischen dem Mittelmeer und Mesopotamien, bald auch unter Einbeziehung des Persischen Golfs und Indiens (Kapitel IV). Seine Lage zwischen den Imperien öffnete den Palmyrenern die Fernhandelsrouten durch das Partherreich, die deshalb eine kostengünstige Alternative zur Südroute durchs Rote Meer sein konnten. Ab der Zeitenwende allerdings machte sich die Präsenz Roms immer deutlicher bemerkbar. Die Integration Palmyras in die Strukturen des Imperiums und der Provinz Syria war ein gradueller Prozess, der sich über Jahrhunderte hinzog und in der Oase tiefe Spuren hinterließ (Kapitel V).
Das sukzessive Hineinwachsen Palmyras in die römische Herrschaftsarchitektur erschließt sich erst durch die Kenntnis ihres Aufbaus und ihrer Mechanismen: einer reaktiven, weitgehend ohne langfristige Strategeme auskommenden Politik des Durchwurstelns zum einen; der faktischen Kraft der Romanisierung, die sich nur als dialektischer, kontingenter und keinesfalls von oben gesteuerter Prozess verstehen lässt, zum zweiten. Per Saldo brachten die ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderte für Vorderasien – und damit für Palmyra – eine deutliche Vergrößerung des römischen Machtbereichs bei gleichzeitig signifikant steigender Herrschaftsintensität (Kapitel VI).
Völlig neue Bedingungen schuf der Kollaps des Partherreiches und seine Unterwerfung durch die Sasaniden in den 220er-Jahren n. Chr. Für Palmyra wie Rom wurde das Umfeld deutlich schwieriger; von 230 bis 260 herrschte fast ununterbrochen Krieg, der in der Niederlage des Kaisers Valerian gegen den Sasaniden Šābuhr und seiner darauffolgenden Gefangennahme gipfelte. Wenn die Römer den Nahen Osten nicht auf Dauer an die Perser verloren, verdankten sie das Palmyra, wo Odainat zum quasimonarchischen Herrscher avanciert war. Allerdings öffnete Odainats Tod wenige Jahre später ein gefährliches Machtvakuum, das seine Witwe Zenobia füllte. Die Situation eskalierte, bis Kaiser Aurelian 272 in zwei Schlachten Zenobia besiegte, Palmyra einnahm und der Autonomie dieser Stadt ein abruptes Ende setzte (Kapitel VII).
Die Ereignisse der Jahre zuvor werfen die Frage nach den strukturellen Bedingungen für den politischen Aufstieg Palmyras auf. Die Oasenmetropole war, bezogen auf die Verhältnisse im römischen Imperium, ein Solitär – vielfältig integriert in die Organisation des Reiches, aber mit Institutionen, die nur bedingt kompatibel waren mit denen einer römischen Stadt. Vieles befand sich im Wandel: Mit der Zeit entwickelten die Palmyrener Techniken des Übersetzens, die es ihnen erlaubten, Anschluss an die römische Welt zu finden, ohne ihre gewachsene Identität preisgeben zu müssen. Oft bot gerade die hellenistisch-römische Tradition ihnen das Vokabular, um dieser Identität Ausdruck verleihen zu können, deren Kern die nomadische Vergangenheit und die tribale Zugehörigkeit der meisten Oasenbewohner war (Kapitel VIII).
Die Geschichte Palmyras endete nicht mit Aurelians Sieg über Palmyra, das ein reiches spätantikes, byzantinisches und islamisches Erbe besitzt. Palmyra entwickelte sich von der Handelsstadt zum Garnisonsort, vom polytheistischen Kultzentrum zum Bischofssitz und von der byzantinischen Grenzstadt zum Versorgungszentrum für eine unter umayyadischer Herrschaft zu neuem Leben erweckte Syrische Wüste. Schließlich wurde es zur Projektionsfläche exotisierender Orientbilder und, im modernen Syrien, den Nationalstaat legitimierender Narrative (Kapitel IX).
Heute wird das Welterbe bedroht, nicht nur von den Bilderstürmern des „Islamischen Staates“, sondern auch durch Vernachlässigung und systematische Ausplünderung (Kapitel X). Viel ist seit der ersten Eroberung der Ruinenstadt durch die Dschihadisten 2015 über Palmyra berichtet und geschrieben worden, aber die eigentliche Geschichte der antiken Metropole spielt weder in schulischen Geschichtskurrikula noch im historischen Gedächtnis des Westens eine Rolle. Dabei lohnen sie ein intensives Studium. Palmyra ist nicht bloß ein Prisma, durch das sich, gerade weil es am äußersten Rand der römischen Welt lag, viel über Rom und sein Imperium lernen lässt; es ist nicht nur die kosmopolitische Kapitale des interkontinentalen Fernhandels, an der sich das Vernetzungspotenzial vormoderner Stadtgesellschaften exemplarisch demonstrieren lässt; Palmyra ist heute vor allem Kronzeugin für die Möglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen multikulturellen Zusammenlebens. Dies ist vielleicht der lohnendste Grund, sich auf Palmyra einzulassen, und die wichtigste Lektion für unser Zeitalter: Dass Einheit in Vielfalt grandios gelingen, aber auch katastrophal scheitern kann, verdichtet sich mit Palmyra in der Geschichte einer einzigen Stadt.