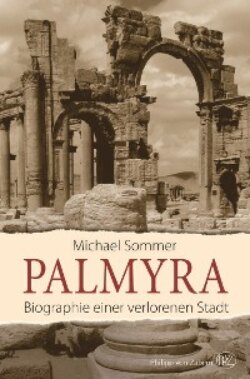Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zeitenwechsel
ОглавлениеDas phönizische Tyros wurde 332 v. Chr. zum Schauplatz einer Episode Weltgeschichte. Der makedonische König Alexander, der zwei Jahre zuvor den Hellespont überschritten und seinen großen Feldzug zur Unterwerfung des Perserreiches eröffnet hatte, wollte in der Inselstadt dem lokalen Gott Melqart opfern. Die Tyrier verweigerten dem König jedoch den Zutritt zu ihrer Stadt und verwiesen stattdessen auf ein Heiligtum auf dem Festland. Der Versuch, im Konflikt zwischen Makedonen und Persern lavierend Neutralität zu wahren, brachte Alexander so in Rage, dass er die Stadt belagerte, die Insel mit einem Damm zu einem Teil des Festlands machte und schließlich eroberte.29
Die Eroberung von Tyros änderte nicht viel an der kommerziellen Bedeutung der Stadt. Sie ebnete aber Alexander den Weg nach Ägypten, das sein nächstes Expansionsziel wurde. In Ägypten wurden die staunenden Menschen zu Zeugen zweier Begebenheiten, die den Fortgang der gesamten antiken Geschichte nachhaltig beeinflussten und auch für Palmyra Bedeutung haben sollten. Das erste Ereignis war die Gründung Alexandreias, einer von Grund auf neuen Stadt im Nildelta, wo sich nach und nach immer mehr Menschen aus Griechenland und Makedonien und auch aus anderen Teilen der antiken Welt niederließen. Alexandreia wurde so zur ersten kosmopolitischen Metropole der Antike, gegründet von Alexander als seine Stadt. Ihr Name sollte den Ruhm des Eroberers unsterblich und gleich dem Leuchtturm, den seine Nachfolger später auf der Insel Pharos bauten, weithin sichtbar machen. Das ägyptische Alexandreia wurde zum Vorbild für Dutzende weitere Alexanderstädte, die überall dort gegründet wurden, wo die makedonischen Soldaten erobernd ihre Stiefel hinsetzten. Und das war erst der Anfang: Die Makedonen, die Alexander in der Herrschaft über Asien nachfolgten, gründeten weitere Städte, die sie nach sich und ihren Familienangehörigen nannten und in denen sie Migranten aus dem Mutterland ansiedelten, Veteranen und Zivilisten. Neben die gewachsenen Städte des Orients mit ihrer 3000-jährigen Tradition trat so ein ganz neuer Stadttypus, erkennbar für jeden Besucher an seinem regelmäßigen Stadtplan mit rechtwinklig sich kreuzenden Straßen. Auch bestimmte Gebäude und Bauensembles gehörten zur Standardausstattung: Theater, Säulenhallen, öffentliche Plätze und, natürlich, Sakralbauten in klassischem Gewand, mit Tympanon, Figurenfries und dorischem, ionischem oder korinthischem Säulenkranz. Die neuen Städte waren in der Umwelt des jetzt von Makedonen beherrschten Orients Fremdkörper: Urbanistisch, politisch, sozial verband sie nichts mit den Traditionen Ägyptens, Mesopotamiens, Persiens oder Zentralasiens.30
Für die Zugezogenen begann mit der Niederlassung in der neuen Heimat ein neues Leben: Die Griechen und Makedonen wurden aus dem kulturellen Milieu ihres Mutterlands gelöst und waren mit neuen Nachbarn und gänzlich von ihren eigenen verschiedenen Lebenswelten konfrontiert; die Einwanderer aus anderen Kulturkreisen hatten sich mit der sozialen und politischen Realität der Polis auseinanderzusetzen, ihrer radikal auch im urbanistischen Konzept sichtbaren Öffentlichkeit und ihrer noch radikaleren Forderung nach Partizipation aller Bürger. Alte Gewissheiten schwanden und mussten durch neue Selbstvergewisserungen ersetzt werden; die Geborgenheit in traditionellen Gemeinschaften – Familie, Sippe, Stamm – machte einer neuen Emanzipiertheit Platz, aber auch Anonymität und Unsicherheit.31
Das zweite Ereignis wirkte womöglich noch tiefer als die Gründung Alexandreias. Alexander besuchte 331 v. Chr. das Orakel des Gottes Amun in der Oase Siwa, weit in Ägyptens Westen. Von Amun holte sich, so wollte es die Tradition des Nilreiches, jeder neu in sein Amt eingeführte Pharao ein Segen verheißendes Orakel. Doch auch bei den Griechen war der ägyptische Gott kein Unbekannter: Amun identifizierten sie mit ihrem Zeus; das Orakel in Siwa genoss in Hellas höchstes Ansehen und war kaum weniger nachgefragt als die heimischen Heiligtümer von Delphi und Dodona. So war es nur konsequent, dass Alexander dem Gott seine Aufwartung machte. Wer konnte es ihm verdenken, dass er an die Tradition der Pharaonen anknüpfen wollte, um sich den Ägyptern als ein ihrer würdiger Herrscher zu präsentieren? Doch Alexander ging einen entscheidenden Schritt weiter. Der Historiker Diodor berichtet über das Geschehen:32
„Als Alexander von den Priestern in den Tempel geleitet wurde und den Gott eine Zeitlang betrachtete, schritt derjenige, der die Stellung des Orakels innehatte, ein ältlicher Mann, auf ihn zu und sagte: ‚Freue dich, mein Sohn; nimm diese Anrede auch von dem Gott entgegen.‘ Er antwortete: ‚So sei es, Vater; künftig soll ich dein Sohn genannt sein. Aber sag mir, ob du mir die Herrschaft über die gesamte Welt zuteil werden lässt.‘ Der Priester betrat nun den heiligen Bezirk und rief, während die Träger nun den Gott anhoben und zum Klang der Stimme bewegten, der Gott bewillige ihm mit Gewissheit sein Ansinnen.“
Was genau hier vorgeht, ist nicht mehr sicher zu rekonstruieren. Zum Ritual des Orakels scheint es gehört zu haben, dass der Gott ein physisches Zeichen seines Willens von sich gab. Dass sein Bildnis dazu von Helfern bewegt wurde, scheint weder Alexander noch dem im 1. Jahrhundert v. Chr. schreibenden Diodor viel ausgemacht zu haben. Bemerkenswert ist, dass Alexander bereits jetzt, vor seinem entscheidenden Sieg über den Perserkönig bei Gaugamela, die Weltherrschaft geweissagt und dass er als Sohn des Gottes Amun angesprochen wurde. Beides wird sich nicht einer plötzlichen Inspiration der Priesterschaft von Siwa verdankt haben. Es kann als sicher gelten, dass Alexander bereits mit einer entsprechenden Agenda in Siwa eintraf. Er kam als Makedonenkönig und ging als Gottessohn, dem die Weltherrschaft verheißen war.33
Was für eine Inszenierung! Siwa steht, wie die Gründung Alexandreias, für eine Zeitenwende, allerdings auf einer symbolischen, nicht materiellen Ebene. Mit Siwa ist die Absicht Alexanders manifest, dem Orient seinen politischen Willen aufzuzwingen. Die Imperien der Flusstalzivilisationen sind endgültig Geschichte, die Zukunft gehört den Herren aus dem Westen. Doch während der Osten dem Westen untertan wird, unterwirft sich der Westen auch dem Osten. Der Prozess ist schleichend und weniger augenfällig als die brutale Unterjochung des Perserreiches, die Alexander bis 330 v. Chr. mit militärischer Gewalt verwirklicht; aber er ist um nichts weniger umwälzend und lässt von den gewachsenen politischen Strukturen Makedoniens und Griechenlands kaum mehr übrig als Alexanders Feldzug vom Perserreich. Politisches Gedankengut, das jetzt auch den Westen kontaminiert, ist die Gottessohnschaft – und das heißt im Klartext: Göttlichkeit – des Königs, die im Ideenreich Griechenlands zuvor an keiner Stelle vorgesehen war.
Die Unterwerfung Ägyptens durch Alexander macht lehrbuchartig vor, wie man sich die Eroberung einer Zivilisation durch eine andere vorzustellen hat. Es ist nicht so, dass der Sieger nur ein Trümmerfeld zurücklässt, wo kein Stein auf dem anderen bleibt. Lernen und Inspiration sind beileibe keine Einbahnstraßen: Nirgends steht geschrieben, dass die Unterworfenen künftig so zu leben hätten, wie es die Eroberer vorleben. Die neuen Herren halten für die Ägypter vielmehr ein Angebot bereit, das sie annehmen oder auch ausschlagen konnten. Ohnehin dürfte sich für die übergroße Mehrheit im alltäglichen Leben relativ wenig verändert haben; für einen gewissen Prozentsatz der lokalen Bevölkerung aber boten sich mit dem Neuen Möglichkeiten, die ihnen zuvor verschlossen gewesen waren. Umgekehrt blieben Griechen und Makedonen nicht dieselben, als die sie ins Land gekommen waren. Die „Gottwerdung“ Alexanders in Siwa macht das beispielhaft anschaulich: So wie in der Welt, die er erobert hatte, kaum etwas beim Alten blieb, war auch der König nicht mehr der alte.