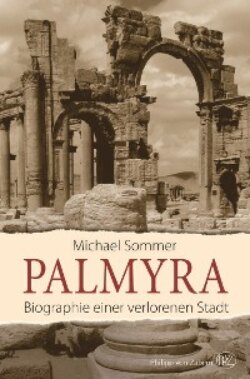Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Palmyrene
ОглавлениеDie Palmyrene ist ein Teil der trockensten dieser sieben Großlandschaften, der Wüstensteppe des östlichen Landesteils.2 Der Großraum erscheint, wie Wirth bemerkt, „mehr der Subökumene als der Anökumene“3 zugehörig, ist also kein reines Nomadenland und auch keine ganz und gar unwirtliche Wüste, die, wie die Sahara oder die Wüste der Arabischen Halbinsel, nur großräumig wandernden Kamelnomaden eine Existenzgrundlage bieten könnte. Die Viehzüchternomaden waren es auch, die in nachantiker Zeit den meisten Teillandschaften ihre heute noch geläufigen Namen gaben: Der Euphrat teilt die weithin ebene al-Gazira, die obermesopotamische „Insel“ zwischen Tigris und Euphrat, von der durch Wadis zerklüfteten, durch das junge Bruchfaltengebirge der Palmyraketten und die Kreidehöhen Innersyriens in zwei ungleiche Hälften zerschnittenen Wüstensteppentafel der Syrischen Wüste, der Šāmīya. Nördlich der grob von Südwest nach Nordost verlaufenden Bergketten liegen ausgedehnte Weideebenen; im Osten, zum Euphrat hin, ein durch tief eingeschnittene Täler zerklüfteter, schwer passierbarer Raum; und südlich angrenzend eine kaum gegliederte weite Ebene, in der die Wadis längst erodiert sind. Im Westen schließen sich an diese Landschaft große Steintrümmerfelder an, die noch weiter westlich in die vulkanischen Hügel des Ḥaurān übergehen.
Inmitten der Šāmīya liegt, am Fuß der Palmyraketten, die Oase Tadmur. Das Umland der Oase ist kein landschaftlich einheitlicher Raum; die Palmyrene wurde erst dadurch zur Palmyrene, dass es ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. in der Oase eine Stadt gab, die alles Land im näheren – und ferneren – Umkreis für sich beanspruchte, dort Kontrolle ausübte und Herrschaft durchsetzte. Sie ist also kein Naturraum, sondern eine politische Landschaft im Schnittpunkt gleich dreier ausgesprochen unterschiedlicher natürlicher Landschaften. Die Grenzen der Palmyrene genau abzustecken, kann deshalb nicht Sinn und Zweck dieses Kapitels sein, sondern gehört in den historischen Zusammenhang des Aufstiegs von Palmyra. Für eine geographische Bestandsaufnahme ist es völlig zureichend, die Palmyrene mit der Šāmīya gleichzusetzen.
Palmyra liegt auf 450 Meter Meereshöhe am Südrand der Kreidehöhen, die sich, mit verschiedenen Einzelmassiven (Ǧabal al-Bilʿās, Ǧabal Abyad, Ǧabal Šaʿar, Ǧabal Mēra) von der Oase aus westlich in Richtung Homs erstrecken. Diese Berge sind bis zu 1350 Meter hoch und teils schroff, mit tiefen Taleinschnitten, teils haben sie eher den Charakter sanft ansteigender Hochebenen. Südwestlich von der Oase erheben sich die Palmyraketten, die westlich von Damaskus ins Qalamūn-Gebirge übergehen, das wiederum der nordöstliche Ausläufer des Antilibanon-Hermon-Massivs ist. Trotz seiner bis zu 1400 Meter hoch aufragenden, teilweise recht schroffen Kämme stellt auch dieser Gebirgszug kein eigentliches Hindernis dar, beträgt der Höhenunterschied zum Umland doch nur 400 bis 800 Meter. Zwischen den Kreidehöhen und Palmyraketten erstreckt sich das große Becken des ed-Dau, das von Palmyra aus über einen niedrigen Pass, das „Tal der Gräber“, zu erreichen ist und den bequemsten Weg Richtung Westen bietet.
Die Steppe östlich von Palmyra ist von den tektonischen Bewegungen des westlichen Landesteils weitgehend unberührt geblieben. Wirksam war hier hingegen die erodierende Kraft des Wassers, trotz der auf das Jahr gerechnet geringen Niederschlagsmengen. Im Pleistozän waren noch weite Teile der ebenen Steppe mit Seen bedeckt, die in Form von feinen Sedimentablagerungen ihre Spuren hinterlassen haben. Bis heute finden sich in der Regenzeit zwischen Orontes und Euphrat zahlreiche Salzseen, sebhā genannt, die sich in Senken bilden, aus denen das Wasser nicht abfließen kann. Einer der größten dieser Seen, die sebhā el-Mū, befindet sich unmittelbar südlich von Palmyra. Wasser hat auch das Netz von Wadis gegraben, das die Steppe überall zwischen Palmyra und dem Euphrat zerfurcht. Dort, wo mehrere Wadis zusammenfließen, lagern sich oft Sedimente ab, die von abfließendem Wasser feucht gehalten werden: Solche fruchtbaren Inseln am Grund von Wadis werden von den Einheimischen fayda genannt.
Die Steppe verändert im Jahreszyklus gründlich ihr Gesicht. Entsprechend dem noch mediterran beeinflussten Klima gibt es zwei Jahreszeiten: einen heißen und sehr trockenen Sommer mit Tagestemperaturen von 35 bis 40 Grad, aber, mit 15 bis 20 Grad, deutlich kühleren Nächten, sowie einen kühleren und feuchteren Winter. Die Übergangsmonate September/Oktober und April/Mai bringen oft sprunghaft ansteigende Temperaturen und damit heftige Orkane mit Gewittern und Sandstürmen. Wie feucht genau die Winter ausfallen, ist von Jahr zu Jahr verschieden. Bringt der Winter ergiebige Niederschläge, so wächst die Vegetation in der Steppe üppiger, Quellen sprudeln kräftiger und Flüsse führen erheblich mehr Wasser. Immer wieder werden die Bergrandlagen nach starken Regenfällen von plötzlichen Überschwemmungen heimgesucht – so auch Palmyra, wo das Wasser in Sturzbächen die Berghänge hinabfließt, bevor es sich in den nahen Salzsee ergießt.
Das Ökosystem der Steppe ist selbst für kleinste Klimaschwankungen äußerst anfällig. Insofern drängt sich die Frage auf, ob sich die klimatischen Bedingungen in historischer Zeit signifikant verändert haben. Anthropogene Einflüsse – Holzeinschlag, Beweidung, Landwirtschaft, Wasserverbrauch – haben die natürliche Vegetation fast überall stark dezimiert. Noch in der Antike bedeckten ausgedehnte Wälder mit Pinie, Eiche, Ahorn, Zeder und Olive den Westen Syriens; sie wurden nach Osten hin dünner und gingen in ein savannenartiges Grasland über, das heute durch Überweidung praktisch überall zu Steppe geworden ist. Mit der Vegetation veränderte sich, bereits in der Antike, die Hydrologie der Region: Es wurde trockener, weil den Böden die Fähigkeit abhandenkam, Wasser über längere Zeit zu speichern. Allenthalben wandelte der Teufelskreis der Degradation Landschaftsbild und Nutzungspotenzial zum Schlechteren. Paläoklimatische Untersuchungen haben aber ergeben, dass diese menschengemachten Veränderungen einen natürlichen Trend zur Austrocknung verstärkten, der bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. eingesetzt hatte. Alles in allem dürften die naturräumlichen Bedingungen in der Palmyrene heute deutlich ungünstiger sein als in der Antike und selbst noch in osmanischer Zeit.4
Landwirtschaft als alleinige Existenzgrundlage kommt für die Bewohner dieser Zone heute wie damals nur punktuell infrage. Meist sind die Niederschläge mit deutlich unter 200 Millimetern zu gering, als dass sich Regenfeldbau noch lohnen würde. Wo etwas mehr Regen fällt, östlich das Ḥaurān, sind die Böden für Ackerbau ungeeignet. Vielerorts können aber Nomaden oder Halbnomaden durch den Anbau von Feldfrüchten durchaus bedeutende Erträge erzielen und so ihren Speisezettel aufbessern: In der Senke Al-Mazraʿa westlich von Palmyra erwirtschafteten Nomaden in jüngster Vergangenheit bis zu 1,5 Tonnen Weizen und bis zu 3 Tonnen Gerste pro Hektar. Ähnlich hoch lagen die Erträge in einigen der Wadis südlich der Stadt Dair az-Zaur am Euphrat. Im Umfeld der Oasen Qaryatain und Palmyra bessern Bauern die Erträge ihrer Bewässerungskulturen durch Regenfeldbau auf.
Die Syrische Wüste ist in der Palmyrene, auch heute noch, alles andere als tot: Sie ist an vielen Stellen, vor allem im Frühjahr, wenn Niederschläge gefallen sind, überraschend grün. In der Vormoderne gingen Versuche, dem unwirtlichen Lebensraum Nahrung abzuringen, sogar noch bedeutend weiter: Aus römischer, byzantinischer und umayyadischer Epoche stammen Gebäudereste und riesige Zisternenanlagen, die stumme Zeugen menschlicher Siedlungstätigkeit noch weit jenseits der 200-mm-Niederschlagsgrenze sind. Unter den Bedingungen prämoderner Verkehrstechnik lohnte es sich, in solche Siedlungen zu investieren: Sie waren unentbehrliches infrastrukturelles Rückgrat des Fernhandels und wurden mit enormem Aufwand errichtet und unterhalten. Heute, im Zeitalter stetig wachsender Beschleunigung, sind solche Anlagen überflüssig. Die Menschen haben sich aus den unzugänglicheren Teilen der Steppe zurückgezogen.