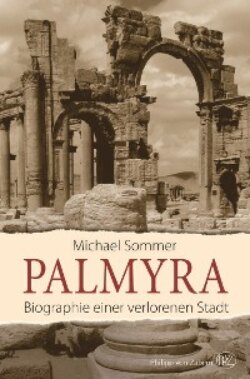Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wiederentdeckung
ОглавлениеAngeregt wurde Hölderlin zu dem Gedicht durch den französischen Orientreisenden und Geschichtsphilosophen Constantin François Comte de Volney (1757–1820), der 1791 seine Gedanken über den Untergang großer Reiche in einem Les Ruines Ou Méditations Sur Les Révolutions Des Empires betitelten Essay publizierte. Der Essay ist eigentlich ein Prosagedicht: Ein Geist nimmt Volneys Ich bei der Hand und erklärt ihm im Angesicht der Ruinenlandschaft mitten in der Syrischen Wüste den Sinn Palmyras und seiner Vernichtung: Zivilisationen kommen und gehen, erklärt der Geist, aber am Ende triumphiere doch nur der Fortschritt über das Überlebte. Die Schrift plädiert angesichts der Französischen Revolution und ihrer Verheerungen für einen vorsichtigen Optimismus, zu dem ihn gerade die Zeugen einer großen Vergangenheit inspirieren. Bei aller Wehmut akzeptiert er, dass das Alte fallen muss, um Neuem Platz zu machen.
Volney hatte selbst auf einer ausgedehnten Reise durch den osmanischen Orient Palmyra besucht und seine Eindrücke in einem Reisebericht niedergeschrieben.2 Freilich wandelte der französische Graf, als er 1783 in den osmanischen Orient aufbrach, längst auf ausgetretenen Pfaden. Bereits von 1160 bis 1173 bereiste der spanische Jude Benjamin von Tudela Syrien, das Heilige Land und Mesopotamien. Er behauptet, auf dieser Reise auch „Tarmod“ besucht zu haben, die Stadt „in der Einöde“, die Salomo gebaut habe. Ähnlich wie in Baalbek habe er dort Gebäude aus „riesigen Steinen“ gesehen. „Tarmod“, womit unzweifelhaft Tadmor gemeint ist – so heißt Palmyra auf Hebräisch –, habe zudem eine jüdische Gemeinde von 2000 Personen beherbergt; sie seien kriegserprobt gewesen und hätten „mal mit den Christen, mal mit den Arabern“ paktiert.3
Benjamin mag wirklich in Palmyra gewesen sein. Ebenso gut ist vorstellbar, dass sein Bericht frei – wenngleich gut – erfunden ist, schließlich scheint die Zahl von 2000 Juden deutlich zu hoch gegriffen. Die ersten europäischen Orientreisenden der Neuzeit, der Italiener Pietro della Valle und der Franzose Jean-Baptiste Tavernier, machten beide noch einen Bogen um die Oase, um direkt nach Mesopotamien und Persien zu gelangen. Offenbar barg die Reise durch die Syrische Wüste große Gefahren, vor allem der Beduinen wegen. Der portugiesische Jesuit Manuel Godinho behauptete immerhin, er sei Palmyra auf seiner Syrienreise 1663 nahe genug gekommen, um Säulen, Türme, Wasserleitungen und ein großes, Salomos Tempel gleichendes Gebäude „aus Marmor“ ausmachen zu können, unzweifelhaft den Bel-Tempel.4 Wenige Jahre nach Godinhos Abstecher in die Syrische Wüste, im Sommer 1678, unternahmen 16 Kaufleute der British Levant Company von Aleppo aus eine Expedition in die Oasenstadt, wurden aber von Stammeskriegern des Emirs Melkam gefangen genommen und erst gegen Lösegeld freigelassen. 1691 kehrten sie zurück; diesmal begleitete sie William Halifax, ein Oxforder Don und Geistlicher, der seit 1688 als Kaplan der britischen Kaufmannskolonie in Aleppo diente. Die Expedition erreichte nach sechstägiger Reise am 4. Oktober Palmyra, wo sich die Reisenden vier Tage lang aufhielten. Am 16. Oktober trafen sie wohlbehalten wieder in Aleppo ein.
Halifax lieferte der Royal Society in London einen ausführlichen Bericht über die Reise, der 1695 in den Philosophical Transactions der Gesellschaft publiziert wurde und in der Behauptung gipfelt, keine Stadt der Welt habe den Ruhm Palmyras überbieten können.5 Ausführlich berichtete Halifax vom Bēl-Tempel und den dort sichtbaren „Arabick Inscriptions“. Er fuhr fort mit Beschreibungen des dreitorigen Bogens, der Kolonnade, der Moschee im Stadtzentrum und des „Little Temple“, des später sogenannten Baʿal-Šamen-Tempels. Der Bericht schließt mit einem Eindruck aus dem Tal der Gräber, dessen Bauten er für Kirchtürme hielt. Halifax nahm Inschriften auf, und ein anonymer Angehöriger der Expedition zeichnete eine Stadtansicht von Südosten, die später als Kupferstich in den Philosophical Transactions erschien.6 Während der gleichen Expedition entstand auch der Entwurf für ein Gemälde, das der niederländische Künstler Gerard Hofstede van Essen 1693 anfertigte und das in großem Format ebenfalls ein Panorama der Ruinenlandschaft zeigt.7
Nachrichten von der Expedition, die sich in Windeseile in ganz Europa verbreiteten, und vor allem die Publikation in den Philosophical Transactions lösten einen ersten Palmyra-Boom in Wissenschaft und Künsten aus. Forscher begannen, systematisch die Inschriften der antiken Stadt zu sammeln und sich mit ihrer epigraphischen Hinterlassenschaft zu beschäftigen; Reisende, darunter die Franzosen Giraud und Sautet (1706) sowie ihr Landsmann Claude Granger (1735), zog es in immer größeren Scharen in die Wüste, wo sie die Ruinen bestaunen wollten; Palmyra beschäftigte die Phantasie von Malern und Schriftstellern; Zenobia eroberte die Opernbühnen Europas.8 Den nächsten Durchbruch markiert die Orientreise der britischen Altertumsforscher Robert Wood und James Dawkins. Die beiden Wissenschaftler, in deren Tross sich auch der italienische Architekt, Bauingenieur und Zeichner Giovanni Battista Borra befand, erreichten Palmyra im März 1751. Anders als die Reisenden zuvor, die hauptsächlich Impressionen aus der Oasenstadt geliefert hatten, machten sich Wood, Dawkins und Borra daran, ihre architektonischen Zeugnisse präzise zu vermessen und bauzeichnerisch zu erfassen. Die von Woods verantwortete, 1753 zugleich in England und Frankreich erschienene umfangreiche Publikation setzte, gemeinsam mit ihrem Zwillingswerk über Baalbek, Maßstäbe in der Dokumentation antiker Architektur. Zugleich übte sie, ähnlich wie die akribischen Studien des italienischen Architekten Giovanni Battista Piranesi, großen Einfluss auf die neoklassische Architektur Europas aus.9
A View of the Ruines of Palmyra alias Tadmor taken on the Southern Side, anonymer Kupferstich, Phil. Trans. R. Soc. Lond. 218 (1695), 125.
Nur ein Jahr nach dieser richtungweisenden Arbeit gelang es dem Abbé Jean-Jacques Barthélemy, das palmyrenische Alphabet zu entziffern und damit die zu diesem Zeitpunkt bereits in großer Zahl gesammelten Inschriften lesbar zu machen.10 1785 bereiste der französische Landschaftsmaler und Zeichner Louis François Cassas Syrien und hielt sich einen ganzen Monat in Palmyra auf. In diesen Wochen fertigte er zahlreiche exakte Bauzeichnungen an, unter anderem des Bēl-Tempels, publizierte später aber auch seine Eindrücke in einer phantasievollen Voyage pittoresque, in der er zeitgeisttypisch das „Morgenland“ zur Projektionsfläche romantischer Fremdheitskonstruktionen werden ließ.11 Als erste europäische Frau gelangte Lady Hester Stanhope, die Nichte des britischen Premierministers William Pitt des Jüngeren und selbstproklamierte Herrin von Joun, nach Palmyra. 1813 hielt sie, in ihrer Entourage die Oberhäupter der versammelten Stämme und an der Spitze einer Karawane aus 22 Kamelen, festlich Einzug in Palmyra, wo sie sich als „neue Zenobia“ feiern ließ. Hunderte Mädchen standen auf den Konsolen der Säulen Spalier und schwenkten Palmwedel, während sie die Kolonnadenstraße entlangritt.12
Weder Mädchen noch Palmwedel empfingen die deutschen Archäologen Theodor Wiegand und Daniel Krencker, als sie mit der von ihnen geleiteten Kampagne 1902 in Palmyra das Zeitalter der wissenschaftlichen Erforschung einläuteten. Wiegand, seit 1896 Grabungsleiter in Priene, und der Elsässer Krencker, der sich ihm als Bauforscher angeschlossen hatte, erfüllten nicht nur eine archäologische, sondern auch eine politische Mission des Deutschen Reiches im Imperium der Osmanen, das für die Außenpolitik der europäischen Großmächte zentrale Bedeutung besaß und vor allem seit der Palästinareise Kaiser Wilhelms II. 1898 intensiv von Berlin umworben wurde. 1903 begann der Bau der Bagdadbahn, die maßgeblich durch die Deutsche Bank finanziert wurde, deren Direktor Georg von Siemens Wiegands Schwiegervater war. Krencker und Wiegand, der im Kriegsjahr 1917 noch einmal nach Palmyra zurückkehrte, publizierten, gemeinsam mit anderen Teilnehmern der Expedition, ihre Ergebnisse 1932 in einem zweibändigen Werk, das noch heute Ausgangspunkt jeder Forschung zur Architektur Palmyras sein sollte. Es dokumentiert nicht nur viele der wichtigsten Bauwerke der Stadt – das Diokletianslager, das Theater, den Baʿal-Šamen-, Nebu- und Bel-Tempel sowie die mittelalterliche Zitadelle – in Text und Bild, sondern wartet auch mit dem ersten Plan der Ruinenstadt auf.13
1918 ging das Osmanische Reich als Folge des Ersten Weltkrieges unter. Der Fruchtbare Halbmond wurde im Vertrag von Sanremo 1920 unter den Siegermächten Großbritannien und Frankreich geteilt. Palmyra geriet mit Syrien unter französische Mandatsherrschaft. Deshalb waren es seit den 1920er-Jahren vor allem französische Archäologen, die energisch die Erforschung des antiken Palmyra vorantrieben. 1929 wurde Henri Seyrig zum Generaldirektor der Antikenverwaltung für Syrien und den Libanon ernannt, ihm stand als Inspecteur Daniel Schlumberger zur Seite, wie Krencker ein Elsässer. Gemeinsam mit den Bauforschern René Amy und René Duru nahmen sie den Rückbau der Behausungen in Angriff, die in nachantiker Zeit den Bēl-Tempel in ein Wohnquartier verwandelt hatten, und rekonstruierten das Heiligtum so, wie es bis 2015 zu bewundern war. Bereits 1924 hatte der dänische Archäologe Harald Ingholt begonnen, das gigantische Corpus der palmyrenischen Grabskulptur systematisch zu erforschen.14 Und seit 1925 untersuchte Antoine Poidebard, einer der Pioniere der Luftbildarchäologie, die Syrische Wüste und vor allem die Palmyrene großflächig auf Siedlungsspuren sämtlicher Epochen. Poidebards Luftbilder sind angesichts der umwälzenden anthropogenen Veränderung des Landschaftsbilds seither unschätzbare Zeugnisse einer vergangenen Welt. Die archäologischen Arbeiten ergänzten die intensiven Forschungen des Epigraphikers Jean Cantineau, von dessen Inventaire des Inscriptions de Palmyre 1930 der erste Band mit einer Sammlung der Inschriften aus dem Baʿal-Šamen-Tempel erschien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Federführung bei der Antikenverwaltung der unabhängig gewordenen Republik Syrien. Auf syrischer Seite erwarben sich vor allem der Prähistoriker Adnan Bounni, von 1955 bis 2005 Direktor des syrischen Antikendienstes, und der 2015 von Kämpfern des Islamischen Staats ermordete Ḥālid al-Asʿad, von 1963 bis 2003 Grabungsleiter und Direktor des Museums von Palmyra, bleibende Verdienste um die Erforschung Palmyras. Mit den syrischen Forschern arbeitete in Palmyra eine im engen gegenseitigen Austausch verbundene, ja in Korpsgeist verschworene Gemeinde von Wissenschaftlern, die in ihrer Internationalität geradezu kongenial den kosmopolitischen Geist des antiken Palmyra widerspiegelte: Die französischen Wissenschaftler setzten ihre Arbeit vom in Beirut gegründeten Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient (IFAPO) aus fort; ein polnisches Team um Kazimierz Michalowski und später Michal Gawlikowski arbeitete ab 1959 über 50 Jahre lang an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet: vom Bēl-Tempel über das Diokletianslager bis zum nördlichen Stadtviertel mit seinen Privathäusern sowie mehreren spätantik-byzantinischen Kirchen und schließlich im Bereich der Kolonnadenstraße; Schweizer Archäologen erforschten den Tempel des Baʿal-Šamen; ein syrisch-deutsches Team das sogenannte Tempelgrab Nr. 36 in der Westnekropole; japanische Forscher legten zwei Hypogäen mit reicher Grabplastik in der Südwestnekropole frei; das syrisch-norwegische Palmyrena-Projekt erkundete in großflächigen Surveys das Hinterland der Metropole; ein deutsch-österreichisch-syrisches Grabungsteam um Andreas Schmidt-Colinet schließlich untersuchte von 1997 bis 2010 die sogenannte Hellenistische Stadt südlich des Wadi und dokumentierte damit zum ersten Mal in größerer Dichte die frühe Siedlungsgeschichte der Oasenstadt.
2011 setzte der seither in Syrien wütende Bürgerkrieg der archäologischen Erforschung nicht nur Palmyras, sondern auch unzähliger anderer Stätten, ein ebenso abruptes wie brutales Ende. Die Geschichte Palmyras ist unterdessen längst zum Sujet von Historikern geworden. Schon Theodor Mommsen hatte die eminente Bedeutung des Handelszentrums erkannt, das im 3. Jahrhundert in Konflikte von globaler Dimension verstrickt wurde.15 In jüngerer Zeit hat der Oxforder Althistoriker Fergus Millar von Neuem das Interesse der althistorischen Zunft am Nahen Osten geweckt. Sein epochales Werk The Roman Near East (1993) hat eine bis heute anhaltende Debatte um die kulturelle Identität der orientalischen Provinzen Roms angestoßen. Millars These, im Befund sei fast ausschließlich die griechisch-römische Prägung der Region erkennbar, während eine Art kultureller Amnesie offenbar jede Erinnerung an die vorhellenistische Vergangenheit ausgelöscht habe, hat seither zahlreiche Unterstützer gefunden,16 aber auch Widerspruch17 provoziert.
Vor allem Palmyra liefert Stoff in Hülle und Fülle, der Spielraum für unterschiedlichste Deutungen lässt: eine architektonisch-künstlerische Formensprache, die unleugbar auf dem hellenistisch-römischen Modell fußt, aber eigene Wege geht; die Zwei- bzw. Dreisprachigkeit eines großen Teils der Inschriften; die überragende Bedeutung des Fernhandels für die Wirtschaft der Stadt; die uneindeutige Rolle tribaler Identitäten im sozialen Gefüge; die in ihrer vexierbildhaften Komplexität unmöglich auf einfache Formeln zu bringende Götterwelt der Stadt; und schließlich natürlich die exzeptionelle Rolle Palmyras auf dem Höhepunkt der Krise von Roms „kurzem“ 3. Jahrhundert.