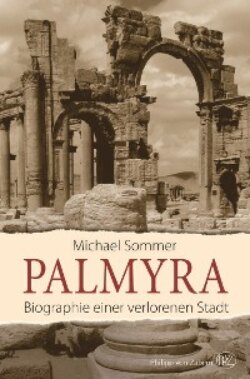Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Randlage und imperialer Zyklus: Syrien als Spielball der großen Mächte
ОглавлениеSyría – so nannten wohl zuerst die Griechen die Region, die wir heute am besten mit dem Stichwort „Levante“ bezeichnen. Sie ist weit größer als der heutige Nationalstaat, den die Mandatsmacht Frankreich 1930 aus der Taufe hob. Zur historischen Landschaft Syriens zählen mindestens noch der Libanon und der Teil der Türkei, der südlich der Taurusketten liegt, also die Ebenen von Urfa und Mardin im nördlichen Mesopotamien. Eng an Syrien gebunden sind Teile des heutigen Irak (die Gazira zwischen Euphrat und Tigris), das moderne Israel (das antike Judäa) und das nördliche Jordanien (die Dekapolis mit den Städten Philadelphia, Gerasa, Pella, Gadara, Dion und Raphana). Verbindendes Element dieser grob von Taurus, Mittelmeer, Tigris und Arabischer Wüste umgrenzten Landschaft war das Vorherrschen der aramäischen Sprache, die seit dem frühen 1. Jahrtausend v. Chr. im gesamten Fruchtbaren Halbmond Verbreitung fand und im Perserreich der Achaimeniden zu einer der Reichssprachen avancierte. Der Name Syría leitet sich vermutlich ab von Assyría, also jener in Mesopotamien liegenden Landschaft im Dreieck zwischen mittlerem Tigris und kleinem Zab, die zur Keimzelle gleich dreier Reiche in der mittleren und späten Bronzezeit geworden war: des alt- (18. Jahrhundert v. Chr.), mittel- (ca. 1390–1077 v. Chr.) und neuassyrischen (911–605 v. Chr.) Reiches.
Die Lage am Rand imperialer Mächte wurde historisch strukturbestimmend für die Levante. Von allen großen Reichen, die über das Gebiet herrschten, hatte allein das Damaszener Kalifat der Umayyaden von 661 bis 750 n. Chr. sein Zentrum ausschließlich in Syrien. Das Seleukidenreich, das als Nachfolgestaat des Alexanderreiches Vorderasien kontrollierte, hatte in Nordsyrien immerhin noch eine seiner beiden Kernregionen – die zweite war Babylonien, das die Seleukiden im 2. Jahrhundert v. Chr. an die Parther verloren. Sonst aber lag die Ostflanke des Mittelmeeres politisch stets am Rand, war manchmal gar die doppelte Peripherie gleich zweier Imperien, im Prinzip seit dem 3. Jahrtausend v. Chr., als sich hier die Einflusssphären der Reiche überkreuzten, die sich in den Flusstälern Mesopotamiens und des Nils gebildet hatten: zuerst des Akkad-Reiches (ca. 2334–2154 v. Chr.) in Babylonien und des ägyptischen Alten Reiches (ca. 2551–2155 v. Chr.).1
Der zweite Faktor, der die politische Wirklichkeit zwischen Mittelmeer und Tigris bestimmte, war das beständige Werden und Vergehen von Imperien. Die durchschnittliche „Haltbarkeit“ der vorderasiatischen Großreiche betrug rund 200 Jahre: von Akkad über das Imperium der 3. Dynastie von Ur (ca. 2112–1940 v. Chr.), das altbabylonische (1894–1595 v. Chr.) und altassyrische (1813–ca. 1700 v. Chr.), das mittelassyrische, neuassyrische und neubabylonische (629–539 v. Chr.) und schließlich das persische Reich der Achaimeniden (550–330 v. Chr.). Analog lösten in Ägypten das Alte, das Mittlere (2040–1785 v. Chr.) und das Neue (1540–1070 v. Chr.) Reich einander ab. Zwischen den Machtperioden der Imperien lagen stets Phasen der politischen Fragmentierung – in Ägypten als „Zwischenzeiten“ bezeichnet –, oft begleitet von Krieg, Bürgerkrieg und allgemein chaotischen Zuständen.
Die Verfallsszenarien ähnelten einander grundsätzlich: Innere Konflikte begleiteten das Erstarken äußerer Feinde, denen die Reiche auf lange Sicht immer weniger entgegenzusetzen hatten; Überdehnung der Grenzen und Überforderung der militärischen Leistungsfähigkeit mündeten in Niederlagen und ökonomischen Krisen, welche die Legitimität der Herrscher untergruben und das Reich unregierbar machten. Schließlich zerfiel die politische Struktur, die „barbarischen“ Ränder fielen ab und wurden zu Inkubatoren neuer Machtzusammenballungen: Fast immer waren es Nomadenstämme, deren führende Clans sich zu Dynastien neuer Reichsbildungen aufschwangen. Das Rad des imperialen Zyklus hatte sich einmal um seine eigene Achse gedreht.2
Exemplarisch veranschaulichen den imperialen Zyklus Aufstieg und Fall des Akkad-Reiches, des ersten wirklichen Imperiums der Geschichte überhaupt.3 Der Reichsgründer, Sargon von Akkad, entstammte einer semitischsprachigen ethnischen Minderheit im sumerischen Stadtstaat Kiš. Die legendenhaft ausgeschmückten Texte zu Sargon verlegen die Heimat seiner Vorfahren ins „Hochland“, was auf eine nomadische Herkunft schließen lassen könnte.4 In Kiš stürzte er zunächst den lokalen König Ur-Zababa, bevor er sich der Expansion nach außen zuwandte. Um 2334 v. Chr. eroberte er das weiter südlich gelegene Uruk, das bereits mehrere der älteren Stadtstaaten unterworfen hatte. Die zuvor souveränen Stadtstaaten formte er zu autonomen Zellen seines Reiches um; die Könige blieben in der Regel in Amt und Würden, mussten aber der Zentrale, die Sargon in der bisher nicht lokalisierten Stadt Akkad aufgeschlagen hatte, Abgaben und Heeresfolge leisten. Der Titel ensi, den bis dahin die souveränen Herrscher der sumerischen Stadtstaaten getragen hatten, bezeichnete jetzt autonome Teilkönige, die dem Großkönig in Akkad untertan waren. Großräumige Herrschaft, wie sie Sargon durchgesetzt hatte, bot den Vorteil, dass nun das Bewässerungssystem, von dem die Landwirtschaft in der mesopotamischen Flussoase abhing, rationeller organisiert werden konnte. Akkad normierte zudem das System der Steuereintreibung sowie Maße und Gewichte – und es setzte die Sprache des Herrschers, das semitische Akkadisch, als Verwaltungssprache im gesamten Reich durch. Die lokalen Götterkulte blieben unangetastet, doch wertete Sargon den Tempel der Mondgöttin Nanna in Ur zu einer Art Reichsheiligtum auf.
Sargons Enkel Naram-Sin (ca. 2273–2219 v. Chr.) trieb die Expansion bis nach Obermesopotamien und Syrien voran, deren Siedlungssysteme entsprechend den Bedürfnissen seines Imperiums rekonfiguriert wurden. Seinen eigenen Anspruch auf Weltherrschaft übersetzte er in die Formel „König der vier Weltgegenden“. Doch Naram-Sin ging noch einen Schritt weiter: Er ließ sich als „Gott von Akkad“ anreden und mit einer Hörnerkrone auf dem Kopf abbilden, dem Symbol für Göttlichkeit. Der Anspruch auf göttliche Ehren brachte Naram-Sin in Konflikt mit den etablierten Kulten der sumerischen Städte; er kollidierte frontal mit den Interessen der dortigen Priesterschaften und bescherte ihm postum eine miserable Presse: Der „Fluch über Akkad“, ein sumerischer Text aus der Zeit nach dem Untergang Akkads, diffamiert Naram-Sin als Gotteslästerer, der auch nicht vor der Zerstörung von Tempeln zurückgeschreckt sei.5
Hier traten grundsätzliche Spannungen an die Oberfläche, die zunehmend zur Belastungsprobe für das Imperium wurden. Der Tendenz zur Zentralisierung stand das Streben der autonomen Städte nach Wiederherstellung ihrer Souveränität entgegen. Unter Naram-Sins Sohn und Nachfolger Sar-kali-sarri verschärften sich die Konflikte so weit, dass das Reich seinen inneren Zusammenhalt verlor. Gruppen von „Barbaren“ nutzten die aufbrechenden Machtvakuen, um sich im Innern zu erheben oder von außen ins babylonische Kerngebiet einzufallen. Die Keilschriftquellen nennen gleich mehrere dieser wohl vorwiegend mobilen Gruppen: die Martu bzw. Amurru in Syrien und die Guti im Zagros-Gebirge. Die Guti eroberten eine Reihe von Städten in Babylonien. Einige von ihnen inszenierten sich dort als Nachfolger der Akkad-Könige – einer, ein gewisser Erridu-pizir, übernahm sogar die Titulatur „König der vier Weltgegenden“, obwohl sein Herrschaftsbereich kaum über die Stadt Nippur hinausreichte. Die Eroberer assimilierten sich rasch und waren vermutlich kaum mehr von der sumerischen Bevölkerung zu unterscheiden, als Ur-Nammu (ca. 2112–2095 v. Chr.), König von Ur und Hauptakteur der nächsten Reichsbildung in Mesopotamien, sich brüstete, die Guti verjagt zu haben.
Die Geschichte von Aufstieg und Untergang des Akkad-Reiches enthält alle Elemente, die auch bei späteren Reichsbildungen wirksam wurden: Ein Herrscher mit obskurem, vielleicht nomadischem Hintergrund reißt die Herrschaft in einem Kerngebiet an sich. Das Machtzentrum expandiert, diverse Peripherien mit unterschiedlichen Graden von Herrschaftsintensität entstehen. Das Zentrum vermeidet die direkte Beherrschung seiner Peripherien und setzt stattdessen auf autonome Vasallen, deren Bewegungsfreiheit umso größer ist, je weiter sie sich vom Zentrum entfernt befinden. Autonomie und Herrschaftsintensität sind, vom Zentrum ausgehend, idealiter in konzentrischen Kreisen gestaffelt: Im Fall des Akkad-Reiches ist die normierende Kraft des Zentrums in Babylonien stärker fühlbar als in Obermesopotamien und Syrien. Den Machtverlust des Zentrums leiten innere Konflikte ein, oft begleitet von dynastischen Wirren und Perioden wirtschaftlichen Abschwungs. Synchron dazu und effektverstärkend gerät das Imperium auch von außen unter Druck: „Barbaren“ und konkurrierende imperiale Mächte perforieren die Reichsgrenzen, fügen den Herrschern Niederlagen zu und untergraben so ihr Prestige. Auf Dauer kann kein Imperium solchen negativen Konjunkturen trotzen. Das Reich zerfällt und macht einem Machtvakuum Platz, in dem ausgerechnet die antiimperialen Akteure von einst die Rolle einer neuen, sich oft bald ebenfalls imperial gebärdenden Ordnungsmacht übernehmen.
Syrien spielte in jedem imperialen Zyklus sowohl die Rolle der Peripherie mit geringer Herrschaftsintensität als auch die eines nahezu unerschöpflichen Reservoirs an nomadischen „Barbaren“, die sich im entscheidenden Moment in antiimperiale Akteure verwandeln, dann aber auch selbst zu Reichsgründern avancieren konnten: die Martu-Amurru ab dem späten 3. Jahrtausend v. Chr., die Achlamäer, Sutäer und Kassiten in der mittleren und die Aramäer in der späten Bronzezeit. Gegenüber den primären Zivilisations- und Machtzentren Babylonien und Ägypten hatte Syrien eine viel geringere Bevölkerungs- wie Siedlungsdichte; die agrarische Produktion war weniger intensiv; sämtliche sozialen und wirtschaftlichen Parameter weniger komplex. Im 2. Jahrtausend v. Chr. entstand im Norden ein drittes, sekundäres Machtzentrum: Schauplatz dieses Geschehens war aber nicht Syrien, sondern Kleinasien, wo zuerst die Hurriter, später die Hethiter gleich mehrere Anläufe zur Reichsbildung unternahmen. Fortan lag Syrien im geographischen Schnittpunkt gleich dreier imperialer Interessensphären.