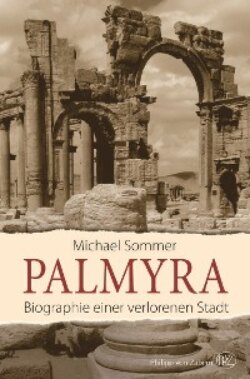Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Endspiel um Syrien
ОглавлениеAuf Alexander waren in Vorderasien die Seleukiden gefolgt. Der Gründer der Dynastie, Seleukos, hatte Alexanders Leibgarde befehligt und sich dann, nach dessen Hinscheiden in Babylon und wechselvollen Kämpfen, den territorial größten Brocken aus der Erbmasse gesichert. Füglich nannte er sich Nikator, der „Sieger“. Das Reich des Seleukos und seiner Nachfolger reichte vom südlichen Kleinasien im Westen bis nach Indien. Die Kernlande des Reiches waren Babylonien und Syrien. Im südlichen Mesopotamien erbrachte eine nach wie vor äußerst ertragreiche Landwirtschaft die wirtschaftliche Grundlage für das Imperium und seine Städte. Die Seleukiden schufen hier eine Reihe von Städten des Polis-Typs, deren bedeutendste das 305 v. Chr. von Seleukos Nikator am rechten Ufer des Flusses gegründete Seleukeia am Tigris war. Die Stadt befand sich unweit des alten Babylon am Kreuzungspunkt verschiedener Handelsstraßen; unter anderem zweigte unweit Seleukeias der „Königskanal“ ab, der den Tigris mit dem Euphrat verband. Das Gros der, antiken Angaben zufolge, zu Hunderttausenden zählenden Siedler bildeten offenbar Makedonen, zu denen sich Griechen, Syrer, Juden und Bewohner der umliegenden mesopotamischen Städte gesellten.45 Die Stadt besaß fraglos ein multikulturelles Timbre, politisch aber war sie eine Polis mit Bürgern und entsprechenden Institutionen: einer Ratsversammlung und diversen Magistraturen.46 Die Architektur war zumindest zum Teil westlichen Vorbildern nachempfunden, es gab ein Heroon und ein Theater sowie einen Kult für den seleukidischen König; die Bewohner waren selbst in parthischer Zeit noch stolz darauf, sich wie Griechen zu kleiden.47
Außer Seleukeia gab es in Babylonien noch einige kleinere makedonische Neugründungen, darunter ein Alexandreia48 und mindestens zwei Städte namens Apameia im Charakene genannten Mündungsgebiet von Euphrat und Tigris.49 Vor allem strömten zahlreiche aus dem Westen stammende Zuwanderer in schon bestehende Städte wie Babylon und Uruk. Hier konstituierten sich offenbar, ohne dass diese Städte zu Poleis wurden, griechischmakedonische Bürgerverbände (politeumata) mit weitreichenden Autonomierechten gegenüber ihrer Umwelt. Den Einfluss dieser Menschen auf die lokale Gesellschaft zu quantifizieren, ist angesichts mehr als lückenhafter Daten kaum möglich. Für die meisten Einheimischen scheint sich aber der Alltag nicht markant verändert zu haben. Die Rhythmen des sozialen und religiösen Lebens prägten nach wie vor Traditionen, die bei der Ankunft Alexanders schon seit Jahrtausenden existierten. Die einheimischen Eliten waren unverzichtbare Kooperationspartner der neuen Herren; sie verblieben deshalb auch fast immer in ihren religiösen, ökonomischen und politischen Schlüsselpositionen.50 Im Übrigen währte die seleukidische Herrschaft nur vergleichsweise kurz.
Ganz anders in Syrien: Hier waren die Kontakte zum Westen schon vor Alexander intensiver gewesen, die kulturelle Nähe größer. Vor allem hatte der Zustrom von Siedlern aus Griechenland und Makedonien hier ganz andere Ausmaße. Demographie und Siedlungsstruktur des Landes zwischen Mittelmeer und Euphrat wurden gründlich umgekrempelt, der neue Stadttypus der Polis fasste hier ungleich stärker Fuß als in Mesopotamien. Außerdem verlagerte sich der Schwerpunkt urbanen Lebens von der phönizischen Küste nach Nordsyrien. Hier stampften Seleukos und seine Nachfolger die größte Agglomeration griechischer Städte außerhalb des Mutterlands aus dem Boden: Die vier bedeutendsten, Antiocheia am Orontes, Laodikeia am Meer, Seleukeia in Pierien und Apameia in Syrien, bildeten die sogenannte „Tetrapolis“, eine Städtelandschaft ganz eigenen Charakters und vor allem ein Vorposten griechischer Kultur inmitten einer sonst völlig anders geprägten Umwelt.51
In den vier Städten lebte das Gros der Siedler aus Griechenland und Makedonien. Den Kern ihrer Bevölkerung – zumal der lokalen Eliten – machten Neuankömmlinge aus. Das von Seleukos Nikator 300 v. Chr. gegründete Antiocheia nahm zunächst die Bevölkerung der Vorgängerkolonie Antigoneia auf; zu ihnen gesellten sich bald Zugezogene aus Makedonien und Athen, später, im 2. Jahrhundert v. Chr., aus Euboia, Aitolien und Kreta. Die Stadt war, ähnlich Alexandreia, entlang ethnisch-kultureller Grenzen gegliedert, spiegelte in ihrem Stadtplan aber auch die verschiedenen Wellen der Immigration: Die von Seleukos gegründete Kernstadt nahm die Erstsiedler auf, ein zweites Viertel war der einheimischen syrischen Bevölkerung vorbehalten; ein drittes entstand unter Seleukos II. um die Mitte des 3. Jahrhunderts; ein viertes schließlich unter Antiochos IV., nachdem die römische Expansion eine Fluchtbewegung aus dem griechischen Mutterland ausgelöst hatte. Dazu gesellte sich eine nicht unbedeutende jüdische Einwohnerschaft.52
Die Stadt nahm sich auch physisch als Fremdkörper in ihrer Umwelt aus. Ein Raster mit rechtwinklig sich schneidenden Straßen war von einer ebenfalls rechteckigen Stadtmauer umgeben. Die Wohnbebauung bestand, dem Grundgedanken einer demokratischen Stadtplanung folgend, aus weitgehend einheitlichen Hofhäusern, die lediglich in ihrer Größe leicht variierten. Im geographischen Zentrum der Stadt befanden sich öffentliche Plätze und Gebäude. Diesen Stadtplan hatte der Architekt Hippodamos von Milet im 5. Jahrhundert v. Chr. ersonnen und in seiner Heimatstadt Milet verwirklicht. Jetzt fand er überall dort begeisterte Nachahmer, wo Griechen und Makedonen auf erobertem Boden neue Städte anlegten.53 Der Kontrast zur traditionellen Urbanistik Vorderasiens hätte schärfer nicht sein können: Der rechtwinklige Grundriss als Ausdruck rationalen Planens war ebenso revolutionäres Novum wie der demokratische Gleichheitsgedanke, der sich in den Wohnhäusern artikulierte. Innovativ war vor allem das Konzept des öffentlichen Raumes, das mit den Makedonen Einzug in die syrische Städtelandschaft gehalten hatte.54
Als neu und regelrecht invasiv stellte sich schließlich auch die Einheitlichkeit, ja Austauschbarkeit der neuen Städte heraus. Wer sich in einer zurechtfand, orientierte sich auch in jeder anderen ohne große Probleme. Er erkannte die Funktion von Gebäuden und urbanen Ensembles an bestimmten, feststehenden Merkmalen. Die Architekten setzten ganz bewusst auf den Wiedererkennungswert ihrer Architektur. Deren kanonische Elemente tauchten in zwar immer anderen Kombinationen, aber eben doch in geradezu penetranter Wiederholung und in stets gleicher Form auf: Säulen, Kapitelle, Gebälk, Friese und aller sonstige Dekor waren ihr auf das Zeichenhafte reduziertes Repertoire und so unmissverständlich griechisch wie die Sprache und Denkweise ihrer Erbauer.55 So glich die Tetrapolis mit gleich vier in einheitlicher Planung und Bauweise auf einem unregelmäßigen Viereck von gerade 60 Kilometern Seitenlänge errichteten Städten einer machtvollen Demonstration griechisch-makedonischer Präsenz in dem eroberten Land. Den erklärten Willen der neuen Herren, dem Land physisch den eigenen Stempel aufzudrücken, erkennt man auch an der vermessungstechnischen Katastrierung großer Räume, die sich noch heute im Umland von Damaskus und bei Aleppo im Bodenbefund abhebt. Hier artikuliert sich nicht nur die grundlegende Neuordnung der Besitzverhältnisse, in deren Genuss selbstverständlich griechische und makedonische Zuwanderer kamen, sondern auch das Bestreben, ein rationales Ordnungsprinzip durch Neuanlage von Wegen und Ackergrenzen im Raum sichtbar zu machen.56
Die Städtelandschaft der Tetrapolis mit ihrem fruchtbaren Umland, der beispiellosen Bevölkerungskonzentration und dem strukturprägenden griechisch-makedonischen Element war, mehr noch als Babylonien, die Herzkammer des Seleukidenreiches. Beide Kernregionen verbindet der Flusslauf des Euphrat, der in Syrien einen weiten Bogen nach Westen beschreibt und von der Ḫābūrmündung abwärts mit Booten, die einen geringen Tiefgang hatten, schiffbar war.57 Diese kommerziell wie strategisch überlebenswichtige Achse sicherten die Seleukiden mit einer Kette von Städten, in denen sie Menschen ansiedelten, auf deren Loyalität sie im Zweifel zählen konnten. Auch diese Städte erhielten Namen, die an Vertreter der Dynastie erinnerten oder an die makedonische Heimat vieler Siedler: Seleukeia am Euphrat (Zeugma), Europos in Syrien (das alte Karkamiš), Nikephorion-Kallinikon (das alte Tuttul, das spätantike Leontopolis und heutige ar-Raqqa) und schließlich Europos in Mesopotamien, dessen Name zuvor Dura gelautet hatte und das daher heute meist als Dura-Europos bezeichnet wird. Viele dieser Städte bestanden bereits, als Alexander erobernd durch das Land zog, und empfingen unter den Seleukiden ein mehr oder weniger großes Kontingent makedonischer und griechischer Siedler. Diese Städte waren bedeutend kleiner als die Metropolen der Tetrapolis und, entsprechend ihrer Funktion, eher vorgeschobene Außenposten als Leuchttürme der Hellenisierung. Aber selbst eine Stadt wie Dura-Europos, die bei Weitem nicht an Großstädte wie Apameia oder Antiocheia heranreichte, verfügte über ein großzügig bemessenes hippodamisches Straßenraster und einen öffentlichen Raum. Wie die Antiochener, so waren auch die Einwohner der Stadt am mittleren Euphrat stolz auf ihre griechische Kultur, ihre Sprache und ihren Stadtgründer Seleukos Nikator, dem sie als Heros kultische Ehren darbrachten. Und wie ihre Vettern in der Orontes-Stadt, die ihre Stadtgöttin in Gestalt einer weithin berühmten Plastik des Bildhauers Eutychides verehrten, besaßen auch die Bewohner von Dura-Europos eine Tyche als weibliche Personifikation ihrer Stadt.58
Mesopotamien und mit ihm Dura-Europos gingen für die Seleukiden schließlich nach längeren Kämpfen 129 v. Chr. verloren, als Antiochos VII. dem parthischen König Phraates II. unterlag und die Parther die Festungen am Euphrat in Besitz nahmen. Vorausgegangen war der Eroberung der schleichende Substanzverlust der Seleukiden im Osten ihres Reiches, den auch periodische Anstrengungen zur Rückeroberung – besonders unter Antiochos III., genannt Megas, (223–187 v. Chr.) und Antiochos VII. Euergetes (138–129 v. Chr.) – nicht aufhalten konnten. Immer mehr Satrapen kochten ihr eigenes Süppchen, Dynasten lösten ihre Herrschaftssprengel vom Reich und mit den Parthern erschien eine iranische Ethnie auf der Bühne, die in Zentralasien zur Reichsbildung und bald zur Expansion nach Westen ansetzte.59 Unterdessen machten sich auch im Westen des Seleukidenreiches Zerfallserscheinungen bemerkbar: Zwar war es den Seleukiden im 5. Syrischen Krieg gelungen, den Kampf um Syrien und Palästina für sich zu entscheiden und die Levante ihrer vollständigen Kontrolle zu unterwerfen. Doch währte die Freude am Sieg über die Ptolemaier nicht lange. Zerrüttet von der katastrophalen Niederlage gegen Rom im sogenannten Antiochoskrieg (192–188 v. Chr.) und von innerdynastischen Rivalitäten, verlor die seleukidische Herrschaft auch im Westen an Integrationskraft. Im Makkabäeraufstand (ab 165 v. Chr.) kündigte ein Teil der jüdischen Elite den Seleukiden die Gefolgschaft auf; Judäa versank in Unruhen und Krieg, bis die Seleukiden der Priesterdynastie der Hasmonäer schließlich eine weitreichende Autonomie zugestanden (134 v. Chr.).60
Wie sich die allmähliche Desintegration des Seleukidenreiches auf den Fernhandel in Vorderasien auswirkte, lässt sich mangels Quellen nur vermuten. Dass die Teilung der Region in zwei politische Sphären entlang des Euphrat den landgestützten Güteraustausch zwischen Mittelmeer und Persischem Golf belastete, wenn nicht abwürgte, ist zumindest eine plausible Annahme.61 Es ist auch nicht auszuschließen, dass eine neue politische Lage die Suche nach alternativen Routen stimulierte. Die Wiederentdeckung der Monsunpassage könnte ebenso in diesen Zusammenhang gehören wie der rapide, anders kaum zu erklärende Aufschwung, den die Siedlung Petra im heutigen Jordanien ab dem späten 2. Jahrhundert v. Chr. nahm: Aus dem nomadischen Lagerplatz wurde binnen Jahrzehnten eine bedeutende Stadt; aus dem im Raum Petra lebenden Nomadenstamm der Nabatäer ein lokaler Machtfaktor, der sich erfolgreich gegen den seleukidischen wie ptolemai-schen Herrschaftsanspruch durchsetzte.62 Einiges spricht also dafür, dass die Karawanenroute durch Mesopotamien unter den Auspizien einer veränderten politischen Lage von alternativen Handelswegen – über Petra und den Golf von Akaba bzw. über den Nil und durch die ägyptische Wüste zum Roten Meer und um Arabien zum Indischen Ozean – abgelöst wurde. Schließlich mögen auch die ersten zaghaften Anfänge des palmyrenischen Fernhandels, die just in diese Zeit zu fallen scheinen, mit der politischen Spaltung Vorderasiens in einem direkten Zusammenhang stehen – damit allerdings beginnt eine neue Geschichte.