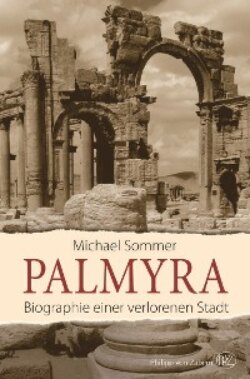Читать книгу Palmyra - Michael Sommer - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Phönizier
ОглавлениеBezogen auf die von der Ägäis bis tief in den Iran reichenden „Welt“ der Bronzezeit war das Handeln der großen Mächte „global“: Menschen, Güter und Ideen zirkulierten großflächig, der Grad an wechselseitiger Abhängigkeit war relativ hoch, der Wirkungsradius von Ereignissen weit gesteckt. Das System vor allem der späten Bronzezeit war so hochgradig integriert, dass Krisen, die sich in marginalen Räumen zusammenbrauten, sich zum Katastrophenszenario für die gesamte Ordnung aufschaukeln konnten. Genau das geschah um 1200 v. Chr.: Die wirtschaftliche Leistungsschwäche des Hethiterreiches und die politische Leistungsschwäche seiner Vasallen in der Levante zogen nach und nach alle großen Reiche und kleinen Königtümer in einem breiten, von der Ägäis bis nach Mesopotamien und Ägpyten reichenden Bogen in einen Abwärtsstrudel, der nichts von der scheinbar für die Ewigkeit gezimmerten Weltordnung der Bronzezeit übrig ließ. Dem gesamten Ostrand des Mittelmeeres schlug Anfang des 12. Jahrhunderts v. Chr. eine Stunde null, die Spielräume für völlig neue Formen politischer und wirtschaftlicher Organisation eröffnete. Ein Zeitalter der Experimente hatte begonnen.17
Der Zusammenbruch der ersten, von den großen Mächten der Bronzezeit – vom Hethiterreich über Assur und Babylonien bis nach Ägypten – getragenen Globalisierung legte unverzüglich die Saat für eine zweite, jetzt aber von kleinen Einheiten ausgehende und ungleich dynamischere Welle des globalen Zusammenrückens. Brennpunkt dieses Geschehens war die Levante, deren urbane Zivilisation die Zäsur von 1200 v. Chr. mehr oder minder unbeschadet überstanden hatte. Während in weiten Teilen des Vorderen Orients kaum ein Stein auf dem anderen geblieben war, offenbart die Siedlungsgeschichte für den schmalen Küstenstreifen der Levante eine bemerkenswerte Kontinuität: Etliche Städte überdauerten den großen Umbruch intakt, andere wurden zwar in Mitleidenschaft gezogen, erstanden aber bald, wie Phönix aus der Asche, neu auf ihren Ruinen: Städte wie Arados, Byblos, Sidon, Tyros, Dor, Aškelon und Gaza erfreuten sich eines Wohlstands, der sich selbst aus dem Abstand von 3000 Jahren noch unübersehbar im archäologischen Befund abzeichnet. Umso erstaunlicher erscheint er, wenn man die florierenden Zentren der Küste mit dem Binnenland vergleicht, in dem sich Gruppen niedergelassen hatten, die sich im Norden Aramäer, im Süden Hebräer nannten. Die Hebräer kamen ihrem eigenen historischen Gedächtnis zufolge als Konföderation aus zwölf Stämmen in die Levante und ergriffen gewaltsam von dem Land Besitz. Die Geschichte von Exodus und Landnahme erzählen das 2. bis 5. Buch Mose sowie die Bücher Josua und Richter des Alten Testaments – die Rede ist selbstverständlich vom Volk Israel.18
Juda, Israel und das syrische Binnenland waren rückständige Randzonen, als, um 1000 v. Chr., die Bewohner der levantinischen Küstenstädte zum Sprung nach Übersee ansetzten, ins große Unbekannte einer nicht kartierten Welt, die für die Seeleute große Gefahren, aber noch weitaus größere Gewinnchancen bereithielt. Hauptakteure dieser mehrhundertjähigen Bonanza des interkontinentalen Fernhandels waren jene Menschen, die in Homers im späten 8. bzw. frühen 7. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Epen Phoínikes heißen, die „Blutroten“. Der Name leitet sich von dem Handelsgut ab, für das die „Phönizier“ in der gesamten antiken Mittelmeerwelt berühmt waren: purpurgefärbte Textilien. Den Farbstoff stellten sie in mühseliger Handwerksarbeit aus Seeschnecken der Gattung Murex her, die im Seegebiet der Levante in großer Zahl vorkamen. Der Prozess der Farbherstellung gestaltete sich so aufwendig, dass Purpurstoffe zu den teuersten Handelsgütern der Antike zählten: Sie ließen sich mit Gold buchstäblich nicht aufwiegen.19
Die Phönizier handelten selbstverständlich nicht nur mit Purpurtextilien. Kunstfertige Elfenbeinarbeiten, Prunkgefäße aus Edelmetall, Glas, Kultgeräte – phönizische Kunsthandwerker waren auf Luxusartikel fast jeder Art spezialisiert. Auf dem Höhepunkt ihrer kommerziellen Macht, im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr., teilte sich die Welt des Mittelmeeres und des angrenzenden Nahen Ostens in zwei Zonen: Eine, in der die Menschen vor allem Handel trieben und Dinge herstellten, die überall nachgefragt wurden, und eine, in der Ackerbau und Viehzucht vorherrschten. Ackerbau und Viehzucht waren praktisch überall fast alleinige Existenzgrundlage, nur nicht in der Levante. Nur hier hatten Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft einen Komplexitätsgrad erreicht, der es Städten ermöglichte, selbst Werte zu schaffen, von denen sie leben konnten.20
Grundlage war eine hochgradig arbeitsteilige Ökonomie, in der ein Rad ins andere griff. So etwas wie ein „Weltmarkt“ auf der Basis eines expandierenden, geldlosen Tauschhandels begann zu entstehen: Die phönizischen Städte waren die Drehscheibe zwischen wichtigen Rohstofflagern, Kornkammern und handwerklichen Produktionszentren. Ihre Bewohner verflochten weit entfernte Orte wie Südspanien, Zypern, Ägypten, Israel und Mesopotamien zu einem stetig dichter werdenden Netz, in dem Waren zirkulieren und Preise fluktuieren konnten. Und diesmal verwalteten nicht Bürokraten und Agenten von Königen den Fernhandel, sondern Individuen mit Unternehmergeist. Kleine, oft bunt zusammengewürfelte Mannschaften von seefahrenden Kaufleuten durchpflügten auf zerbrechlich wirkenden Schiffen die Meere, suchten ferne Küsten auf, boten zum Verkauf dar, was sie im Schiff mitführten, und kauften, was die Fremden zu verkaufen hatten.21
Nicht wenige von ihnen übersiedelten auf Dauer in die Fremde, gründeten Handelsstützpunkte und knüpften von der Küste aus Kontakte ins Binnenland, dessen Rohstoffe und Märkte sie erschlossen. Eine „Kolonisation“, wie oft behauptet, war das nicht, eher schon die planmäßige Anlage eines Netzes von kommerziellen Außenposten. Dennoch hatte das Einströmen wirtschaftlich potenter und mit technologischen und organisatorischen Schlüsselfertigkeiten ausgestatteten Fremden umwälzende Auswirkungen auf die Gesellschaften der mediterranen Peripherie zuerst Zyperns, dann Italiens, Nordafrikas und der Iberischen Halbinsel: Kaum hatten sie den Fuß auf fremden Boden gesetzt, bestimmten die Neuankömmlinge sämtliche zivilisatorischen und kulturellen Standards. Bewunderung flößten nicht nur Reichtum und Know-how der Phönizier ein, sondern auch ihr Lebensstil und ihre Götter. Nicht zuletzt reizte die in einem einfach zu erlernenden Alphabet geschriebene Sprache zur Nachahmung.22
Lang und steinig war der Weg vom Kollaps am Ende der Bronzezeit bis zum „Weltmarkt“ des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. Recht bald nach 1200 v. Chr. begriffen die Stadtkönige der Levante, dass das Machtvakuum ihnen Spielräume eröffnete, über die sie im System der Bronzezeit nicht verfügt hatten. Ein ägpytischer Text des 11. Jahrhunderts v. Chr., der vermutlich fiktionale „Bericht des Wenamun“, erzählt, wie Sekerbaal, der König von Byblos, geschäftstüchtig die Zedernstämme nach Ägypten verkauft, die seine Vorgänger noch gratis, als Tribute, an das Nilreich abgeliefert hatten. Texte des Alten Testaments sprechen voll Bewunderung von den Handwerkern aus Tyros, die König Salomo beim Bau des Tempels geholfen hätten. Und die homerischen Epen Ilias und Odyssee versagen zwar den geschickten Herstellern feiner Stoffe und wertvoller Gefäße ihren Respekt nicht; sie machen aber auch keinen Hehl aus der Abscheu, die Griechen für das Geschäftsgebaren der ebenso profitgierigen wie rücksichtslosen Händler aus der Levante empfanden. Ein Text aus dem Alten Testament, das Buch Jesaja, nennt die Handelsherren von Tyros „Kaufleute, die wie Fürsten auftraten“.23
Über die politische und soziale Organisation der phönizischen Städte wissen wir kaum etwas und so gut wie nichts aus Zeugnissen, die Phönizier selbst hinterlassen haben. Beredter sind da schon die Quellen, die ihren Ursprung bei den Nachbarn haben: Ägyptern, Hebräern, Assyrern, Griechen oder gar Römern. Wie akkurat solche Schilderungen die Verhältnisse in Städten wie Tyros oder Sidon widergeben, ist schwer zu sagen. Vor allem bei griechischen und römischen Zeugnissen ist Vorsicht geboten. Texte wie die Schilderung der Belagerung von Tyros durch Alexander den Großen bei Curtius Rufus (vermutlich 1. Jahrhundert n. Chr.) und Arrian (2. Jahrhundert n. Chr.) scheinen anzudeuten, dass es in Tyros politische Institutionen gab, wie man sie auch in einer griechischen Polis antraf: einen Verband von Bürgern, einen demos, der über wichtige Fragen abstimmte, und eine Ratsversammlung;24 ob dahinter harte Fakten oder schlicht Analogieschlüsse der lange nach den Ereignissen schreibenden Autoren stecken, ist unbekannt. Ohnehin beziehen sich die Zeugnisse auf eine sehr späte Zeit; ob die phönizischen Städte der Eisenzeit ähnlich organisiert waren, wissen wir nicht.25
Festzustehen scheint immerhin zweierlei: Erstens war der primäre Horizont der Phönizier und ihrer politischen Identität stets die Stadt. Als „Volk“ dachten und handelten sie nicht. Verbindende Elemente für die Menschen aus der Levante waren ihre Sprache, ihre religiöse Vorstellungen und ihr kommerzieller Habitus; ein wie auch immer geartetes politisches Zusammengehörigkeitsgefühl resultierte, ähnlich wie bei den Griechen, daraus nicht. Deshalb lassen sich Tyros, Sidon und die anderen Städte der Levante vermutlich als Stadtstaaten verstehen, ähnlich Athen oder Korinth. Expansive Gelüste schließt das nicht aus: Immer wieder rivalisierten die größten der phönizischen Städte, Sidon und Tyros, um die Hegemonie; zumindest zeitweise war eine Stadt der anderen untertan – meist beherrschte Tyros das weniger mächtige Sidon.26
Zweitens gaben in den phönizischen Städten, wie im Übrigen auch in Karthago, anders als in Griechenland nicht Grundbesitzer den Ton an, sondern Fernhändler. Entsprechend der ökonomischen raison d’être der levantinischen Stadtstaaten saßen die Kaufleute, wenn es darum ging, politische Weichenstellungen vorzunehmen, stets am längeren Hebel. Über Karthago wissen wir relativ genau, dass die politische Elite der Stadt sich aus Männern rekrutierte, deren Kapital in Handelsunternehmungen investiert war, während Bauern und Handwerker nichts zu sagen hatten. Analog scheinen auch in Tyros und Sidon Fernhändlerinteressen entscheidend gewesen zu sein. Ein beträchtlicher Teil der Ressourcen dieser Städte wurde vermutlich dafür aufgewendet, den Schiffsverkehr zu sichern, Märkte zu erschließen und Rohstoffe auszubeuten. Welche Rolle hierbei zentrale, gleichsam „staatliche“ Institutionen spielten, ist nicht sicher zu bemessen; viel spricht allerdings dafür, dass die Initiative im Wesentlichen von Individuen ausging, die mit großer Zielstrebigkeit ihre Geschäftsinteressen verfolgten.27
Weiter wird man nicht gehen wollen. Unverkennbar sind aber die phönizischen Städte ein gesellschaftlicher Gegenentwurf zu den von den großen Institutionen beherrschten Palastzentren der Bronzezeit und ebenso den Imperien der Eisenzeit. Nicht vertikal von oben nach unten organisiert, sondern horizontal mit einer breiten Schicht individueller ökonomischer Akteure, bewerkstelligten sie den historisch zweiten Anlauf zu quasi-globaler Verflechtung auf gänzlich anderer Grundlage. Sie legten damit den Grundstein für die Kolonisation der westlichen Mittelmeerküsten durch die Griechen ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. und schließlich für die immer weiter fortschreitende politische, rechtliche, soziale, ökonomische und auch kulturelle Integration der mediterranen Welt durch das römische Imperium. Nicht erst die Griechen saßen um das Mittelmeer, wie Platon sich ausdrückte, „wie Frösche um einen Teich“.28