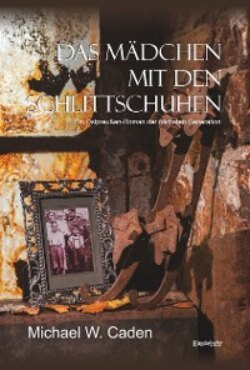Читать книгу Das Mädchen mit den Schlittschuhen - Michael W. Caden - Страница 9
Der Herrgottschnitzer
ОглавлениеAm nächsten Tag war Albert schon früh aus den Federn gekrochen. Als er das Restaurant des Hotels erreichte, hatte Heinrich schon am Frühstückstisch Platz genommen und genoss den heißen Kaffee und den Blick aus dem Fenster.
»Wie war die Nacht, Albert?«
»Geht so. Hat ein bisschen gedauert, bis ich in den Schlaf kam. Und bei dir?«
Auch Heinrich hatte offenbar schon bessere Nächte erlebt.
»Wie ein Murmeltier hätte ich geschlafen, hätte es da nicht die Bekanntschaft mit dieser Spanplatte unter der Matratze gegeben. Jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe, quietschte das Bettgestell. Fürchterlich! Was steht heute an?«
Albert hatte sich einen dieser köstlichen polnischen Pfannkuchen auf den Teller gelegt, während Heinrich weiter an seinem Kaffee schlürfte und sich gerade an dem Frühstücksei zu schaffen machte. Beide verloren kein Wort über den gestrigen Tag.
»Ich dachte, wir fahren nach Heilsberg und statten der Bischofsburg einen Besuch ab.«
»Ja, warum nicht. Eine gute Idee!«
Albert und Heinrich genossen das üppige Frühstück. Danach packten sie noch ein bisschen Proviant in die Rucksäcke. Schließlich hatten sie sich viel vorgenommen für diesen Tag. Sie wollten Heilsberg erkunden und der altehrwürdigen Bischofsburg einen Besuch abstatten. Gegen 10 Uhr verließen sie das Hotel zu Fuß in Richtung Stadtmitte.
Sie überquerten die Brücke über die Aller und gingen an der Kirche vorbei. Auf der Außenmauer thronten Heiligenfiguren in Übergröße. Sie bildeten einen seltsamen Kontrast zu den Plattenbauten in der unmittelbaren Nähe. Auf einem Balkon hatte jemand einen Schäferhund angebunden, der unentwegt kläffte.
»Ein bisschen Auslauf könnte dem aber auch nicht schaden«, meinte Heinrich und blickte zu Albert.
Doch der hatte gar nicht zugehört. Wie angewurzelt stand er da, starrte auf das Gebäude hinter der Kirche.
»Was ist los, Albert? Du bist ja mit einem Male so blass. Geht es dir nicht gut?«
Albert reagierte immer noch nicht.
Heinrich wartete einen kurzen Moment, dann wagte er einen weiteren Versuch.
»Sag doch, was ist?«
Albert sah Heinrich an. Seine Augen wirkten starr.
»Sag mal Heinrich, war hier mal ein Kloster, ein Altenheim oder so etwas Ähnliches?«
»Ja, mag sein. Warum?«
»Ich glaube, ich kenne dieses Haus. Ich meine, nicht persönlich. Nicht selbst. Ich habe lediglich davon gehört. Aber ich weiß, dass es ein furchtbarer Ort ist.«
Albert schluckte kurz.
»Hatte ich dir schon von Sophie erzählt?«
»Sophie …?
Heinrich schaute Albert ungläubig an.
»Nein, ich glaub nicht!«
Albert wirkte nachdenklich. Seine Gesichtsmuskeln waren angespannt. Unentwegt blickt er auf das Backsteinhaus mit dem großen Tor. Dann begann er mit leisen Worten zu erzählen.
»Sophie war die Tochter des Schmieds Urbschat in Klotainen. Sie war eine rechte Frohnatur und hatte kurzes feuerrotes Haar. Urbschats Wagen hatte sich im Januar 1945 bei der Flucht von Klotainen auf der vereisten Straße quer gestellt, weil er in dem ganzen Chaos des Rückzugs von einem deutschen Panzer gerammt worden war. Dabei brach eine Deichsel. Sie mussten bis Heilsberg zu Fuß weiter. Dort sind sie dann von der Roten Armee eingeholt worden. Sophie, ihre Mutter und ihr Vater und die kleine Schwester Käthe wurden hinter diesen Mauern mit vielen anderen zusammen eingesperrt. Hinter diesen Toren mussten sie wohl ihre schwersten Stunden verbracht haben.«
Damit hatte Heinrich nicht gerechnet.
»Was macht dich da so sicher, dass es ausgerechnet hier war?«
Albert starrte immer noch auf das große Tor.
»Es kann nur hier gewesen sein. Es war ein Altenheim unmittelbar hinter der Kirche, zwischen Kirche und Bischofsburg. Es kann daher also nur hier gewesen sein. Es waren Hunderte von Menschen. Die Russen haben alles zugenagelt: die Tore, die Türen und die Fenster – 14 Tage lang. Die Frauen und Mädchen, darunter auch Sophie, ihre Schwester und ihre Mutter, haben sie täglich raus gezerrt und vergewaltigt. An manchen Tagen ist die ganze Horde über sie hergefallen.«
Albert schluckte schwer, Heinrich merkte wie seinem Begleiter das Reden schwerfiel.
»Ihr Vater stellte sich den Peinigern entgegen. Weißt du, Urbschat, der Schmied, der hatte Riesenkräfte. Er schlug zwei der Russen mit jeweils einem Schlag nieder, bevor der dritte ihm von hinten eine Kugel in den Kopf jagte. Wer sich ihnen entgegen gestellt hat, der wurde einfach erschossen, so war das eben. Und es gab offenbar viele Tote hinter diesen Mauern. Und auch nichts zu essen und, na ja, die Leute starben auch wie die Fliegen am Hunger. Hinter dem Kloster haben sie die Leichen in die Alle geworfen. Aus dem Fluss nahmen sich die Eingeschlossenen das Trinkwasser – und bekamen davon die Ruhr. Auch daran sind viele zugrunde gegangen.«
»Und Sophie?«
»Sie löste nachts eine Glasscherbe aus einem Fenster und…«
Albert stoppte mitten im Satz. Ihm stockte der Atem. Heinrich sagte kein Wort, wartete ab, was geschehen würde.
»Ja Heinrich, in diesem verdammten Krieg sind viele schlimme Dinge passiert! Wir Ostpreußen waren eben die ersten, die die Rechnung für Hitlers Größenwahn und die Gräueltaten seiner SS-Schergen in der Sowjetunion bezahlen mussten. Komm, lass uns weitergehen. Das hier ist kein guter Ort, um zu verweilen!«
Albert und Heinrich überquerten eine weitere Brücke in der Nähe des Schlosses, sie wechselten kaum ein Wort. In der Nähe der Peter-und-Paul-Kirche durchquerten sie ein kleines Gässchen, den alten Bischofsitz mit seinen wuchtigen Wehrtürmen in Sichtweite.
»Als Schüler waren wir einmal während eines Wandertages in der Burg. Anschließend mussten wir einen Aufsatz schreiben – über die ermländischen Bischöfe und was für ein Segen sie für die Region waren«, brachte Albert die Unterhaltung wieder in Gang.
Die Geschichtsaufsätze waren ihm immer ein Graus. Wie hatte er sie gehasst. Dabei war er heute selbst ein Stück Geschichte. Aufgewachsen und vertrieben aus einer Jahrhunderte alten deutschen Kulturlandschaft. Wie hatte sein Vater in den wenigen sentimentalen Stunden, die er hatte, immer gesagt, als sie nach dem Krieg im Westerwald sesshaft geworden waren: »Zuhause ist nicht hier, wo wir wohnen, unsere Heimat ist woanders, unsere Heimat, die liegt in Ostpreußen.«
»Ja, ja – die Bischofsburg«, sinnierte Heinrich. »Den günstigen Standort zwischen der Alle und der hier einmündenden Simser haben schon die alten Prussen für die Anlage einer Wehreinrichtung genutzt. Sie nannten sie »Licbark.« Warmia steht für Ermland. So kommt der heutige polnische Name von Heilsberg zustande: Lidzbark Warminski. Wusstest du das, Albert?«
»Nein. Sag mal, was macht diese Bischofsburg eigentlich so außergewöhnlich?«
»So genau weiß ich es nicht. Ich glaube, weil sie so gut erhalten ist und weil ihr Erscheinungsbild so einzigartig ist.«
Albert und Heinrich lösten die Eintrittskarten. Dann begaben sie sich auf Entdeckungstour durch den riesigen Backsteinbau. Albert war besonders von den ausgestellten historischen ermländischen Gebrauchsgegenständen beeindruckt. Gerne hätte er sie fotografiert. Doch das war nicht erlaubt. Überall hingen Verbotsschilder, und das Aufsichtspersonal war ständig auf der Hut. Keine Chance also für einen Schnappschuss. Könnte wohl Ansprüche der früheren Eigentümer nach sich ziehen, wenn sie diese Dinge auf einem Foto entdecken, meinte er später zu Heinrich, als sie den Rückweg ins Hotel antraten.
Am Abend hatten sie Gesellschaft bekommen. Ein Ehepaar hatte am Tisch nebenan Platz genommen: Erwin und Elfriede Hippel aus Berlin-Charlottenburg. Sie befanden sich auf einer Ermland-Expedition in Sachen Familienchronik und erwiesen sich als äußerst mitteilungsbedürftig. Besonders Erwin Hippel. Auffällig waren seine »Berliner Schnauze« und sein Bierbauch, den er wie eine Trophäe vor sich her trug. Hippel war von kleiner Statur, und ein Meckischnitt zierte seinen kleinen runden Kopf. Seine Frau wirkte hingegen eher etwas farblos, ja fast unauffällig. Sie trug eine dicke Hornbrille. Wenn Erwin erzählte, nickte Elfriede oder sein »Friedchen«, wie er sie liebevoll nannte, zuweilen selbstzufrieden und zustimmend mit dem Kopf.
»Wissen Sie, meine Frau, die stammt aus Heilsberg – und wir haben uns beim hiesigen Standesamt ein paar alte Heiratsurkunden kopieren lassen. Der Hotelier war so freundlich und hat uns einen Dolmetscher besorgt.«
Mit einem schnellen und geübten Handgriff fischte Erwin Hippel aus Charlottenburg einen Laptop hervor, den er wohl schon eine Weile zuvor neben seinem Stuhl abgestellt hatte, und breitete sich damit vereinnahmend auf dem Tisch aus.
»Schauen se mal«, meinte er, nachdem alle auf den Augenblick gewartet hatten, dass das Gerät seinen Betrieb aufnehmen konnte. »Dat iss unser Stammbaum.«
Albert und Heinrich waren beeindruckt. Sie erblickten auf dem Monitor einen riesigen Baum, einer, wie er sonst nur im Urwald zu Hause war, mit Hunderten von kleinen Verzweigungen und Verästelungen. Und an allen Enden prangten Namen und Jahreszahlen.
»Haben Sie die etwa alle im Kopf?«, wollte Albert wissen.
»Nee, nisch alle. Aber die meesten.«
Und dann, dann kam die Stunde des Erwin Hippel. Er lief zur Hochform auf, gerade so, als habe er auf diese Frage gewartet, berichtete er von hugenottischen Verwandten dritten Grades, von Bauernkriegen und ehrbaren Kaufleuten, von einem Scharfrichter in der fünften Generation und von einer jungen Frau mütterlicherseits, die nach einem Ehebruch im 17. Jahrhundert qualvoll auf einem Scheiterhaufen endete.
»Tja, scheußliche Sache«, meinte Albert und nippte an seinem Bier. Es war bereits das zweite, das er sich an diesem Abend bestellt hatte. Für ihn war es so, als wollten sich die Wurzeln dieses wundervollen Stammbaumes um den Tisch winden. Dieser Stammbaum, er nahm Besitz von jedem und allem.
»Erwinchen, erzähl den Herrschaften doch mal von unserem Herrgottschnitzer«, meldete sich völlig unerwartet Elfriede zu Wort. Sie hatte die ganze Zeit den Worten ihres Mannes andächtig gelauscht, was wohl Teil ihrer von Gott gegebenen Bestimmung war.
»Herrgottschnitzer? Meinen Sie etwa den Lipow?«, mischte sich Heinrich jetzt ein.
»Ja, genau den. Sie glauben ja nischt, wat wir jestern entdeckt haben.«
»Nun erzählen Sie schon, und spannen Sie uns nicht so auf die Folter«, drängelte Heinrich, der zunehmend neugieriger wurde.
»Also, meene Frau und icke, wir waren jestern auffe Heilsberger Waldfriedhof. Und wat glauben se, wat wir dort entdeckt haben?«
»Ja was denn?«
Zu Heinrichs Neugierde gesellte sich jetzt Ungeduld.
»Die Grabstätte meiner Schwiegerleute.«
»Das Grab existiert noch?«, fragte Heinrich verblüfft.
»Ja. Und das Beste kommt jetzt. Passen se jenau uff: Das Grabkreuz ist aus Holz. Und nun raten se mal, wer das anjefertigt hat.«
Ungläubig blickte Heinrich zu Hippel hinüber.
»Doch nicht etwa Michael Lipow?«
»Ja, jenau, der Michael Lipow.«
»Herr Hippel, da haben Sie aber einen Volltreffer gelandet.«
Heinrich wusste um dieses Kreuz, und er wusste auch um einen von Lipow gefertigten Tisch im Schlossmuseum.
»Ich erzähle Ihnen mal ein bisschen was über diesen Herrgottschnitzer.«
»Ach, Herr Ostrowski, det brauchen se nisch«, würgte Hippel Heinrichs Offerte ab.
»Wir haben uns schon informiert. Nisch wahr, Friedchen!«
»Ja, Herr Ostrowski, mein Mann hat sich in dem Internet informiert. Da hat er alles und noch viel mehr über den Herrn Lipow entdeckt.«
»Sehen Sie«, nickte Hippel. »Mein Friedchen und ich, wir sind bestens vorbereitet jewesen. «
Es gefiel Heinrich ganz und gar nicht, dass er jetzt nicht zum Zuge kam. Doch was sollte er tun? Also überließ er Erwin Hippel das Feld, der mit seinen Schilderungen urplötzlich und völlig unerwartet ins reine Hochdeutsch wechselte.
»Lipow, meine Herrschaften, also Lipow, der stammte aus einer deutschen Müller-Familie in Rschew, das etwa 250 Kilometer von Moskau entfernt liegt. Er entdeckte sehr früh die Kunst als den Inhalt seines Lebens«, erzählte Hippel, dialektfrei, gerade so als habe er die Sätze auswendig gelernt.
»Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges musste er mit seiner Familie Russland für immer verlassen. Er zog nach Hannover, später nach Königsberg, wo er sein Studium beendete und seine künftige Frau Martha Hohmann hier aus Heilsberg kennenlernte. Schließlich fand er 1923 auch in Heilsberg seine Heimat. Sein schöpferisches Wirken können wir bis heute in vielen Kirchen und auf einigen Friedhöfen des Ermlands bewundern. Seine Heiligenstatuen, Grab- und Weg-Kreuze zieren Kirchen und Friedhöfe rund um die Stadt, aber auch die Wallfahrtskirche Heiliglinde und andere Orte. Als Restaurator arbeitete er ebenfalls an der Renovierung vieler Figuren und Bilder. Ob Holz, Stein oder Leinwand – Lipow ist sich selbst immer treu geblieben. Nach der Flucht vor der Roten Armee im Winter 1945 zog er nach Künzelsau in den heutigen Hohenlohekreis in der Nähe von Schwäbisch Hall. Dort war er bis ins hohe Alter von 92 Jahre tätig. Er starb als sozusagen »zweimal Heimatvertriebener« in Künzelsau im Jahr 1983. Seine Kunst im Ermland und im Hohenlohekreis beweist die Richtigkeit seiner Haltung gegenüber dem Schmerz des Heimatverlustes. »Arbeiten ist besser als Nüschtstun«, hat er einmal gemeint.«
Erwin Hippel konnte seine Begeisterung nicht verbergen.
»Is det nisch fantastisch. Da finden wir een Grab von unseren Vorfahren, und dann wurde det Kreuz auch noch von so einem janz berühmten Mann jefertigt!«
Albert und Heinrich pflichteten ihm bei. Und auch Friedchen nickte – für alle ein wenig unerwartet – freudig mit dem Kopf.
Dann verabschiedete sich Hippel, nachdem er die familiengeschichtliche Sensation in allen Details zum Besten gegeben hatte, von seinem Stammbaum und wechselte das Thema.
»Woher kommen Sie eigentlich, Herr Ostrowski?«
»Ich stamme aus der Nähe von Guttstadt, aus einer alten Bauernfamilie. Keiner gehenkt oder verbrannt. Hugenotten oder Schnitzer gibt es auch keine«, scherzte Heinrich.
»Und Sie?«, wandte sich der Familienforscher Albert zu. »Woher stammen Sie?«
»Aus Klotainen, das liegt hier gerade um die Ecke.«
»Stammt Ihre Familie von dort?«
»Meine Mutter wurde in Raunau geboren. Mein Vater in Elbing.«
»Elbing an der Ostsee?«, fragte Hippel neugierig.
»Ja.«
»Muss eine wunderschöne Stadt gewesen sein, bevor die Russen alles kurz und klein gebombt haben.«
»Ja, das war es auch.«
»Elbing stand Danzig in nichts nach«, fügte Heinrich ein, der jetzt seine Chance gewittert hatte.
»Wissen Sie, in Elbing wurde 1828 das erste Dampfschiff Ostpreußens gebaut. In den Jahren von 1840 bis 1858 ließ der königlich-preußische Baurat Georg Steenke den Oberländischen Kanal zwischen Deutsch Eylau, Osterode und Elbing anlegen. Bereits 1853 konnte die Eisenbahnlinie nach Königsberg fertig gestellt werden. Elbing war eine Industriestadt. Hier erhielt die SPD stets die Mehrheit der Wählerstimmen. Die Stadt hat viele Fabriken, die unter anderem auch Lokomotiven herstellen, dann die Zigarrenfabrik Loeser & Wolff, eine große Brauerei und Schnapsbrennerei, eine Schokoladenfabrik, eine Autofabrik und natürlich die Schichau-Werke.«
»Da hat mein Großvater als Werkzeugmacher gearbeitet.«
Albert hatte angeregt zugehört und ergriff jetzt wieder das Wort.
»Er erzählte seinen Kindern immer, dass schon im 13. Jahrhundert in Elbing Schiffe gebaut worden seien. Die Elbinger Handelsherren hätten ihre Schiffe vor Ort in eigener Werft und nach eigenen Wünschen bauen lassen. Mein Vater hat nie viel von meinem Großvater erzählt und wenn, dann ließ er kein gutes Haar an ihm. Die beiden hatten wohl nicht das innigste Verhältnis zueinander. Ich selbst habe meinen Großvater nie zu Gesicht bekommen.«
»Wie kam das?«
»Weiß nicht. Offenbar interessierte dieser sich mehr für seinen Beruf als für seine Kinder oder Enkel.«
»Hat Ihr Vater bei Ihnen zu Hause über die Zeit in Elbing erzählt?«, hakte Hippel nach.
»Manchmal – meistens immer dann, wenn er aus Miggegrets Kneipe zurückkam, einen gesäuselt hatte und wir Kinder noch in der Wohnstube zu Tisch saßen. Nach dem Essen hockte er sich dann mit uns an den Kachelofen und erzählte – manches Mal auch von seiner Kindheit in Elbing.«