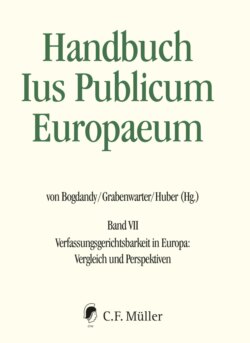Читать книгу Handbuch Ius Publicum Europaeum - Monica Claes - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhalt Band VII
ОглавлениеVorwort
Verfasserinnen und Verfasser
§ 110 Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa
I. Die Perspektive des europäischen Rechtsraums: Begriffliche und methodologische Prämissen1 – 29
1. Einleitung1 – 7
2. Der Ausgangspunkt: Die justiziable Verfassung8 – 12
3. Zur „Dekonstruktion“ des heutigen Begriffs13 – 16
4. Zum zeitlichen Rahmen17 – 25
5. Die Perspektive des europäischen Rechtsraums26 – 29
II. Ansätze der Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Parallele Entwicklungen bis 191830 – 69
1. Richterliches Prüfungsrecht31 – 44
a) Eine fortdauernde Frage31 – 34
b) Die monarchische Schwierigkeit35 – 39
c) Die nationale Schwierigkeit40 – 42
d) Eine fast existenzielle Frage: Die Verfassung in den skandinavischen Ländern43
e) Der portugiesische Sonderweg: Diffuse Normenkontrolle in der Verfassung von 191144
2. Staatsgerichtsbarkeit (Verfassungsstreitigkeiten)45 – 56
a) Verfassungsorganstreit50 – 52
b) Föderale Streitigkeiten53 – 56
3. Bürgergerichtsbarkeit (Grundrechte-Gerichtsbarkeit)57 – 64
4. Zwischenbilanz bis 1918: Fragmente65 – 69
III. Verfassungsgerichtsbarkeit als evolutionäre europäische Errungenschaft: Konvergierende Entwicklungen seit 191870 – 164
1. Die Zwischenkriegszeit: Zwischen Kontinuität und Abbruch (1918–1939)71 – 99
a) Der lange Schatten des 19. Jahrhunderts: Kontinuitätslinien72 – 74
aa) Kontinuität im stabilen Konstitutionalismus72
bb) Kontinuität auch im neuen Konstitutionalismus73, 74
b) Der Fall Weimar, zwischen Kontinuität und Abbruch (1919–1933)75 – 80
c) Der Kelsenian moment81 – 98
aa) „Hauptstadt Wien“: Der Verfassungsgerichtshof (1920–1933)85 – 89
bb) Brno: Das tschechoslowakische Verfassungsgericht (1920–1938)90 – 94
cc) Madrid: Das „Tribunal de Garantías Constitucionales“ (1931–1939)95 – 97
dd) Liechtenstein (1925)98
d) Bilanz der Zwischenkriegszeit99
2. Konstante Ausbreitung der Verfassungsgerichte in Westeuropa (1945–1989)100 – 132
a) Die Nachkriegszeit: Verfassungsrestaurierung und Verfassungsneuschöpfung101 – 109
aa) Verfassungsrestaurierung: Der österreichische Verfassungsgerichtshof102, 103
bb) Hauptstadt Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht104 – 107
cc) Die Corte costituzionale108, 109
b) Übergangsjahre (1956–1974): Erste Schritte in der Umwandlung des französischen Conseil constitutionnel110 – 115
c) Verfassungsnachholung in Südeuropa (1974–1978)116 – 122
aa) Griechenland117
bb) Spanien118 – 120
cc) Portugal121, 122
d) Verfassungsgerichte via Verfassungsänderung: Belgien, Luxemburg, Andorra123 – 127
e) Verfassungsgerichtsbarkeit ohne Grenze? Verfassungsinterpretation als primäre Aufgabe der Verfassungsgerichte128 – 132
3. Verfassungsgerichtsbarkeit ohne Mauer (1989–2009)133 – 162
a) Die Verfassungsgerichte der europäischen Wende135 – 153
aa) Polen139 – 141
bb) Ungarn142 – 146
cc) Tschechien147 – 149
dd) 1989: Ein harter Test für die Verfassungsgerichtsbarkeit150 – 153
b) Supranationale Verfassungsgerichte? EGMR und EuGH154 – 162
aa) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte155, 156
bb) Der Gerichtshof der Europäischen Union157 – 161
cc) Der Verbund der europäischen Verfassungsgerichte162
4. 1918–2009: Das Jahrhundert der Verfassungsgerichte163, 164
IV. Gesamtrückblick: Das Evolutionäre der Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa165 – 168
Bibliographie
§ 111 Die Verfassungsgerichtsbarkeit in ex-Jugoslawien in der Perspektive des europäischen Rechtsraums
I. Einleitung1 – 11
1. Ältere Vergangenheit: Der historische Kontext Jugoslawiens3 – 6
2. Jüngste Vergangenheit: Der mittel- und osteuropäische Transformationskontext7 – 9
3. Die Zukunft: Der europäische Rechtsraum10, 11
II. Europäischer Rechtsraum, sozialistische Rechtskultur und die transformatorische Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit12 – 24
1. Rechtskultur und Verfassungsgerichtsbarkeit13 – 17
2. Die sozialistische Rechtskultur und ihre (Un-)Vereinbarkeit mit dem europäischen Rechtsraum18 – 24
III. Die rechtliche Ausgestaltung der Verfassungsgerichte: jugoslawisches Erbe oder/und Aufbruch zum europäischen Rechtsraum?25 – 68
1. Die Verfassungsgerichte als Institutionen26 – 42
a) Zusammensetzung30 – 33
b) Wahlverfahren und Mandat34 – 40
c) Ausführung der Verfassung durch ein Gesetz oder eine Geschäftsordnung des Gerichts?41, 42
2. Verfassungsgerichtliche Verfahrensarten43 – 55
a) Abstrakte Normenkontrolle44 – 51
aa) Der historische Hintergrund45 – 48
bb) Die gegenwärtigen Regelungen49 – 51
b) Konkrete Normenkontrolle52
c) Die Verfassungsbeschwerde53
d) Die anderen Verfahren54
e) Die Praxis der Verfahrensarten55
3. Die Entscheidungen und ihre Rechtsfolgen56 – 68
a) Der historische Hintergrund56 – 58
b) Die gegenwärtigen Ausgestaltungen verfassungsgerichtlicher Entscheidungen59 – 68
aa) Das Zustandekommen der verfassungsgerichtlichen Entscheidungen59 – 63
bb) Die rechtlichen Wirkungen64 – 68
IV. Umfang und Grenzen des Verbunds im europäischen Rechtsraum69 – 134
1. Die Rolle der Verfassungsgerichte im nationalen politischen Kräftespiel72 – 112
a) Aktivismus als politische Opposition74 – 88
aa) Oppositionelle Strategien: allgemeine Trends im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina77 – 79
bb) Gefolgschaftstreue Strategien: allgemeine Trends in Serbien, Mazedonien und Montenegro80 – 82
cc) Zwischen Aktivismus und Zurückhaltung: allgemeine Trends in Kroatien und Slowenien83 – 88
b) Aktivismus als Beitrag zur Transformation89 – 101
aa) Wichtige Inhalte im Hinblick auf verfassungsrechtliche Grundsätze90 – 95
bb) Politisch brisante Fragen96 – 101
c) Öffentliche Wahrnehmung und Legitimierung102 – 112
aa) Das gerichtliche Ansehen103 – 109
bb) Was tragen die Verfassungsgerichte selbst zu ihrer Legitimation bei?110 – 112
2. Die Rolle der Verfassungsgerichte im europäischen Rechtsverbund113 – 134
a) Auslegungsmethoden und juristisches Denken: zum Wandel der Rechtskultur114 – 119
aa) Art, Stil und Methoden der Auslegung115 – 117
bb) Urteilsstil118, 119
b) Das Verhältnis zum Völker- und Europarecht: Umsetzungs- und Übersetzungsfunktionen120 – 134
aa) Die EMRK122 – 124
bb) Das EU-Recht125 – 134
V. Schlussbemerkung135 – 138
Bibliographie
§ 112 Die Bestellung der Richter in vergleichender Perspektive
I. Einleitung1, 2
II. Ausgestaltung des Bestellungsverfahrens3 – 34
1. Die Zuständigkeit zur Bestellung3 – 15
a) Der Kreis der zuständigen Organe3, 4
b) Verteilung der Zuständigkeit zur Wahl auf mehrere Organe5 – 11
c) Im Besonderen: Die Bestellung des Präsidenten12 – 15
2. Die Mitwirkung von Ausschüssen16 – 20
3. Anhörungen21 – 25
4. Öffentlichkeit des Bestellungsvorgangs26, 27
5. Mehrheitserfordernisse28
6. Sonderformen der Bestellung (Kooptierung, ex lege-Mitgliedschaften)29, 30
7. Faktische Entscheidungsmacht jenseits der Organzuständigkeiten31 – 33
8. Regelungen im Fall von Konflikten und Verzögerungen34
III. Materielle Voraussetzungen für das Amt35 – 52
1. Staatsangehörigkeit35 – 39
2. Mindestalter40, 41
3. Juristische Qualifikation42 – 44
4. Mindestdauer richterlicher oder rechtsberuflicher Tätigkeit vor der Ernennung45 – 50
5. Ethisch-moralische Standards51, 52
IV. Rückwirkungen der Ausgestaltung des Amtes auf die Bestellung der Richter53 – 62
1. Attraktivität des Amtes als Folge von Prestige und materieller Ausstattung53 – 55
2. Unvereinbarkeit mit anderen Ämtern oder politischer Tätigkeit56 – 59
3. Kultur der Bestellung und Distanz zur Politik60 – 62
V. Die Zusammensetzung des Gerichts63 – 67
VI. Europarechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen68 – 76
1. Europäische Menschenrechtskonvention EMRK (Art. 6 EMRK, Art. 34 EMRK)68 – 71
2. Unionsrecht (Art. 267 AEUV, Art. 47 GRC)72 – 74
3. Soft law aus der Praxis der Venedig-Kommission75, 76
VII. Auswahl und Bestellung der Richter des EuGH und des EGMR als Spiegel nationaler Anforderungen77 – 80
1. Auswahl der Richter des EuGH77
2. Auswahl der Richter des EGMR78, 79
3. Schlussfolgerungen für die Betrachtung der nationalen Gerichte80
VIII. Ziele und Prinzipien in der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung der Richterbestellung81 – 101
1. Konkrete Ziele82 – 88
a) Erfahrung der Richter82, 83
b) Rechtlicher Sachverstand84, 85
c) Unabhängigkeit und Unparteilichkeit86
d) Pluralismus87
e) Distanz zu politischen Entscheidungsträgern88
2. Allgemeine Verfassungsprinzipien89 – 101
a) Rechtsstaatlichkeit90 – 94
b) Demokratische Legitimation95 – 98
c) Gewaltenteilung99 – 101
IX. Der Fall Polen: Missachtung von Bestellungsregeln als erster Schritt der Demontage eines Gerichts102 – 109
1. Der verfassungsrechtliche Rahmen103
2. Die Vorgeschichte104
3. Die Richterwahlen im Jahr 2015105
4. Die Gesetzesänderungen im Dezember 2015 und ihre Auswirkungen106 – 109
X. Schluss110 – 116
Bibliographie
§ 113 Die wichtigsten verfassungsgerichtlichen Verfahren im europäischen Rechtsraum
I. Einleitung1 – 5
II. Normenkontrolle als Kernkompetenz der Verfassungsgerichtsbarkeit6 – 39
1. Fehlen eines einheitlichen Modells der Normenkontrolle im europäischen Rechtsraum6, 7
2. Gegenstand und Prüfungsmaßstab der Normenkontrolle8 – 16
3. Grundtypen der Normenkontrolle17 – 36
a) Vorbemerkung: Zunehmende Einheit in der Vielfalt17
b) Präventive und repressive Normenkontrolle18 – 24
aa) Präventive Normenkontrolle19 – 23
bb) Repressive Normenkontrolle24
c) Abstrakte und konkrete Normenkontrolle25 – 36
aa) Abstrakte Normenkontrolle25 – 28
bb) Konkrete Normenkontrolle29 – 36
4. Komplexität der Entscheidungswirkungen37 – 39
III. Organstreitverfahren: das Stiefkind der Verfassungsgerichtsbarkeit40 – 81
1. Fehlende und lückenhafte Regelung des Organstreitverfahrens40 – 42
2. Hauptformen des Organstreits im europäischen Rechtsraum43 – 57
a) Organstreit als „klassischer“ Kompetenzkonflikt zwischen den Staatsgewalten44 – 51
aa) Überblick44 – 46
bb) Italien: das Organstreitverfahren als Instrument zum Schutz der Judikative47 – 51
b) Organstreitverfahren als Streit um Befugnisse und Kompetenzen von Verfassungsorganen und Organteilen52 – 57
aa) Überblick52, 53
bb) Deutschland: das Organstreitverfahren als Instrument des politischen Minderheitenschutzes54 – 57
3. Nicht-kontradiktorische Formen der Klärung von Organkompetenzen58 – 63
4. Gegenstand des Organstreitverfahrens64 – 70
5. Subsidiarität des Organstreitverfahrens71 – 78
6. Entscheidungswirkungen79 – 81
IV. Individualbeschwerde: die Zukunft der Verfassungsgerichtsbarkeit?82 – 110
1. Verfassungsrechtliche Individualbeschwerde als Herzstück des Individualrechtsschutzes82 – 87
2. Hauptformen der Individualbeschwerde im europäischen Rechtsraum88 – 97
3. Gegenstand und Prüfungsmaßstab der Individualbeschwerde98 – 105
4. Beschwerdebefugnis106 – 108
5. Rechtswegerschöpfung109
6. Entscheidungswirkungen110
V. Schlussbemerkung111 – 113
Bibliographie
§ 114 Verfassungsgerichtliche Argumentation im europäischen Rechtsraum
I. Einleitung1 – 3
II. Verfassungsgerichtliche Argumentation im Allgemeinen4 – 18
1. Verfassungs- vs. Gesetzesauslegung10 – 16
2. Struktur der Argumente17, 18
III. Nichtinterpretative Argumente19 – 32
1. Analogien21 – 28
2. Argumente über die Geltung des Verfassungstexts29
3. Argumente über die Anwendung oder Nicht-Anwendung des Verfassungstexts30 – 32
IV. Interpretative Argumente (Auslegungsmethoden)33 – 107
1. Wortlautinterpretation44 – 46
2. Systematische Argumente: Argumente aus dem rechtlichen Kontext47 – 70
a) Harmonisierende Argumente48 – 53
b) Hinweis auf die Verfassung interpretierende Gerichtsentscheidungen54 – 63
c) Verfassungsinterpretation im Lichte ungeschriebener Grundprinzipien oder Grundbegriffe64, 65
d) Auf Stillschweigen gegründete sprachlich-logische Formeln66 – 70
3. Wertende Argumente71 – 90
a) Der Zweck der Norm (objektiv-teleologische Auslegung)72 – 79
b) Die historische Intention des Verfassunggebers (subjektiv-teleologische Argumente)80 – 86
c) Nichtrechtliche (moralische, ökonomische) Argumente87 – 90
4. Inspirative Argumente91 – 97
a) Hinweise auf die Rechtswissenschaft92, 93
b) Rechtsvergleichende Argumente94 – 97
5. Das Verhältnis zwischen den Methoden98 – 107
V. Das spezifische Begriffssystem des jeweiligen Verfassungsrechts als Charakteristikum der verfassungsgerichtlichen Argumentation108 – 113
VI. Allgemeine Popularität einzelner Argumente und globale Tendenzen – die tatsächliche Argumentationspraxis der Verfassungsgerichte114 – 132
1. Allgemeine Popularität einzelner Argumente115 – 117
2. Globale Tendenzen118 – 120
3. Tatsächliche Praxis rechtsvergleichender Argumente an Verfassungsgerichten121 – 132
VII. Nationale Besonderheiten einiger verfassungsgerichtlicher Argumentationsstile133 – 152
1. Österreich und Deutschland: Schwerpunkt Verfassungsdogmatik134 – 141
2. Frankreich und das Vereinigte Königreich: Die begrenzte Verfassungsgerichtsbarkeit bringt eine begrenzte Begriffsverfeinerung142 – 148
3. Ungarn und Spanien: Nach der Diktatur folgt man dem deutschen Vorbild149 – 152
VIII. Gibt es einen europäischen Stil der verfassungsgerichtlichen Argumentation?153 – 158
Bibliographie
§ 115 Verfassungsgerichtliche Legitimität im europäischen Rechtsraum: eine institutionell-verfahrensrechtliche Perspektive
I. Neuer Schwung für eine alte Debatte1 – 12
1. Die counter-majoritarian difficulty als Klassiker des Verfassungsrechts1, 2
2. Die zunehmende Thematisierung verfassungsgerichtlicher Legitimität in Europa3 – 9
3. Ansatz und Aufbau des Beitrags10 – 12
II. Verfassungsgerichtliche Legitimität und gerichtliche Zuständigkeit13 – 35
1. Die Zuständigkeit zur abstrakten Normenkontrolle18 – 25
2. Zusätzliche Kompetenzen26 – 31
3. Klage- und Antragsbefugnis32 – 35
III. Techniken verfassungsgerichtlichen Entscheidens36 – 67
1. Gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum, Verfahrenskontrolle und Urteilsbegründung37 – 42
2. „Zurückhaltende“ Entscheidungstechniken43 – 67
a) Die verfassungskonforme Auslegung44 – 54
b) Die vorläufige Verfassungsmäßigkeit55 – 60
c) Die Unvereinbarkeitserklärung61 – 65
d) Das Aufschieben der Nichtigerklärung66, 67
IV. Verfassungsgerichte und Verfassungsgesetzgeber68 – 75
V. Schlussbemerkungen76 – 78
Bibliographie
§ 116 Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltengliederung im europäischen Rechtsraum
I. Einleitung1 – 24
1. Fragestellung und Gang der Untersuchung1 – 6
2. Institutionelle Modelle der Verfassungsgerichtsbarkeit7 – 24
a) Geltungssicherung durch Parlamente11 – 13
b) Geltungssicherung durch die Gerichtsbarkeit14 – 16
c) Geltungssicherung durch spezialisierte Verfassungsgerichte17 – 24
II. Sicherung der Gewaltengliederung durch Verfassungsgerichtsbarkeit25 – 68
1. Sicherung der horizontalen Gewaltengliederung26 – 56
a) Sicherung der horizontalen Gewaltengliederung im Frühkonstitutionalismus27 – 29
b) Sicherung der horizontalen Gewaltengliederung in demokratischen Verfassungsordnungen30 – 56
aa) Horizontale Gewaltengliederung in Systemen mit Geltungssicherung durch Parlamente32 – 34
bb) Horizontale Gewaltengliederung in Systemen mit Geltungssicherung durch die Gerichtsbarkeit35 – 39
cc) Horizontale Gewaltengliederung in Systemen mit Geltungssicherung durch spezialisierte Verfassungsgerichte40 – 56
(1) Horizontale Gewaltengliederung durch Organstreitverfahren42 – 49
(2) Horizontale Gewaltengliederung durch andere Verfahrensarten50 – 56
2. Sicherung der vertikalen Gewaltengliederung57 – 68
a) Zentralisierung öffentlicher Gewalt durch Vergerichtlichung im Frühkonstitutionalismus58, 59
b) Sicherung der vertikalen Gewaltengliederung in demokratischen Verfassungsordnungen60 – 68
aa) Schutz gliedstaatlicher Kompetenzen durch Verfassungsgerichtsbarkeit61 – 63
bb) Prekärer Schutz bei Vereinnahmung der Verfassungsgerichtsbarkeit64 – 68
III. Bedrohung der Gewaltengliederung durch die Verfassungsgerichtsbarkeit?69 – 144
1. Verfassungsgerichtsbarkeit und demokratisch legitimierte Gesetzgebung72 – 78
2. Materielle Gesetzeskontrolle in Verfassungsordnungen mit parlamentarischer Geltungssicherung79 – 93
a) Professionalisierung und Vergerichtlichung81 – 87
b) Aufwertung der Gerichtsbarkeit durch Europäisierung und Internationalisierung88 – 93
3. Materielle Gesetzeskontrolle in Verfassungsordnungen mit gerichtlicher Geltungssicherung94 – 96
4. Materielle Gesetzeskontrolle in Verfassungsordnungen mit spezialisierten Verfassungsgerichten97 – 144
a) Zeitpunkt der materiellen Gesetzeskontrolle99 – 102
b) Verfahren der materiellen Gesetzeskontrolle103 – 115
aa) Materielle Gesetzeskontrolle durch Normenkontrollverfahren104, 105
bb) Materielle Gesetzeskontrolle durch Individualbeschwerdeverfahren106 – 115
c) Verwerfungskompetenz und Bindungswirkung116 – 123
aa) Umfang der Verwerfungskompetenz118, 119
bb) Bindungswirkung und Durchsetzung der Entscheidung120, 121
cc) Reaktionsmöglichkeiten der Legislative122, 123
d) Entscheidungstypen und verfassungsgerichtliche Argumentation124 – 136
aa) Verfassungsgerichte als „negative“ oder „positive“ Gesetzgeber127 – 130
bb) Die Formulierung von Handlungspflichten bei gesetzgeberischem Unterlassen131 – 134
cc) Verfassungskonforme Auslegung135
dd) Anforderungen an die Begründung von Gesetzen136
e) Transformation der materiellen Gesetzeskontrolle aufgrund des unionalen Grundrechtsschutzes137 – 144
IV. Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltengliederung im europäischen Rechtsraum145 – 185
1. Sicherung der vertikalen Gewaltengliederung durch Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Rechtsraum148 – 169
a) Präventive transnationale Kompetenzkontrolle150 – 154
b) Nachträgliche transnationale Kompetenzkontrolle155 – 162
c) Ansätze zur institutionellen und prozeduralen Konfliktbearbeitung163 – 169
2. Materielle Kontrolle supranationaler Rechtsakte durch nationale Verfassungsgerichte170 – 185
a) Überlappende Verfassungen und Maßstabssuche im europäischen Rechtsraum171 – 176
b) Verfassungsgerichtsbarkeit als Hüterin der Verfassungsidentität177 – 185
V. Schlussfolgerungen für das Verhältnis von Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltengliederung im Kontext transnationalisierter öffentlicher Gewalt186 – 189
Bibliographie
§ 117 Verfassungsgerichtsbarkeit und Grundrechtsschutz in Europa
I. Verfassungsgerichtsbarkeit und Grundrechtsschutz1, 2
II. Verfassungsgerichtsbarkeit, Grundrechtsschutz und Stufenbau der Rechtsordnung3 – 9
III. Entwicklung des verfassungsgerichtlichen Grundrechtsschutzes10 – 73
1. Der Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika als Vorbild?11, 12
2. Weichenstellung im Jahr 184813 – 17
a) Subsidiarität gerichtlichen Grundrechtsschutzes – das Schweizerische Bundesgericht14
b) Prävalenz gerichtlichen Grundrechtsschutzes – das Reichsgericht der Frankfurter Paulskirche15 – 17
3. Durchbruch verfassungsgerichtlicher Grundrechtskontrolle in den Jahren 1867/187418 – 23
a) Das Reichsgericht der österreichischen Verfassung 1867 als erstes effektives europäisches Grundrechtsgericht19, 20
b) Die staatsrechtliche Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht nach der Verfassungsrevision 187421 – 23
4. Die Verknüpfung von Grundrechtsschutz und Gesetzesprüfung nach dem Ersten Weltkrieg24 – 34
a) Schutz der Grundrechte gegenüber Exekutive und Legislative durch die postaltösterreichischen Verfassungsgerichte 1919/192025 – 30
b) Grundrechtsschutz unter schwierigen Bedingungen – Das spanische Tribunal de Garantías Constitucionales der Verfassung 193131 – 34
5. Schutz der Grundrechte als kardinale Aufgabe der Verfassungsgerichte nach dem Zweiten Weltkrieg35 – 64
a) Die italienische Corte costituzionale und das deutsche Bundesverfassungsgericht als Ausprägungen unterschiedlicher Modelle36 – 42
b) Auf dem Weg zu Bürgergerichten – der französische Conseil constitutionnel und der belgische Verfassungsgerichtshof43 – 51
c) Bürgergerichte unterschiedlicher Modellierung – das spanische bzw. das portugiesische Tribunal Constitucional52 – 58
d) Osteuropäische Verfassungsgerichte als Grundrechtshüter – das polnische und das ungarische Beispiel59 – 64
6. Grundrechtsschutz ohne Verfassungsgerichtsbarkeit – das finnische und das niederländische System65 – 70
7. Zwischenbilanz71 – 73
IV. Europäisierung des Grundrechtsschutzes74 – 102
1. Die unitarisierende Wirkung der EMRK75 – 86
a) Affirmation durch Verfassungsrang – die EMRK als zentraler Grundrechtskatalog in Österreich76, 77
b) Die EMRK als Hebel für Kompetenzerweiterungen der Verfassungsgerichte – das italienische und das schweizerische Beispiel78 – 82
c) Die konventionskonforme Auslegung als konsentierte Praxis83 – 86
8. Die Europäische Grundrechte-Charta als weiteres Instrument der Grundrechtshomogenisierung87 – 102
a) Innerstaatlicher Grundrechtsschutz als Schranke des Vorrangs des Europarechts88 – 91
b) Der Ausbau des europarechtlichen Grundrechtsschutzes und der Druck auf die innerstaatlichen Grundrechte92 – 95
c) Der Versuch eines modus vivendi zwischen EuGH und Verfassungsgerichten – das französische und das österreichische Beispiel96 – 98
d) Jedes Gericht ein Grundrechtsgericht und der EuGH als europäischer Supreme Court?99 – 102
V. Bilanz103
Bibliographie
§ 118 EuGH und EGMR: zwei Senate einer europäischen Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Zwei Senate einer Verfassungsgerichtsbarkeit?1 – 5
II. Die reduktionistische Logik der frühen Jahre6 – 17
1. Der EuGH: ein europäisches Verwaltungsgericht7 – 11
2. Der EGMR: eine liberal-demokratische Rückfallversicherung12 – 17
III. Meilensteine zu einer europäischen Verfassungsgerichtsbarkeit18 – 85
1. Der Erste Senat: europäische Einheitsbildung20 – 49
a) Europäische Gesetzgebung als Schlüsselidee21 – 23
b) Unionsseitige Verfassungsgerichtsbarkeit24 – 40
aa) Der EuGH als vermeintlich unzulängliches Kompetenz- und Grundrechtsgericht26 – 31
bb) Die prozedurale Immunisierung europäischer Gesetzgebung32 – 35
cc) Organstreitverfahren: die kooperative Ausrichtung der Organbeziehungen36 – 40
c) Mitgliedstaatsseitige Verfassungsgerichtsbarkeit41 – 49
aa) Die Konstitutionalisierung der Unionsverträge42 – 45
bb) Das Vorabentscheidungsverfahren als konkrete Normenkontrolle46 – 49
2. Der Zweite Senat: die Verankerung europäischer Menschenrechte50 – 85
a) Die Verankerung europäischer Menschenrechte als Schlüsselidee51 – 57
b) Verfassungsgerichtliche Instrumente zur Verankerung europäischer Menschenrechte58 – 77
aa) Die verfassungsrechtliche Auslegung der EMRK59 – 68
bb) Artikel 34 EMRK als Verfassungsbeschwerde69 – 77
c) Die Diversifizierung der verfassungsgerichtlichen Instrumente zur Verankerung europäischer Menschenrechte78 – 85
aa) Gesetzgebungsaufträge gegen systemische Defizite79 – 83
bb) Prozedurale Beurteilungsspielräume als Verankerungsanreiz84, 85
IV. Das Verhältnis von EuGH und EGMR: Komplementarität und Irritation86 – 93
V. Schluss94
Bibliographie
§ 119 Verfassungsgerichtliche Kooperation im europäischen Rechtsraum
I. Allgemeine Aspekte – die verfassungsgerichtliche Kooperation als Grundelement des Ius Publicum Europaeum1 – 28
1. Die gerichtliche Kooperation in Europa – (einige) Gründe für ihre zunehmende Bedeutung1 – 6
2. Verfassungsgerichtliche Kooperation im europäischen Mehrebenen-Verfassungsraum – das Zusammenspiel zwischen nationalen Verfassungsgerichten, EuGH und EGMR7 – 23
a) Der europäische Mehrebenen-Verfassungsraum als optimaler Schauplatz für verfassungsgerichtliche Kooperationen7, 8
b) Nationale Verfassungsgerichte als notwendiges Räderwerk für eine verfassungsgerichtliche Kooperation9 – 15
c) Der EuGH als Verfassungsgericht für eine einzigartige Rechtsgemeinschaft16 – 19
d) Der EGMR als Quasi-Verfassungsgericht für den europäischen Menschenrechtsraum20 – 23
3. Analyse der verfassungsgerichtlichen Kooperation in Europa – Grundelement des Ius Publicum Europaeum24 – 28
II. Verfassungsgerichtliche Kooperation innerhalb der EU – Beziehungen zwischen nationalen Verfassungsgerichten und EuGH29 – 78
1. Die gerichtliche Kooperation in der EU als eine dem Aufbau Europas inhärente Aufgabe – die zentrale Rolle der Vorabentscheidung29 – 34
2. Die Beziehungen zwischen dem EuGH und den einzelnen Verfassungsgerichten – die Geschichte eines ständigen „angespannten Friedens“35 – 65
a) Die Annäherung des EuGH an die nationalen Rechtsordnungen – auf der Suche nach Spezifität, unmittelbarer Wirkung und Vorrang des EU-Rechts37 – 45
b) Zur Annäherung der nationalen Verfassungsgerichte an das EU-Recht – eine Position zur Wahrung der übergeordneten Geltung der Verfassungen der Mitgliedstaaten46 – 65
aa) Grundrechte49 – 52
bb) Ultra-vires-Handlungen der Europäischen Union53 – 61
cc) Auseinandersetzung um die Letztentscheidung in Verfassungsfragen (Identität der Verfassung)62 – 65
3. Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die Verfassungsgerichte – ein Tabu wird gebrochen66 – 71
4. Letztendlich eine Bereicherung für beide Rechtsordnungen – der Weg zur cross-fertilization72 – 78
a) Bereicherung der Rechtsprechung der nationalen Gerichte73, 74
b) Bereicherung der Rechtsprechung des EuGH75 – 78
III. Verfassungsgerichtliche Kooperation innerhalb des Europarates (I) – Das gerichtliche Zusammenspiel zwischen dem EGMR und dem EuGH79 – 112
1. Die Annäherung des EuGH an die EMRK – eine bedachte, distanzierte und möglicherweise etwas utilitaristische Haltung79 – 85
2. Die Annäherung des EGMR an das EU-Recht – auf dem Weg zu einem ergiebigen Zusammenspiel zwischen EGMR und EuGH86 – 98
a) Von der anfänglichen Rivalität mit dem EuGH zu der jetzigen konstruktiven Zusammenarbeit86 – 88
b) Verwendung der Rechtsprechung des EuGH durch den EGMR – eine zusätzliche Quelle für die ergänzende Rechtfertigung der eigenen Rechtsprechung89 – 93
c) Meinungsverschiedenheiten sind unvermeidbar – auf dem Weg zu einem vernünftigen Gleichgewicht nicht ohne gewisse Auseinandersetzungen zwischen den Gerichten94 – 98
3. Die gerichtliche Kooperation zwischen EuGH und EGMR im rechtlichen Rahmen des Vertrags von Lissabon – der schwere Weg zum EMRK-Beitritt99 – 112
a) Der neue Rechtsrahmen nach dem Lissaboner Vertrag99 – 105
b) Der Schlag des EuGH gegen den Beitritt der Union zur EMRK106 – 112
IV. Verfassungsgerichtliche Kooperation innerhalb des Europarates (II) – EGMR und nationale Gerichte113 – 151
1. Grundlegende Elemente: Autonomie, Subsidiarität, Beurteilungsspielraum und Proportionalität113 – 127
a) Autonomie der EMRK-Begriffe114 – 118
b) Subsidiarität119, 120
c) Beurteilungsspielraum121 – 125
d) Proportionalität126, 127
2. Die Wirkung der Urteile des EGMR in den Einzelstaaten: die unerlässliche Kooperation der nationalen Richter128 – 140
a) Kein „self-executing“-Charakter der Urteile des EGMR128 – 133
b) Der bindende Charakter der EGMR-Entscheidungen134 – 136
c) Piloturteile137 – 140
3. Die notwendige Kooperation zwischen dem EGMR und den nationalen Verfassungsgerichten: potenzielle Effekte des neuen Protokolls 16141 – 151
a) Ausgewählte Beispiele für den gerichtlichen Dialog zwischen dem EGMR und den nationalen Verfassungsgerichten142 – 147
b) Das Protokoll 16: ein neuartiger Weg der verfassungsrechtlichen Kooperation zwischen dem EGMR und den höchsten nationalen Gerichten148 – 151
V. Informelle verfassungsgerichtliche Kooperationen – mehr als nur rein persönliche Beziehungen zwischen Richtern152 – 156
VI. Schlussbetrachtungen – auf dem Weg zur cross-fertilization im Rahmen einer verfassungsgerichtlichen Mehrebenen-Kooperation157 – 160
Bibliographie
§ 120 Der Einfluss von Unionsrecht und der EMRK auf die nationale Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Einleitung1 – 3
II. Die konzentrierte Verfassungsgerichtsbarkeit4 – 34
1. Das Ende des Kontrollmonopols von Gesetzen und des Privilegs des Gesetzgebers4 – 15
2. Das Ende der Lückenlosigkeit verfassungsgerichtlicher Kontrolle16 – 21
3. Das Ende der Letztentscheidungsbefugnis22 – 30
4. Das Ende der Außerordentlichkeit des verfassungsgerichtlichen Verfahrens31 – 34
III. Der Einfluss von Unionsrecht und EMRK auf Systeme ohne zentralisierte Verfassungsgerichtsbarkeit35 – 42
IV. Schlussbemerkung43 – 45
Bibliographie
§ 121 Rollen der nationalen Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Rechtsraum
I. Einleitung1 – 6
II. Verfassungsgerichte und ihr Weg in den europäischen Rechtsraum7 – 24
1. Konventionsrecht7 – 15
2. Unionsrecht16 – 24
III. Mitwirkung bei der europäischen Integration25 – 39
1. Mitwirkung bei der allgemeinen Entwicklung von Unionsrecht und seiner Rezeption in die nationale Rechtsordnung26 – 33
2. Mitwirkung bei der Rezeption des Konventionsrechts34 – 39
IV. Verfassungsgerichte und die Entwicklung eines gemeinsamen Verfassungserbes40 – 58
V. Verfassungsgerichte auf den Barrikaden59 – 74
VI. Vermittelnde Elemente: Artikel 53 der Grundrechtecharta und die Klausel zum Schutz der nationalen Identität75 – 84
1. Artikel 53 der EU-Grundrechtecharta75 – 81
2. Die Klausel der nationalen Identität82 – 84
VII. Schlussbemerkung85 – 88
Bibliographie
§ 122 Die Venedig-Kommission: Wesen, Arbeitsweise und Bedeutung im Verfassungsgerichtsverbund
I. Einleitung1 – 6
II. Die Rechtsgrundlagen7 – 12
1. Einrichtung als beratendes Expertengremium7 – 9
2. Vorgaben für die Schwerpunkte der Tätigkeit der Venedig-Kommission10 – 12
III. Die Arten der Dokumente13 – 16
1. Gutachten14
2. Studien, Berichte und Leitlinien15
3. Amicus Curiae-Stellungnahmen16
IV. Das Verfahren der Gutachtenserstellung17 – 21
V. Die Einwirkung der Dokumente auf die europäische Verfassungsentwicklung22 – 26
VI. Besonderheiten des Prozesses der Gutachtenserstellung27 – 47
1. Allgemeines27, 28
2. Die Auswahl der Gutachter29 – 33
3. Die Erstinformation34
4. Kommentare und Textvorschläge der Gutachter35 – 38
5. Besuche im Mitgliedstaat39, 40
6. Die Erstellung eines Gutachtensentwurfs („draft opinion“)41 – 43
7. Die Stellungnahme der Regierung44
8. Die Beratungen in den Unterkommissionen und im Erweiterten Büro45
9. Die Beratungen im Plenum46, 47
VII. Beobachtungen zu einigen Rahmenbedingungen der Herausbildung von Verfassungsstandards48 – 58
1. Name und Sitzungsort der Venedig-Kommission49, 50
2. Herkunft, Alter und berufliche Prägung der Mitglieder: Legitimation durch Expertise und Ansehen der Mitglieder51 – 55
3. Der Faktor Zeit56 – 58
VIII. Einige Reflexionen zur Entstehung der Texte59 – 66
IX. Organisatorische Grundlagen der Kooperation im Rahmen und im Umfeld der Venedig-Kommission67 – 71
X. Schlussbetrachtung72, 73
Bibliographie
§ 123 Verfassungsgerichtsbarkeit und Politik im europäischen Rechtsraum
I. Ausgangslage1 – 3
II. Rekrutierung, Status und Amtsverständnis der Verfassungsgerichtsbarkeit4 – 20
1. Rekrutierung der Richter4 – 12
a) Ausschließliche Parlamentszuständigkeit5 – 7
b) Geteilte Ernennungsrechte8
c) Entpolitisierte Personalauswahl9
d) Begrenzte Politisierung10, 11
e) Parteipolitische Überformung12
2. Herkunft und Amtsverständnis13 – 18
3. Status und Unabhängigkeit19, 20
III. Verfassungsgerichtsbarkeit, Politik und Öffentlichkeit21 – 40
1. Die politische Dimension der Verfassungsrechtsprechung21, 22
2. Institutionalisierte Kontakte zur Politik23 – 25
3. Informelle Kontakte und Risiken26 – 28
4. Verfassungsgerichtsbarkeit und Öffentlichkeit29 – 40
a) Öffentlichkeit und Kritik30 – 32
b) Öffentlichkeitsarbeit als Integrationsressource33 – 38
c) Unkonventionelle Maßnahmen39, 40
IV. Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung41 – 59
1. Verfassungsgerichte als „strukturelle Opposition“41 – 44
2. Mechanismen funktionsadäquater Selbstbeschränkung45 – 50
3. Pfadabhängigkeit des institutionellen Gewichts der Verfassungsgerichtsbarkeit51 – 59
a) Normverwerfungskompetenz52
b) Zugang zur Verfassungsgerichtsbarkeit53
c) Korrekturmöglichkeiten der Politik54, 55
d) Soziologische und sozialpsychologische Voraussetzungen56 – 59
V. Die Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Rechtsraum60 – 106
1. Begriffe60 – 65
2. Der Verfassungsgerichtsverbund in der Europäischen Union66 – 82
a) Durchsetzung des Unionsrechts als gemeinsame Aufgabe68 – 71
b) Wahrung von Kompetenzordnung und nationaler Verfassungsidentität als gemeinsame Aufgabe72 – 77
c) Kooperation auf Augenhöhe78 – 82
3. Verfassungsgerichtsverbund und Politik83 – 106
a) Loyalitätsgebot bei der Personalauswahl83, 84
b) Die Integrationsverantwortung von Regierung und Parlament und ihre verfassungsgerichtliche Kontrolle85 – 106
aa) Unionsrechtlicher Rahmen für die Mitwirkung der nationalen Regierungen und Parlamente88 – 97
(1) Erlass und Änderung des Primärrechts89 – 93
(2) Erlass und Änderung von Sekundär- und Tertiärrecht (aufsteigende Phase)94, 95
(3) Implementation von Sekundär- und Tertiärrecht (absteigende Phase)96, 97
bb) Innerstaatliche Regelungen und Integrationsverantwortung98 – 100
cc) Die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung in der Staatspraxis101 – 106
VI. Erfolg der Verfassungsgerichtsbarkeit und ihre Infragestellungen107 – 111
Bibliographie
§ 124 Die Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Rechtsraum: eine politikwissenschaftliche Analyse
I. Legitimität durch Differenz zwischen rechtlicher und politischer Entscheidungsfindung1 – 13
II. Verfassungsgerichtsbarkeit und Demokratieprinzip14 – 38
1. Die Bedingungen für die Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit17 – 25
2. Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der öffentlichen Meinung26 – 28
3. Der politische Einfluss auf die Wahl ins Richteramt29 – 38
III. Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung39 – 52
1. Die Vorwirkung der Verfassungsgerichtsbarkeit auf die Gesetzgebung40 – 46
2. Die Kompetenzen der Verfassungsgerichte47, 48
3. Die Verrechtlichung der Politik49 – 52
IV. Verfassungsgerichtsgerichtsbarkeit und europäischer Rechtsraum53 – 68
1. Die Konstitutionalisierung des Europarechts53 – 59
2. Die Europäisierung der Interpretation von Grundrechten60 – 65
3. Die Entwicklung einer europäischen Identität durch Differenz66 – 68
V. Verfassungsgerichtsbarkeit als Potenzial für legitimes und effektives Regieren69 – 71
Bibliographie
§ 125 Gestalt und Probleme der europäischen Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Einleitung1 – 3
II. Wesenszüge eines europäischen Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit – Das Ende eines Privilegs4 – 12
III. Die Institutionalisierung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa13 – 58
1. Einleitung13 – 20
2. Das Verfassungsgericht als staatliches Verfassungsorgan21 – 27
3. Die Verfassungsrichter28 – 53
a) Anzahl28, 29
b) Das Profil des Verfassungsrichters30 – 33
c) Amtszeit34 – 37
d) Die Wahl der Verfassungsrichter38 – 44
e) Präsident und Vizepräsident: Wahl und Funktionen45, 46
f) Der Status des Verfassungsrichters – Die Garantie seiner Unabhängigkeit47 – 53
4. Die Organisation und das Budget des Verfassungsgerichts54 – 58
IV. Die verfassungsgerichtliche Entscheidung59 – 93
1. Der Verfahrensgegenstand59 – 62
2. Der Beurteilungsmaßstab63 – 72
3. Die Verfahren über die Verfassungskonformität: Arten, Inhalt und Wirkungen73 – 91
a) Einleitung73 – 76
b) Die Begründung – Der verfassungsrechtliche Diskurs77 – 82
c) „Die Stimme der Verfassung“83, 84
d) Der Verfassungsrichter als Gesetzgeber85 – 87
e) Die Korrektur der Verfassungsordnung88 – 91
4. Die Veröffentlichung der Entscheidung92
5. Die Umsetzung der Entscheidung93
V. Rolle und Funktionen der Verfassungsgerichtsbarkeit94 – 122
1. Einleitung94 – 99
2. Das Verhältnis zum Gesetzgeber100 – 105
3. Das Verhältnis zu den einfachen Gerichten106 – 112
4. Die ungewisse Zukunft und die Wiederkunft der Vergangenheit113 – 122
Bibliographie
§ 126 Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Rechtsraum
I. Einleitung1 – 3
II. Verfassungsgerichtsverbund und europäischer Rechtsraum4 – 8
III. Der EGMR als Teil des Verfassungsgerichtsverbundes9 – 11
IV. Gemeinsame und differenzierte Verantwortung12 – 15
V. Herausforderungen16 – 58
1. Demokratische Legitimität17 – 25
2. Das Gebot konstruktiven Zusammenwirkens26 – 37
3. Autoritäre Tendenzen38 – 44
4. Wertbezogene Antworten auf Rechtsstaatskrisen45 – 52
5. Die Bestimmung der Werte im Verfassungsgerichtsverbund53 – 58
VI. Perspektiven59 – 71
1. Der Umgang mit problematischen Verfassungsgerichten59 – 67
2. Selbstreflexion und Dialog68 – 70
3. Die europäische Verfassungsgerichtsbarkeit als Akteur71
Bibliographie
Personenregister
Sachregister