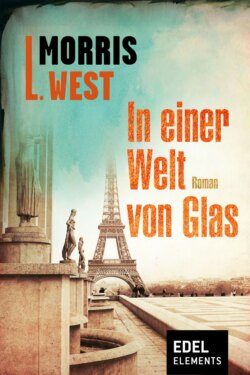Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 13
Carl Gustav Jung
ОглавлениеZürich
Ich bin wie verhext. Ich werde Tag und Nacht von meinem Konflikt mit Freud über die Interpretation des Inzesttabus verfolgt. Ich fürchte mich vor unserem Münchener Kongreß im September, wenn diese und unsere sonstigen Meinungsverschiedenheiten höchst voreingenommen zerredet werden und unser persönliches Verhältnis endgültig und vor aller Augen zerstört wird.
Freud sieht den Antrieb zum Inzest wie jedes andere psychische Phänomen im Sexualtrieb verwurzelt. Ich sehe ihn als Symbol von etwas Tieferem und Urtümlicherem, das mit den Sonnenmythen verwandt ist. Ziel ist dabei nicht die geschlechtliche Vereinigung, sondern eine Wiedergeburt, die nur durch die Rückkehr in den Mutterschoß verwirklicht werden kann. Ähnlich bin ich hinsichtlich der infantilen Sexualität ganz anderer Ansicht als Freud. Aber warum das alles wiederholen? Freud ist stur. Er ist mit seiner Autorität und nicht mit der Wahrheit verheiratet. Der Respekt, den ich für ihn empfand, ist ausgelöscht. Ich kann unsere Beziehung nicht länger aufrechterhalten.
Und genau darin liegt das menschliche Problem. Ich kann die Beziehung nicht aufrechterhalten, aber ich kann sie auch nicht zerstören. Sie ist zu stark, zu vielschichtig. Sie ist wie ein tropisches Schlinggewächs, dessen Wurzeln sich überallhin ausbreiten und dessen Ranken sich durch jede Spalte meiner Psyche ziehen.
Erst war er mein Mentor. Dann übernahm ich ihn, sehr schnell und ohne Schwierigkeiten, als Vaterfigur beim Aufbau meines Lebens. Ich fühlte mich durch das kleinste Lob aus seinem Munde geschmeichelt. Auch er, glaube ich, war geschmeichelt, obwohl er es nie so eindeutig zugeben würde. Ihm gefiel die Ehrerbietung seitens eines Mannes, der auf eine wesentlich längere klinische Erfahrung zurückblicken konnte als er. In dieser Hinsicht besaß Freud nur wenig Praxis, während ich an über tausend Patienten jahrelang im Burghölzli Beobachtungen machen konnte. Ich hatte klinische Tests entwickelt und angewendet und dadurch wertvolles statistisches Material zusammengetragen, das auch heute noch Gültigkeit hat.
Aber unser Verhältnis reichte tiefer. Ich begann sozusagen für ihn zu schwärmen und entwickelte eine stark erotisch gefärbte Zuneigung zu ihm – vermutlich wegen des Jugenderlebnisses, als ich von einem älteren Mann mißbraucht wurde. Ich sprach mit Freud ganz offen darüber. Er bekannte sich zu ähnlichen Gefühlen mir und einem anderen Kollegen gegenüber. Dadurch wurde unsere Beziehung offenherziger, wenn auch nicht weniger schwierig.
Als sich die Auffassungen in theoretischen Dingen drastisch auseinanderzuentwickeln begannen, bat Freud um meine Unterstützung, um seine Autorität als Führer unseres Kreises aufrechtzuerhalten und um wenigstens nach außen einen sichtbaren Konsens in den Lehrmeinungen unserer noch jungen Wissenschaft zustande zu bringen. Als er sich dabei auf unsere Freundschaft berief, fühlte ich mich abgestoßen. Es war fast so, als wolle er mich mit dem Beichtgeheimnis erpressen. Ich hatte das Gefühl – und ich habe es auch heute noch –, daß die einzige Lösung in der biblischen Aufforderung besteht: Lege die Axt an die Wurzel des Baumes und fälle ihn!
Ich wünschte bei Gott, es wäre so leicht getan wie gesagt! Wen soll ich zuerst töten? Den Lehrer, den Vater, den Geliebten? Und wenn ich sie, falls es je dazu käme, alle aus meinem Seelenleben ausgemerzt habe, was bleibt dann noch übrig? Mit wem kann ich dann das Erlebnis der Scham und des Verlustes teilen?
Emma versteht etwas von dem, was mich belastet. Sie ist eine recht gute Analytikerin geworden, obwohl sie nicht so scharfsinnig wie Toni ist. Außerdem hat sie die freundschaftliche Korrespondenz mit Freud aufrechterhalten. Mir ist es nicht lieb, aber ich kann es nicht verbieten. Emma weiß nichts vom homosexuellen Element in meinem Verhältnis zu Freud. Sie sorgt sich vielmehr über unsere familiäre Situation. Meine Wutausbrüche beunruhigen sie und die Kinder. Sie nimmt mir noch immer lang zurückliegende Episoden mit weiblichen Patienten übel. Sie ist eifersüchtig auf Toni und leidet unter deren ständiger Anwesenheit in unserem Haus. Sie findet, daß sich meine neue Tätigkeit als freischaffender Wissenschaftler nur schwer gegenüber unseren Nachbarn und Freunden erklären läßt. Es war für sie viel einfacher, als sie sich auf meine Titel berufen konnte: Klinischer Direktor im Burghölzli und Dozent an der Universität. Wir Schweizer brauchen für alles Schubladen, um problemlos miteinander leben zu können.
Mit Toni ist es noch schlimmer. Sie kennt den Vater-Sohn-Aspekt meines Verhältnisses zu Freud sehr genau. Außerdem weiß sie um mein Bedürfnis nach einer starken Vaterfigur, die meinen leiblichen Vater ersetzt. Den liebte ich zwar, konnte ihn aber nie vorbehaltlos respektieren, weil er sich nie den Problemen von Glauben und Zweifel stellen wollte. All diese Dinge kann ich mit Toni offen besprechen, mit Emma aber niemals! Die sexuelle Beziehung zwischen Toni und mir ist leidenschaftlich und tief; mich schaudert jedoch bei dem Gedanken, was geschehen würde, sollte ich sie plötzlich vor das Problem meiner homosexuellen Vergewaltigung stellen.
So bin ich mit diesem Dämon allein, muß insgeheim mit ihm ringen. In dem Maße, wie mein Abscheu vor mir selbst wächst, nimmt auch meine Abneigung Freud gegenüber zu. Diese erstreckt sich auch auf jenen kleinen Kreis von Speichelleckern, die ihn umschwirren wie Höflinge den King Sun. »Der Meister ist anderer Meinung. Der Meister ist gekränkt.« Der Meister hin, der Meister her. Man könnte manchmal glauben, er sei Buddha persönlich und nicht der Wiener Jude, dessen beste Gedanken durch Großmannssucht verwässert worden sind.
Hierin liegt ein weiteres Problem, das aus verständlichen Gründen keiner von uns beiden in Worte kleiden will. Freud ist ein Jude, dem es gelungen ist, sich ohne allzu große Schwierigkeiten von der Religion seines Volkes zu trennen. Für ihn ist jede Religion ein vom Menschen geschaffener Mythos, der für die kranke Psyche eine Krücke darstellt, die abgelegt werden muß, bevor das richtige Heilmittel verordnet werden kann. Ich bin Deutsch-Schweizer und in der evangelischen Kirche aufgewachsen. Ich habe zwar auch die Religion meiner Väter aufgegeben, aber nie die Suche nach einem Gott, der mir verständlich ist und dem ich mich als denkender Mensch verpflichten kann. Für mich sind die Mythen, Märchen und verschiedenartigen Religionen der Menschen keine Krücke. Ich sehe in ihnen eher ein Symbol, mit dessen Hilfe der Mensch sein Gefühl für das Geheimnisvolle in Worte kleidet, um seine Psyche auf diese Bürde vorzubereiten.
Ich weiß, daß mich einige aus dem Gefolge Freuds als Mystiker oder eine Art von gescheitertem Poeten abtun, der sich in der Geisteswissenschaft versucht. Einige von ihnen haben sogar das Gerücht in Umlauf gesetzt, ich zeigte Symptome von Dementia praecox. Sie vergessen dabei, daß ich eine viel größere klinische Erfahrung besitze und daß ich es bin, der die entscheidenden Arbeiten über dieses Thema veröffentlicht hat.
Aber diese Verleumder haben mir großen Schaden zugefügt. Meine Praxis hat gelitten. Einige Patienten haben mich verlassen. Ich bin gezwungen, mich auf einige wenige, aber reiche Patienten umzustellen, die keineswegs Neurotiker sind, sondern lediglich unter Langeweile leiden oder mit ihren Lebensverhältnissen nicht ins reine kommen.
Ich schäme und ärgere mich, daß ich mich für Geld erniedrigen muß. Ich weiß, daß ich weit über Freud hinausgreife, und ich bin überzeugt, daß ich eines Tages zu einer Wahrheit gelangen werde, die jenseits seiner Vorstellungswelt liegt. Wie die Motte zum Licht werde ich in diese Richtung gezogen, obwohl ich den Lichtpunkt noch nicht erkennen und auch den Weg, den ich einschlagen muß, nicht festlegen kann.
Toni kommt heute spät. Sie ist blaß und hustet noch. Ich mache ihr Vorwürfe und sage zu ihr, sie hätte im Bett bleiben sollen.
Sie protestiert: »Wenn ich arbeite, geht es mir besser. Im Bett bekomme ich Fieber, weil ich mich nach dir sehne und immer hoffe, daß du mich besuchen kommst.«
Ich erkläre ihr ein wenig ungeduldig, daß Emma und die Kinder eine Segelpartie machen wollten und ich mich einer so verständlichen Bitte der Familie nicht entziehen konnte. Toni sieht dieses Argument, wenn auch zögernd, ein. Dies ist der Punkt, wo der Schuh drückt. Sie steht immer eine Stufe unter mir. Beruflich ist sie noch eine Lernende. Als Geliebte rangiert sie nach der Ehefrau und der Familie. Wenn ich ihr versichere, daß sie in meinem Herzen stets den ersten Platz einnimmt, meint sie, mein Herz sei ein seltsames Land, manchmal recht unwirtlich und unfreundlich. Dann kommt ein kurzer, bitterer Augenblick, wo es so aussieht, als würden wir uns wieder streiten, aber sie lenkt ein. Wir küssen uns, und der bittere Nachgeschmack ist vergangen. Sie erzählt mir von einem Traum, den sie während des Mittagsschlafes gehabt hat.
»Ich hatte nur dich im Kopf, und mein Körper brauchte dich und sehnte sich nach dir. Ich schlief ein und träumte, ich sei eine Möwe, die über den See dahinfliegt. Ich sah dich am Strand sitzen mit untergeschlagenen Beinen wie ein Orientale. Du warst nackt und allein. Ich flog hinunter, um bei dir zu sein. Als ich aber näher kam, war ein anderer Mann neben dir. Er umarmte dich und liebkoste dich, so wie ich es immer tue. Als er mich sah, scheuchte er mich fort. Ich flog davon, blieb aber hoch oben über dir stehen und zog enge Kreise. Ich beobachtete euer Liebesspiel. Dann kam Emma zum Strand hinunter und schlug mit dem Regenschirm auf den Mann ein. Ich flog fort, weil ich nicht wollte, daß sie mich sah.«
Während ich Toni zuhöre, spüre ich eine Erregung in mir aufsteigen wie das Rauschen von Wasser bei Überschwemmungen, schmutzig, strudelnd, voll seltsamen mitgerissenen Schwemmguts. Hat sie das dunkle Geheimnis erraten, das mir so zusetzt? Habe ich es ihr durch irgendeinen Mechanismus des Unbewußten mitgeteilt? Sie hatte diesen Traum zur gleichen Zeit, als ich auf dem Boot in der stillen Bucht über dieselben Dinge nachdachte. Dies ist eine Situation, vor die ich immer häufiger gestellt werde: ein zufälliges Zusammentreffen, eine zeitliche Übereinstimmung, Dinge, die sich ohne kausalen Zusammenhang gleichzeitig ereignen und ihrer Natur nach eng miteinander verknüpft sind. Der Zusammenhang verdient eine nähere Untersuchung. Ich traue mich nicht, zu Tonis Traum sofort Stellung zu nehmen. Ich setze mich an den Schreibtisch, mache mir Notizen über den Inhalt und befrage dabei Toni so formell, wie wir es bei klinischen Besprechungen gewohnt sind.
»Wußtest du, bevor du einschliefst, daß ich mit dem Segelboot hinausgefahren war?«
»Nein. Aber da es ein so schöner Tag war, dachte ich mir, du würdest vielleicht das Boot herausholen.«
»Gab es für den Traum irgendein anderes auslösendes Moment?«
»O ja! Ein weißer Vogel flatterte an meinem Fenster vorbei, und ich dachte: Du Glücklicher! Ich wünschte, ich könnte auch so fliegen! Dann muß ich eingeschlafen sein.«
»Sag mir jetzt folgendes.« Ich schlage einen energischen Ton an. »Sag mir ohne weiteres Nachdenken, was der Traum für dich bedeutet.«
»Ach, das ist doch ganz einfach!« Sie antwortet mit jener Unschuldsmiene, die mich immer so leicht entwaffnet. »Es war mir schon klar, als ich noch träumte. Wir haben so viel von der Anima und dem Animus gesprochen: dem weiblichen Element in jedem Mann, dem männlichen Element in jeder Frau. Das, was ich von dir am Strand sah, war deine Anima, die Personifikation des weiblichen Teils in dir. Der meditierende Buddha zeigt nie ein männliches Geschlechtsorgan. Der Mann, der sich dir näherte, war die Personifikation des männlichen Teils in mir, mein Animus. Wir liebten uns so, weil unsere Rollen im wirklichen Leben vertauscht sind. Aufgrund unserer Situation muß ich die Initiative ergreifen. Du bist passiv und weiblich, bis ich mich präsentiere, um dich zu erregen. Dann bist du natürlich ganz und gar männlich. Aber welche Rolle wir auch übernehmen, immer erscheint Emma, um uns zu trennen ... Es ist wirklich ein ganz banaler Traum; er enthält nichts Geheimnisvolles.«
»Wir wollen ihn nicht einfach so abtun. Hat dich mein weibliches Ich erregt?«
»O ja!«
»Könntest du im wirklichen Leben eine solche Rollenverkehrung ertragen?«
»Gerade das sagt ja der Traum, Carl: Ich muß sie immer wieder ertragen. Du machst mir nicht den Hof wie ein echter Liebhaber. Ich muß hinter dir her sein und mich an jeden Augenblick unseres Zusammenseins klammern. Gewiß, du begehrst mich, aber du wartest hier, bis ich zu dir komme. Natürlich bist du der aktive Teil, während wir uns lieben, aber vorher und danach vertauschen sich die Rollen. Ich beklage mich nicht darüber. Ich stelle nur eine Tatsache fest und deute meinen Traum.«
»Angenommen, ich sage dir, Toni Wolff, daß du mich anlügst, daß du nie einen solchen Traum gehabt hast, daß du klinisches Beweismaterial erfindest. Was hast du darauf zu sagen?«
»Darauf gibt es drei Antworten, du alter Griesgram! Ich lüge. Ich sage die Wahrheit. Ich biete dir ein Traumgerüst, das zu unserer Situation paßt. Du kannst wählen!«
Ich bin sehr versucht, sie der Lüge zu bezichtigen, und mache meinen Ängsten und Enttäuschungen in einem Wutanfall Luft. Im selben Augenblick merke ich, daß Toni genau das von mir erwartet. Sie sieht mich mit demselben Ausdruck an – halb belustigt, halb drohend –, den ich immer auf dem Gesicht meiner Mutter sah, wenn sie in meinen Gedanken las. Ich weiß, daß ich mich, wenn wir uns streiten, schließlich entschuldigen und erklären muß – also muß ich diesmal die Katze aus dem Sack lassen. Ich werde meine Vergewaltigung und meine erotische Zuneigung zu Freud offenbaren müssen. Toni spürt die Wahrheit, und dieser Traum ist ihr Mittel, mich zu dieser Enthüllung zu zwingen.
So tue ich, was ich immer tue – ich lüge. Ich nehme ihre Hände und ziehe Toni an mich. Ich küsse sie auf den Mund und sage: »Ich mache schlechte Witze, weil ich dich so vermißt habe. Natürlich nehme ich dir den Traum ab. Er enthält genau die Wahrheit über dich und mich. Wir sind uns so nahe, daß wir eine einzige Person sind. Alle unsere Teile sind vermischt wie die Zutaten in einer Pastete.«
Die Worte sind kaum gesprochen, da hören wir Emma im Garten nach den Kindern rufen. Wir gehen rasch auseinander. Toni zieht sich an ihren Schreibtisch zurück, ich an meinen. Ich ärgere mich, weil ich mir lächerlich vorkomme, aber Toni ist noch zu Scherzen aufgelegt. Sie streicht sich die Bluse über den hervortretenden Brustwarzen glatt und meint kichernd: »Ich bin gespannt, ob sie den Regenschirm bei sich hat.«