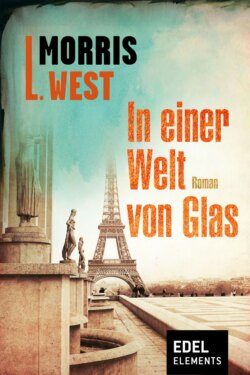Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 9
Carl Gustav Jung
ОглавлениеZürich
Heute ist es heiß und außerordentlich schwül. Dunkle Gewitterwolken türmen sich über dem See. Wir werden noch vor Mittag ein Gewitter haben. Ich arbeite seit Tagesanbruch, sammle Kiesel am Seeufer und häufe sie neben meinem Miniaturdorf je nach Größe und Zeichnung auf. Ich arbeite mit nacktem Oberkörper wie ein Taglöhner. Gesicht und Brust sind voll Schweiß und Staub; aber ich fühle mich wohl und bin zufrieden.
Emma und die Kinder verbringen den Tag bei Freunden oben in einer Villa am Sonnenberg. Toni hat unter dem großen Apfelbaum einen Kartentisch aufgestellt und arbeitet an ihren Notizen. Sie hat einen Krug mit Limonade bereitgestellt und frische Handtücher herausgebracht, so daß wir vor dem Mittagessen schwimmen und uns im Bootshaus umziehen können.
Wir reden nicht viel. Das ist auch nicht nötig. Uns genügt es, beisammen zu sein, und jeder läßt sich vom Strom seiner Gedanken dahintragen – wie zwei Flüsse, die sich treffen. Während ich mein Miniaturdorf aufbaue, ist mir, als setzte ich meine Kindheit aus den Scherben und Fetzen der Erinnerung wieder zusammen. Dabei kommt mir der Vater meiner Mutter in den Sinn, Pfarrer Preiswerk, der jeden Mittwoch mit dem Geist seiner ersten Frau sprach – sehr zum Ärger seiner zweiten, die ihm dreizehn Kinder geschenkt hatte.
Mein Vater, der ja auch protestantischer Pfarrer war, ist ein intelligenter und gütiger Mann gewesen. Die Enge einer kleinen Landgemeinde und eine altmodische Theologie, die zu überprüfen er nie den Mut fand, setzten ihm arg zu. Deshalb flüchtete er in die Vergangenheit: in die guten alten Zeiten, die romantischen Studentenjahre und die Auszeichnungen, die er beim Studium der orientalischen Sprachen erhalten hatte – aber er las diese Texte nicht mehr. Er stritt sich oft mit meiner Mutter, einer rundlichen und heiteren Frau, die wie frisches Brot Wärme ausstrahlte und Gesellschaft und Geplauder liebte. Spätere Erfahrungen lassen mich annehmen, daß diese Streitereien auch einen sexuellen Hintergrund hatten. Ich kann nicht sagen, bei wem die Schuld lag. Die Heuchelei der Schweizer in sexuellen Dingen ist manchmal unglaublich. Die Tatsache bleibt, daß meine Mutter immer tiefer in Depressionen verfiel und lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden mußte.
Ihr gegenüber habe ich merkwürdig ambivalente Gefühle. Hinter jener warmherzigen, dicklichen und gemütlichen Person lauerte ein anderer, starker, dunkler und herrschsüchtiger Mensch, der keinen Widerspruch duldete. Dieser war es auch, der durch einen Blick in meine Augen erkennen konnte, was in meinem Kopf vorging. Die Einstellung zu meiner Mutter hat auf alle meine späteren Beziehungen zu Frauen abgefärbt. Jahrelang reagierte ich auf das Wort »Liebe« stets mißtrauisch und voller Zweifel. Mein frühestes und in gewissem Sinne tiefstes Traumerlebnis kreist um mein Verhältnis zu den Eltern und das ihrige untereinander.
In diesem Traum entdeckte ich auf einer Wiese hinter unserem Haus den Eingang zu einem Tunnel. Ich ging hinein und befand mich in einem großen Raum, in dem ein Königsthron stand. Auf dem Thron erhob sich ein Phallus, so groß wie ein Baum. Sein einziges, blindes Auge starrte zur Decke empor. Ich hörte meine Mutter rufen: »Schau dir das an! Das ist der Menschenfresser!« Der Traum wiederholte sich Nacht für Nacht. Ich war verschreckt, getraute mich nicht, ins Bett zu gehen, was zu Auseinandersetzungen mit meinem Vater führte, mit dem ich über meinen Traum nicht zu sprechen wagte.
Dieser Traum läßt, wie jeder Interpret bestätigen wird, eine ganze Reihe von Auslegungen zu, und ich habe jedes Jahr versucht, neue zu finden. Wenn ich ihn mir aber heute in diesem sommerlichen Garten wieder vor Augen führe, erregt er mich noch immer, aber nicht vor Schreck, sondern vor Begierde nach dem wunderschönen Wesen, das neben mir sitzt.
Ich gehe zu ihr. Sie gießt Limonade ein und hält mir das Glas an die Lippen. Dann trocknet sie mir den Schweiß von Gesicht und Oberkörper. Die Berührung ihrer Hände wirkt elektrisierend, und wie Galvanis Frosch springe ich darauf an. Ich sage in bittendem Ton: »Ich will dich.« Sie antwortet: »Ich will dich auch.« Dann – wie ein Geschenk der Götter – fallen die ersten Regentropfen, und der erste Blitz zuckt über den Bergrücken. Toni sammelt ihre Unterlagen ein, und wir bringen uns im Bootshaus in Sicherheit.
Während sich Toni auszieht, richte ich aus den Polstern und Segeln meines Bootes ein Bett her. Wir fallen darauf, während draußen das Gewitter mit voller Wucht losbricht, mit Blitz, Donner und Hagelkörnern, die wie Geschosse auf das Dach prasseln. Es wütet über eine Stunde, um den ganzen See herum. Wir brauchen keinen Störenfried zu fürchten. Emma wird vom Sonnenberg nicht herunterkommen, bis das Gewitter vorbei ist. Unsere Dienstboten sind im Haus. Toni und ich können frei und glücklich sein wie Kinder. Unser Liebesspiel ist ausgelassener als je zuvor. Nachdem sich die Leidenschaft gelegt hat, liegen wir Brust an Brust auf dem weißen Segeltuch und lauschen dem Heulen des Windes, dem Trommeln der Regentropfen und dem Knarren des Apfelbaumes, der sich unter der Last junger Früchte neigt.
Dann ergreift uns, wie immer, die schleichende Trauer des Danach. Toni klammert sich an mich und flüstert ihre alte Leier: »Wäre es nicht herrlich, immer so beisammen sein zu können? Wäre es nicht schön, keine Vorkehrungen treffen zu müssen? Ich hasse es, immer diejenige zu sein, die aufstehen und nach Hause laufen muß. Wünschst du dir nicht auch, daß wir heiraten könnten?«
Ich wage ihr nicht zu sagen, daß ein Ehering alles verändert; daß es kein besseres Rezept für Langeweile gibt als das Ehebett; daß das Aufregende an unserer Beziehung zur Hälfte vom Risiko herrührt, entdeckt zu werden. Noch weniger kann ich ihr erklären, wie rasch sich die Traumsymbole für mich verändern, wie aus der warmen Höhle, wo der Phallus aufrecht und triumphierend regierte, eine Grabkammer wurde, in der außer einem häßlichen weißen Wurm keine Spur von Leben zu finden ist.
Auch Toni macht in diesem Lande des Ermattens und der Schatten eine merkwürdige Verwandlung durch. Erst ist sie Salome, die Schwester, die Ehefrau, Geliebte und Beschützerin, im nächsten Augenblick erscheint sie als das Dienstmädchen, das für meinen Vater und mich den Haushalt führte, als meine Mutter in der Klinik lag. Sie hatte dieselben glänzend schwarzen Haare, dieselbe seidige Haut, denselben Geruch nach Frau, und auch sie kicherte, wenn ich sie mit der Zunge am Ohr kitzelte.
Der Regen hört auf, und auch der Zauber ist vorbei. Toni springt auf und zieht sich hastig an. Sie stellt die üblichen Fragen: »Ist meine Frisur in Ordnung? Meine Lippen sind doch nicht aufgesprungen, oder? Sitzt mein Rock gerade?« Ich knöpfe ihr die Bluse zu, gebe ihr einen letzten Kuß und schicke sie zur Arbeit ins Haus zurück. Dort ist sie dann, wenn Emma mit den Kindern zurückkommt. Ich rolle die Segel wieder auf, stapele die Polster ordentlich, schließe das Bootshaus ab und kehre zu meiner Maurerarbeit am Miniaturdorf zurück.
Unter den Steinen, die ich heute früh fand, ist ein merkwürdiger, konisch geformter Kristallbrocken. Er eignet sich großartig als Kirchturmspitze. Die Kirche lenkt meine Gedanken auf Gott, die Dreifaltigkeit, Jesus Christus und auf meinen Vater, ihren offiziellen Vertreter. Mein Vater war auch für Begräbnisse zuständig. Die Toten zwängte man in schwarze Kisten, die von Männern in schwarzen Mänteln und schwarzen Schuhen auf den Schultern getragen und dann in Erdgruben versenkt wurden. Vater pflegte dabei zu sagen: »Gott hat sie zu sich genommen. Jesus, der Erlöser, hat sie in Seinem Reich empfangen.«
So wurde in meiner kindlichen Vorstellung aus Jesus Christus eine schwarze und drohende Gestalt, deren Reich die finstere Unterwelt war, die Heimstatt blinder Maulwürfe, zirpender Grillen und einäugiger Ungeheuer.
Natürlich kann das einäugige Ungeheuer überall auftauchen. So ist zum Beispiel dieses Haus ganz nahe der Kirche, die ich gerade baue, für mich ein unheilvoller Ort. Der Mann, der dort einmal wohnte, war mit meinem Vater und dann auch mit mir befreundet. Er lieh mir oft Bücher und förderte meine Passion fürs Malen und Zeichnen. Er nahm mich zum Fischen und Schwimmen mit. Die Grundzüge der Archäologie lernte ich von ihm, und er zeigte mir auch die erotischen Symbole der Griechen und Römer und der höfischen Gelehrten der Renaissance. Dann, an einem Sommertag, als wir in einem entlegenen Winkel des Sees badeten, versuchte er mich zu veranlassen, an seinem Glied zu lutschen. Als ich voll Angst und Abscheu zurückwich, packte er mich, drückte mein Gesicht gegen einen Baumstamm und vergewaltigte mich.
Es war ein schmerzvolles und erniedrigendes Erlebnis – um so mehr, als ich trotz meiner moralischen Empörung überzeugt war, dem Freund, der sich ja zunächst werbend an mich gewandt hatte, nicht gerecht geworden zu sein. Das Lustgefühl bei der Kopulation verwirrte mich erst recht. Ich war zum Höhepunkt gelangt, ich hatte ejakuliert, und dem älteren Mann diente dieses Lustgefühl sogleich dazu, sein Eindringen in meinen Leib und mein erzwungenes Mitmachen zu rechtfertigen.
Auch jetzt noch, in reifen Jahren, wenige Minuten nach meiner leidenschaftlichen Vereinigung mit Toni, läßt mich die Erinnerung an jene andere Begegnung nicht los. Sie färbt auf mein Verhältnis zu Freud ab, für den ich große Zuneigung empfinde, wie ein Sohn zu seinem Vater, ein Schüler zu seinem verehrten Meister. Aber dieses Verhältnis ist stets viel komplexer gewesen, sehr griechisch, sehr platonisch. Ich bin der Waffengefährte, der Lager und Zelt mit ihm geteilt hat und der ihn jetzt verläßt, um für eine andere Sache unter einem anderen Banner zu kämpfen.
Aber ich muß doch sagen, daß bei Freud trotz seines etwas übertriebenen Wiener Gehabes und seines hebräischen Raffinements auch etwas Tyrannisches mitschwingt, wie ja in mir ein weibliches Element vorhanden ist, das beherrscht werden möchte, und in Toni ein latentes maskulines Element, das mich beherrschen will.
Dies alles ist nicht ohne Zusammenhang, den ich langsam zu begreifen beginne und den ich in ein System zu bringen versuche. Das Problem liegt darin, daß mir der passende Wortschatz fehlt. Als ich jünger war, habe ich mich immer lauthals darüber beklagt, daß Philosophen und Theologen für die einfachsten Begriffe hochtrabende Ausdrücke verwenden. Jetzt verstehe ich, warum sie das tun. Je anspruchsvoller das Wort, desto größer ist seine Magie, und desto besser ist es geeignet, die menschliche Beschränktheit zu verbergen. Aber sobald man es in das Ritual einfügt, wird die Zauberformel zum geheiligten Wort. Es dann in Zweifel zu ziehen ist Ketzerei und, noch schlimmer, Blasphemie.
Ich setze den kristallenen Stein auf den Turm meiner Miniaturkirche und trete zurück, um die Wirkung abzumessen. Laut stelle ich die Frage an den Toten: »Was glaubst du, Vater? Wird deinem Gott das Haus gefallen, das ich für Ihn gebaut habe?«
Die Frage ist eine Herausforderung an meinen toten Vater, dessen Glaubensbegriffe für mich nicht mehr gültig sind. Sie ruft mir außerdem einen Kindheitstraum in Erinnerung. In diesem Traum sah ich Gottvater, uralt und gewaltig, am blauen Himmel genau über der Turmspitze unserer Kathedrale thronen. Während ich hinaufsah und vor Ehrfurcht wie gebannt war, ließ Gott einen donnernden Furz fahren, und ein großer Haufen fiel – plumps! – auf das Dach der Kathedrale und machte sie dem Erdboden gleich.
Auf mich wirkte der Traum befreiend: Gott hatte die Versuche des Menschen vereitelt, ihn in ein System zu zwängen. Trotzdem stehe ich hier in meinem Garten und baue das Gefangenenhaus meiner Kindheit wieder auf. Warum? Mein Vater kann es mir nicht sagen. Er liegt eingeschlossen in dem schwarzen Kasten tief unter der Erde, wo alles völlig anders ist.
In dem verborgenen Reich des Unbewußten ist nichts ganz so, wie es zu sein scheint. Die Toten reden, und die Lebenden sind stumm. Der Phallus ist ein kannibalischer Gott, der von Blut trieft. Der feuchte Schoß spornt den Wüstling an. Der Wüstling vergewaltigt und schändet um einer Liebe willen, die er nicht erleben kann. Janus, der doppelgesichtige Torhüter, sieht Vergangenheit und Zukunft, aber er ist blind für die Gegenwart und weiß nicht, daß die Ewigkeit alles umschließt.
Plötzlich sind Elias und Salome bei mir. Ich zeige ihnen mein Dorf. Ich schildere ihnen die Erinnerungen, die es weckt, und frage: »Ergibt dies irgendeinen Sinn für dich, Elias? Für dich, Salome, meine Schwester, meine Liebe?«
Zum erstenmal werde ich mir bewußt, daß Salome blind ist und daß sich nun ein drittes Wesen bei ihnen befindet: eine große schwarze Schlange mit Augen, die wie Obsidian glänzen. Die Schlange kommt näher und schlingt sich um mein Bein. Sie ist offensichtlich eine freundliche Kreatur, aber ich fürchte mich. Salome streckt die Hand aus, um mich zu beruhigen, aber ich entziehe mich dieser Berührung.
Elias lächelt hintergründig und sagt ironisch: »Du fürchtest dich mehr vor Salome als vor der Schlange.«
Ich gebe es zu, erinnert sie mich doch an meine Mutter, die genau meine Gedanken lesen zu können schien. Ich fühle, daß Salome mit ihren blinden Augen mehr sieht als die Schlange. Dann sind alle drei ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, verschwunden. Das einzige Lebewesen im Garten außer mir ist eine braune Drossel, die in der feuchten Erde nach Würmern pickt.