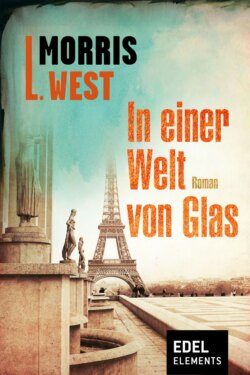Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 5
Carl Gustav Jung
ОглавлениеZürich
Ich weiß, daß ich dem Wahnsinn sehr nahe bin, und ich habe große Angst. Nachts schleiche ich, von Panik übermannt, durch furchterregende Landschaften: Meere von Blut und Schluchten zwischen gezackten Bergen und toten Städten, die weiß unter dem Mond daliegen. Ich höre den Donner von Pferdehufen und das Gebell von Hunden, und ich weiß nicht, ob ich Jäger oder Gejagter bin.
Wenn ich aufwache, sehe ich im Spiegel einen Fremden mit glühenden, feindseligen Augen. Ich kann kein vernünftiges Buch lesen; die Worte verschwimmen zu einem unsinnigen Knäuel. Ich versinke in dumpfe Depressionen, explodiere in unsinnigen Wutanfällen, die meine Kinder in Angst und Schrecken versetzen und bei meiner Frau Tränenausbrüche oder bittere Vorwürfe auslösen. Sie nörgelt an mir herum und will, daß ich einen Arzt oder einen Psychiater aufsuche; aber ich weiß, daß sich diese Krankheit weder durch ein Arzneifläschchen noch die bohrenden Fragen eines Analytikers heilen läßt.
Um meine geistige Gesundheit zu bestätigen, habe ich mir deshalb ein Ritual zurechtgelegt. Vor dem Fremden im Spiegel sage ich die Litanei meines Lebens auf, etwa so: »Ich heiße Carl Gustav Jung. Ich bin Arzt, Dozent der Psychiatrie, Analytiker. Ich bin achtunddreißig Jahre alt. Ich wurde am 26. Juli 1875 in der kleinen Schweizer Ortschaft Keßwil im Kanton Thurgau geboren. Mein Vater Johann Paul Achilles war protestantischer Pfarrer. Meine Mutter war ein Mädchen aus Basel und hieß Emilie Preiswerk. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, und ein fünftes ist unterwegs. Der Mädchenname meiner Frau ist Emma Rauschenbach. Sie wurde in der Bodenseegegend geboren – und manchmal hält sie offenbar auch heute noch den Bodensee für den Nabel der Welt ...«
Die Rezitation geht weiter, während ich mich rasiere. Sie soll mir einen festen Platz in Raum, Zeit und Umwelt sichern, damit ich mich nicht in eine Unperson auflöse. Ich frühstücke allein, ohne zu sprechen, denn ich forsche dabei noch immer dem Gespinst meiner Träume nach.
Nach dem Frühstück gehe ich am See spazieren und sammle alle möglichen Steine für das Miniaturdorf, das im unteren Teil meines Gartens allmählich Gestalt annimmt. Es ist ein kindlicher Zeitvertreib, aber er hilft mir, meine schweifenden Gedanken an die einfachen Realitäten der gegenständlichen Welt zu heften, an das kühle Wasser, die Form und Beschaffenheit der Steine, das Rauschen des Windes in den Ästen und die hellen Sonnenflecken auf dem Rasen. Im weiteren Verlauf dieses Rituals höre ich oft Stimmen und sehe manchmal Personen aus der Vergangenheit. Gelegentlich höre ich die Stimme meines Vaters, der von der Kanzel in Keßwil die christliche Glaubenslehre verkündet: »Ein Sakrament, meine lieben Brüder, ist das äußerlich sichtbare Zeichen einer inneren Gnade. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes ...«
Ich lehne schon seit langer Zeit die Religion ab, die mein Vater predigte. Für seinen Gott ist in meinem Leben kein Platz; aber für die Gnade, das Geschenk – o ja! Diese Gaben werden mir jeden Morgen zuteil, wenn mein Ritual beendet ist und meine Antonia Punkt zehn Uhr in mein Leben tritt.
Meine Antonia! Ja, das kann ich sagen, auch wenn ich sie weder vollständig noch ununterbrochen besitze, wie ich es mir wünschen würde. Wir haben ein Liebesverhältnis, aber es ist mehr als das. Manchmal glaube ich, daß wir einen vollendeteren Bund eingegangen sind als die gesetzliche Ehe, die Emma und mich verbindet. Toni hat sich mir so leidenschaftlich und so vorbehaltlos geschenkt, daß ich, wenn ich nur ihre Schritte oder den Klang ihrer Stimme höre, zu neuem Leben erwache und sie begehre. Mein Geschenk für sie stammt von ihr selbst: eine Einfalt des Herzens, eine ausgeglichene Gefühlswelt, ein Ganzsein, eine Harmonie zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten. Als sie – damals noch Patientin – zu mir kam, glich sie der Prinzessin, die in dem verzauberten Wald im Dornröschenschlaf liegt, gefangen in Brombeergestrüpp und Dornenranken. Ich erweckte sie. Ich verscheuchte die Alpträume und die Wirrsal ihres langen Schlummers. Als sie geheilt war, machte ich sie zu meiner Schülerin. Dann wurde sie meine Gefährtin und Mitarbeiterin.
Jetzt, da ich selbst die Zeit des Schreckens erlebe, sind unsere Rollen vertauscht. Ich bin der Patient. Sie ist die geliebte Ärztin, deren Stimme mich beruhigt und deren Berührung ihre Heilkräfte auf mich überträgt.
Ich werde lyrisch, ich weiß es; aber nur, wenn ich allein bin, kann ich so sein. Ich vertraue mich diesem geheimen Tagebuch an, das während der Stunden, die Antonia und ich gemeinsam verbringen, in meinem Turmzimmer, wo sonst niemand ungebeten eintreten darf, verschlossen liegt. Aber selbst hier ist unsere Gemeinsamkeit nicht vollständig. Wir flirten und tändeln miteinander, wenn wir nicht arbeiten – was wir wirklich auch tun! –, aber wir lieben uns nie richtig, denn Toni will sich nicht im Haus einer anderen Frau einem Mann ganz hingeben. Ich bedaure das, aber ich muß zugeben, daß ihr Standpunkt viel für sich hat. Emma ist schon jetzt unverhohlen eifersüchtig, und wir dürfen nicht riskieren, im Bett auf frischer Tat ertappt zu werden.
Natürlich vergrößert diese erzwungene Abstinenz meine emotionalen Spannungen, aber es herrscht insofern ein gewisser Ausgleich, als auch Toni gezwungen ist, jenes Maß an Zurückhaltung an den Tag zu legen, das für unsere berufliche Beziehung notwendig ist. Ich persönlich kann nicht – sosehr ich es auch wünschte – alle meine ungelösten Probleme in ihrer üppigen Weiblichkeit ersticken. Ebensowenig kann ich mich sinnlos betrinken oder mich mit Drogen um den Verstand bringen und dann beim Einschlafen vor mich hinmurmeln, daß zwischen mir und der Welt alles in Ordnung sei.
So begrüßen wir uns jeden Morgen liebevoll ... Sie kocht Kaffee für uns beide. Wir erledigen die Korrespondenz. Dann setzen wir uns zusammen, um die Konflikte zu analysieren, die mir psychisch schwer zusetzen.
Trotz unserer therapeutisch ausgerichteten Beziehung während dieser Sitzungen bin ich mir jeden Augenblick Tonis körperlicher Gegenwart bewußt. Ich betrachte die Rundung ihrer Brüste, den Fall ihres Rockes über die Oberschenkel, eine Haarsträhne, die an ihrer Schläfe herabhängt. Ich bin sinnlich erregt, aber sie sitzt ruhig und gelassen da wie eine Eiskönigin – so wie sie es von mir gelernt hat – und stellt ihre Fragen: »Was hast du letzte Nacht geträumt? Hatte der Traum etwas mit den Symbolen zu tun, über die wir gesprochen haben?«
Heute besprachen wir eine neue Traumsequenz, die anscheinend mit allen früheren, an die ich mich erinnern konnte, keinerlei Verbindung hat. Ich war in einer Stadt in Italien. Ich wußte, daß sie irgendwo im Norden liegen mußte, weil sie mich an Basel erinnerte. Aber ich befand mich eindeutig in Italien und in der Gegenwart. Die Menschen waren modern gekleidet. Es gab Fahrräder und Autobusse und sogar eine Straßenbahn. Ich schlenderte die Straße entlang, als ich plötzlich vor mir einen Ritter in voller Rüstung sah, einer Rüstung aus dem zwölften Jahrhundert mit dem roten Kreuz der Kreuzritter auf der Brust. Er war mit einem gewaltigen Schwert bewaffnet und schritt dahin wie ein Eroberer, ohne nach rechts oder links zu schauen. Das Bemerkenswerte daran war, daß niemand von ihm Notiz nahm. Es war, als sei ich der einzige, der ihn sah. Ich spürte die ungeheure Kraft, die von ihm ausging – als stünde eine Offenbarung unmittelbar bevor. Wenn ich ihm nur hätte folgen können, aber ich konnte es nicht ...
Bei der Deutung dieses Traums gerieten Toni und ich fast in Streit. Ich war überzeugt – und bin es auch heute noch –, daß er magische und alchemistische Bilder enthielt, die auf alte Mythen hinweisen, etwa auf die Ritter der Tafelrunde von König Artus und die Suche nach dem Heiligen Gral – ein Symbol für meine eigene Suche nach dem Sinn des Lebens inmitten allgemeiner Verwirrung.
Toni widersprach mir nachdrücklich. Der Ritter sei Freud, sagte sie. Freud sei der einsame Kreuzritter, der von den Gleichgültigen nicht erkannt wird. Sie behauptete, ich hätte seine Bedeutung und seine Macht erkannt, könne ihm aber nicht folgen, weil ich unfähig sei, die Wucht seiner Ideen zu akzeptieren, und weil sich meine Zuneigung zu ihm in Feindseligkeit verwandelt habe.
Ich spürte wie so oft sinnlose Wut in mir aufsteigen. Dann brach sie gottlob die Auseinandersetzung mit mir ab, kam zu mir, drückte meinen Kopf an ihre Brust und sagte versöhnlich: »Schon gut! Schon gut! An diesem wunderschönen Morgen wollen wir uns doch nicht streiten. Wir sind beide abgespannt und gereizt. Ich habe die halbe Nacht wach im Bett gelegen und an dich gedacht. Ich sehne mich nach dir. Bitte, bring mich heute abend nach Hause und mach mich glücklich.«
Wäre sie zänkisch oder kleinlaut gewesen, hätte ich vielleicht stundenlang meine Wut an ihr ausgelassen, wie ich es manchmal bei Emma tue. Aber ihre Zärtlichkeit entwaffnet mich stets und bringt mich zuweilen den Tränen nahe.
Trotzdem macht sie im therapeutischen Gespräch keinerlei Zugeständnisse. Sie ist überzeugt, daß meine Probleme mit Freud zu meiner Psychose beitragen. Ich gestehe es mir selber ein, kann es ihr gegenüber aber noch nicht zugeben. Ich habe ihr weder von der homosexuellen Vergewaltigung erzählt, die mir in jungen Jahren widerfuhr, noch von der homosexuellen Komponente meiner Zuneigung zu Freud, noch wie schwer es mir fällt, mich von seiner Dominanz frei zu machen.
Früher oder später muß jedoch die Wahrheit herauskommen, wenn wir meine Analyse gemeinsam fortsetzen. Aber um Gottes willen nicht schon jetzt! Ich bin ein alter, verheirateter Narr, der ein fünfundzwanzigjähriges Mädchen liebt. Dieses Glück möchte ich, so lange es geht, genießen. Ich sehe schon heftige Auseinandersetzungen mit Emma am Horizont auftauchen, und wenn mein finsterer Doppelgänger jemals über mich die Oberhand gewinnt, kann ich alle Hoffnung und Freude fahren lassen. Aber dann werde ich lieber dem Beispiel meines alten Freundes Honegger folgen und freiwillig aus diesem Leben scheiden.