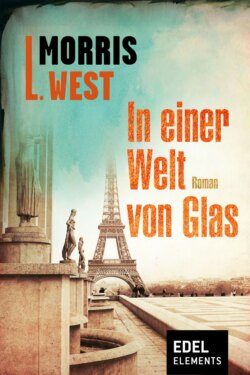Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 14
Magda
ОглавлениеParis
Heute morgen wachte ich mit Depressionen auf und war überzeugt, daß ich entweder mein Leben umstellen oder es beenden müsse. Auf alle Fälle gab es keine Möglichkeit, es in einer Verbindung mit Basil Zaharoff auf eine neue Grundlage zu stellen. Deshalb mußte ich mit dieser Situation unverzüglich fertig werden. Aber wie? Für ihn gab es nur ein Ja oder Nein. Zaharoff duldet keine Ausweichmanöver. Er ist in dem Gewerbe zu erfahren, um sich von weiblichen Ausflüchten täuschen zu lassen. Wenn ich sein Angebot ablehnen wollte, mußte ich vor ihn hintreten und ihn überzeugen, daß ich für die Rolle, die er mir zugedacht hatte, völlig ungeeignet bin.
Ich zwang mich zu baden, rollte meine beschmutzten Kleider zusammen, schloß die Notizen weg, die ich während der Nacht aufgezeichnet hatte, und rief das Zimmermädchen, das mir Kamillentee und einen Eisbeutel bringen sollte. Ich hatte starke Kopfschmerzen, gegen die nicht einmal die neuen deutschen Aspirin-Tabletten halfen. Als ich mich im Spiegel betrachtete, war ich entsetzt. Meine Haut glänzte weiß wie ein Tischtuch, meine Lippen waren blutleer, und um meine Augen zeichneten sich deutlich Krähenfüße ab. Die Angst, die ich aus meinem Gesichtsausdruck herauslesen konnte – eine Angst vor der unmittelbar bevorstehenden Katastrophe –, war ganz offensichtlich.
Um zehn rief ich Basil Zaharoff an. Sein Diener sagte mir, er schlafe und dürfe nicht gestört werden. Er sei während der Nacht erkrankt, und der Arzt sei gerade gegangen. Ich sagte dem Diener, daß auch ich krank gewesen sei. Er war sofort in Panikstimmung. Herr Zaharoff habe den Verdacht, daß beim Abendessen einige Austern verdorben gewesen seien. Daran könne jetzt kein Zweifel mehr bestehen. Ob ich, bitte, einstweilen im Hotel bleiben könne? Herr Zaharoff werde mich bestimmt anrufen, sobald es ihm besser gehe. »Inzwischen, gnädige Frau, seien Sie bitte vorsichtig! Ich schicke Ihnen sofort den Arzt.«
Der kam wie ein Geschenk des Himmels, so daß ich fassungslos vor Staunen war. Es war Giancarlo di Malvasia, ein Kollege aus meiner Studienzeit in Padua. In Wien waren wir in der gleichen Klinik. Er mußte jetzt Mitte Vierzig sein, sah aber noch blendend aus und war immer noch jener gepflegte Florentiner, der einmal erklärt hatte, er werde der größte Diagnostiker auf der ganzen Welt werden, und der dann als adeliger Anhänger des Zölibats zur Aufnahme in den Souveränen Malteserorden vorgeschlagen worden war.
Wir waren immer gute Kollegen gewesen, aber irgendwie hatte es mit der Sinnlichkeit zwischen uns nie funktioniert. Ich war für ihn zu ungebärdig gewesen, und er war zu sehr Snob aus der Toskana, um mich als Ausländerin anzuerkennen. Aber irgendwie war es uns gelungen, zu einer reservierten Freundschaft und sachlichem Respekt voreinander zu gelangen. Wir hatten auf verschiedenen Stationen und in der Anatomie zusammen gearbeitet, gelegentlich hatten wir bei schwierigen Fällen sogar miteinander korrespondiert. Dann, als ich den Arztberuf aufgab, verloren wir den Kontakt. Ich hörte später von Papa, daß Giancarlo sich eine einträgliche Praxis mit all den Fremden aufgebaut hatte, die jedes Jahr Europa bereisten. Ich hoffte, daß er mit meinem zweifelhaften Ruf nicht allzu eingehend vertraut war.
Er gab sich erfreut, mich zu sehen – noch immer diese verfluchte Florentiner Herablassung! –, und zeigte höfliches Interesse an meiner Verbindung mit Basil Zaharoff. Er untersuchte mich gründlich und machte mir dann ein ironisches Kompliment.
»Meine liebe Magda, du siehst zehn Jahre jünger aus, als es dir eigentlich zusteht. Mein Kompliment!«
»Ich gebe es an dich zurück, Gianni. Bestimmt hast du alle deine Ziele erreicht.«
»Nicht alle.« Er zuckte mit den Achseln und zog eine abschätzige Grimasse. »Ich bin kein Kandidat mehr für den Souveränen Malteserorden.«
»Bist du traurig darüber?«
»Meine Ehe bedrückt mich mehr. Eine kinderlose Verbindung, weder eine Liebes- noch eine Vernunftehe.«
»Das tut mir leid.«
»Ich bitte dich!« Er hob abwehrend die Hand. »Man lernt, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Und wie steht es mit dir? Ich weiß, du bist verwitwet und führst ein abwechslungsreiches Leben. Diese – hm – Affäre mit Zaharoff, ist sie neueren Datums?«
»Diese Affäre, wie du sie nennst, mein lieber Gianni, beschränkt sich bisher auf ein Abendessen mit verdorbenen Austern. Zaharoff hat mir bestimmte Angebote gemacht, die ich im Augenblick noch sehr reserviert betrachte.«
»Ich hoffe, du behältst einen klaren Kopf.« Giancarlo runzelte die Stirn. »Er ist gefährlich. Ich bin sein Leibarzt, und er entlohnt mich wie ein Fürst. Aber er würde mich ebenso schnell einen Kopf kürzer machen, falls ich ihm in die Quere käme. Aber, was mische ich mich in deine Angelegenheiten! Bleib heute im Bett! Nimm nur Tee mit Zitrone und trockenen Toast zu dir. Austern wirst du lange Zeit nicht mehr ansehen können.«
Er tat so, als wolle er gehen. Ich bat ihn, noch zu bleiben und sich mit mir zu unterhalten. Ich sagte ihm, ich brauchte dringend Rat, ärztlichen Rat unter dem Eid des Hippokrates. Er sah mich lange forschend an und fragte dann: »Bist du sicher, daß dies klug ist? Ich bin nicht dein Hausarzt. Ich kenne deine bisherige Krankengeschichte nicht. Außerdem habe ich mich nie auf Frauenleiden spezialisiert. Ich könnte dir einen guten Kollegen empfehlen ...«
»Das können wir entscheiden, wenn du gehört hast, was ich zu sagen habe. Bitte, Gianni! Ich brauche einen vernünftigen Rat, aber ich will das nicht mit einem mir völlig unbekannten Arzt besprechen.«
»Also gut.« Er ließ sich auf dem Bettrand nieder und nahm meine Hand. »Erzähl mir alles!«
Mir fielen plötzlich die richtigen Worte nicht ein. Ich brach in Tränen aus und stammelte schließlich: »Gianni, ich bin am Ende. Mein ganzes Leben ist verfahren. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Das weiß ich auch nicht, solange du mir nicht alles erzählt hast.« Er gab mir sein Taschentuch, damit ich die Tränen abtrocknen konnte. »So, nachdem du dich ausgeweint hast, wollen wir versuchen, als Kollegen miteinander zu reden.« Ich suchte wieder nach Worten und sagte schließlich: »Wien, Professor Richard von Krafft-Ebing. Erinnerst du dich an ihn? Erinnerst du dich an sein Buch ›Psychopathia sexualis‹ und die langen Debatten, die wir darüber geführt haben?«
»Gewiß. Und?«
»Er hat in seinen Vorlesungen über die forensischen Aspekte der Sexualität häufig den Satz verwendet: ›Man muß immer Mitleid mit denjenigen haben, die den Teufel im Leib haben.‹ Ich gehöre zu diesen, Gianni. Ich habe alles gesehen, alles getan – aber nichts löscht den Brand. Ich bin bekannt bei der Polizei und den Leuten im Untergrund. Deshalb will Zaharoff, daß ich für ihn arbeite. Er will, daß ich sein europäisches Bordellimperium leite. Wenn ich das Angebot annehme, gewährt er mir Schutz, und ich mache ein Vermögen. Wenn ich ablehne, bleibt mir der Teufel im Leib. Bevor du vorhin hereinkamst, wollte ich überhaupt Schluß machen ... An wen soll ich mich wenden, Gianni? Wer hilft Menschen wie mir? Bitte, verachte mich nicht!« Ich verachtete mich selbst. Ich war erschüttert, weil ich mich vor einem Mann, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, so gehen ließ und Tränen in sein seidenes Taschentuch vergoß. Er gab mir keine Antwort. Er stand unvermittelt auf, schritt zum Fenster und blickte lange auf die Blumen hinaus, die auf dem sonnigen Balkon blühten. Als er sich wieder umwandte, lag sein Gesicht im Schatten. Er stellte mir eine Frage, die gar nicht in den Zusammenhang paßte.
»Bist du gläubig? – katholisch, lutherisch, waldensisch?«
»Nein. Manchmal habe ich mir gedacht, ich würde gern gläubig sein. Ich habe aber nie den echten Wunsch verspürt, mich einer Religionsgemeinschaft anzuschließen. Warum fragst du das?«
»Wenn du einen Glauben hast, kann es dir manchmal helfen. Mir hat es geholfen. Sonst hätte ich es bestimmt nicht ausgehalten.«
»Was ausgehalten?«
Er setzte sich wieder und ergriff meine Hände. Er lächelte jetzt, ein frostiges, ironisches Lächeln, das den strengen aristokratischen Zügen ein ungewöhnliches Pathos verlieh.
»Willst du mir etwa sagen, daß du, obwohl wir alle diese Jahre zusammen gearbeitet haben, es nie geahnt hast? Ich hatte Angst vor dir, vor allen Frauen. Du hast mich immer einen Snob genannt. Das war ich eigentlich nicht. Ich versuchte nur, für mich selbst eine Identität zu finden. Ich wollte ein Renaissancemann sein, einer jener jungen Höflinge von Lorenzo dem Prächtigen. Tatsache ist, daß ich hundertprozentig homosexuell bin. Meine Mutter hat mich durch dauerndes Nörgeln in die Ehe getrieben. Meine Frau wurde von ihren Eltern zu einer Verbindung mit einer wohlhabenden, adligen Familie genötigt. Es war für uns beide ein schrecklicher Fehler. Wir wollen die Ehe durch die Römische Rota annullieren lassen, aber es ist ein langwieriges Verfahren und äußerst kostspielig. Inzwischen hat sich meine Frau einen Liebhaber zugelegt, weshalb ich ihr keinen Vorwurf machen kann. Und ich ...«
Er brach ab. Ich wartete längere Zeit, dann fuhr er fort.
»Ich habe meinen Frieden mit Gott gemacht. Ich bin in den Schoß der Kirche zurückgekehrt und in den Dritten Orden des heiligen Franziskus eingetreten. Ich widme einen Teil meiner Zeit der Fürsorge für die Armen.«
Er sagte dies so schlicht, daß es mir den Atem nahm. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich ein Glaubensbekenntnis hörte. Ich fragte vorsichtig: »Und du glaubst, daß sich dadurch vieles für dich verändert hat?«
»Vieles verändert? Nein. Ich fühle mich noch immer zu Männern und nicht zu Frauen hingezogen. Aber ich halte den Zölibat ein und glaube, daß sich dieses Opfer lohnt. Ich finde, daß ich mehr über die Probleme anderer Menschen als über meine eigenen nachdenken muß. Wenn ich besonders verzweifelt bin – und glaub mir, meine liebe Magda, ich habe viele solche Tage –, dann bete ich und habe das Gefühl, nicht allein zu sein.«
»Du bist ein Glückspilz. Ich bin dafür geboren.«
Er schüttelte den Kopf und machte wieder ein tiefernstes Gesicht. »Das ist es gar nicht. Es ist eine Gnade, ein Geschenk. Warum es Gott einigen gibt und anderen vorenthält, ist ein Geheimnis, vielleicht überhaupt das entscheidende Geheimnis.«
»Das hilft mir wenig, und – verzeih mir – es spricht auch nicht besonders für deinen Gott.«
»Gerade darum geht es im Glauben: Man lebt mit lauter Widersprüchen. Ich verstehe deine Skepsis, aber ich frage mich, ob du dich nicht wenigstens an einen religiösen Ratgeber wenden solltest. Für Menschen wie uns, meine liebe Magda, bietet die Lehre von der Vergebung tiefen Trost. Statt uns selbst nur als abartige Außenseiter zu sehen, erkennen wir uns in gewissem Sinne als die Auserwählten, die ein schwereres Kreuz zu tragen haben, um einer höheren Bestimmung gerecht zu werden. Ich weiß, ich rede wie ein Dorfpfarrer, aber auch ich war der Verzweiflung nahe. Dann hat mich ein alter Priester, der einmal Kaplan unserer Familie war, überredet, Exerzitien bei den Kamaldulensern, die in der Toskana das Kloster Camaldoli haben, zu absolvieren. Von außen war es ein abweisender Ort, aber drinnen stieß ich auf so viel ruhige Heiterkeit, so viel Mitleid mit den Geschlagenen ... Ich wollte, ich könnte dir diese Erfahrung anschaulicher erklären, aber mir fehlen die Worte.«
Er sprach so feierlich und ernst, daß ich am liebsten laut losgelacht hätte. Ich wußte noch, wie ich damals an der Universität versucht hatte, mich an ihn heranzumachen, und erstaunt war, daß er nicht Feuer fing. Welche Verschwendung, all die sehnsüchtigen Frauenblicke galten einem finocchio! Dann kam mir plötzlich der verrückte Gedanke, ihn ins Bett zu zerren, wüste Spielchen mit ihm zu treiben und ihm beizubringen, wo der Spaß zu holen ist.
Exerzitien? Gebete, um den Sinnenkitzel zu heilen? Ach du liebe Güte! Gott sei Dank brauchte sich Papa einen solchen Unsinn nicht mehr anzuhören. Ich behielt mich in der Gewalt und blieb mit gefalteten Händen sittsam im Bett sitzen, um zu warten, bis dieser jammernde Aristokrat seine Predigt beendete. Seine nächste Frage überraschte mich.
»Wie lange ist es her, daß du den Arztberuf an den Nagel gehängt hast?«
»Ach, schon über zehn Jahre. Mein Mann starb an Krebs. Ich habe ihn behandelt. Er war mein letzter Patient.«
»Hast du mit der Literatur Schritt gehalten, mit den neuesten Veröffentlichungen und Lehrmeinungen?«
»Nein. Warum?«
»Ich verfolge die psychoanalytischen Forschungen von Freud und Jung und deren Kreis. Vor zwei Jahren nahm ich an ihrer Konferenz in Weimar teil. Die Arbeiten, die sie vorstellten, waren vorzüglich. Sie vermittelten zahlreiche neue Einsichten in psychotische und neurotische Erkrankungen. Ihre Traumanalysen, ihre Untersuchungen familienbedingter Haltungen – ich fand dies alles höchst wertvoll für die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Problemen und die Behandlung meiner Patienten. Aber ich bin natürlich viel zu wenig erfahren, um mich ganz der psychoanalytischen Methode zu bedienen. Eines Tages vielleicht ... Meine liebe Magda, du wärst bestimmt nicht schlecht beraten, einen Experten auf diesem Gebiet zu konsultieren. Die Psychoanalyse löst ein Problem nicht unbedingt, aber sie verringert seine Last. Es bleibt nicht nur der riesige Schattenriß an der Wand.«
»Wie hat sie dir geholfen?« Ich wollte immer noch sticheln. »Sie kann doch nicht großmächtiger als Gott sein, wenn auch vielleicht erträglicher als die Einzelhaft in einem Kloster.«
Zum erstenmal lachte er, und es klang sogar richtig lustig. »Ich weiß, du hältst mich immer noch für einen verstaubten Florentiner Snob, der am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Aber ich habe die Fahrt durch die Hölle schon hinter mir – und es ist eine echte Gnade, daß ich sie überlebt habe. Wer mir dabei geholfen hat, muß nicht unbedingt auch der passende Helfer für dich sein. Aber du brauchst wie Dante einen Führer, jemanden, mit dem du im Inferno reden kannst. Sonst verlierst du tatsächlich den Verstand.«
Plötzlich schämte ich mich. Ich war ein selbstzerstörerisches Biest, das sich über einen braven Mann lustig machte, nur weil er der Wahrheit zu nahe gekommen war. Ich war betreten und wollte mich entschuldigen, aber er schnitt mir mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Überlegen wir einmal, wer von diesen Leuten dir am besten helfen könnte! In erster Linie käme natürlich Freud in Frage. Er sieht die menschliche Sexualität in allen ihren Aspekten. Während sich Krafft-Ebing auf Symptome und Erscheinungsformen beschränkte, fragt Freud nach den Ursprüngen. Andererseits habe ich persönlich eine gewisse Antipathie gegenüber diesem Mann entwickelt. Gewiß, er ist Jude, und ich gebe zu, ein altes Vorurteil gegen diese Rasse zu teilen. Er ist brillant, neigt aber zur Arroganz.« Giancarlo gestattete sich, bei diesen Worten leicht zu erröten. »Ich weiß, auch ich bin arrogant. Aber bei Freud geht mir etwas gegen den Strich. Er schließt jeglichen religiösen Aspekt beim Menschen völlig aus, jeden Glauben an Gott oder an einen göttlichen Einfluß auf das menschliche Leben. Dies ist für mich ein entscheidendes Negativum an seinem Gedankengebäude. Jung legt das Schwergewicht auf die historischen Symbole, die in unserem bewußten und unbewußten Leben immer wieder auftreten. Er ist ein religiöser Mensch, auch wenn er seine Auffassungen nicht immer mit althergebrachten Begriffen formuliert. Dann sind da noch Leute wie Bleuler, ein sehr erfahrener Kliniker, die Amerikaner Putnam und Brill sowie ein junger Schüler von Freud, ein sehr eifriger und gescheiter Mann namens Jones. Bei allem Für und Wider würde ich jedoch Jung empfehlen. Er lebt in Zürich, also in der Nähe, und ich weiß, daß er Privatpatienten annimmt. Das tun sie allerdings alle. Von der Psychoanalyse wird zur Zeit viel geredet als einer neuen Wissenschaft, aber sie ist noch nicht so einträglich wie die Schulmedizin.« Er hob mein Kinn hoch, so daß ich ihm ins Gesicht sehen mußte. »Nimm diese Sache nicht auf die leichte Schulter! Die Wechseljahre sind ohnehin eine schwierige Phase. Du brauchst Hilfe, wenn du diese Jahre ohne ein schlimmes Trauma hinter dich bringen willst. Was meinst du? Soll ich Jung schreiben und ihn bitten, mit dir zu sprechen?«
»Laß mich noch etwas darüber nachdenken, Gianni. Wenn ich ihn konsultieren will, schreibe ich ihm selbst. Andernfalls könntest du ja vielleicht für mich einen netten Konvent in der Toskana ausfindig machen.«
»Ich könnte dir ein ganzes Dutzend empfehlen. Eine reiche reuige Sünderin ist überall jederzeit willkommen.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »In einem Konvent wärst du bestimmt besser aufgehoben als bei Basil Zaharoff.«
»Ich weiß. Vielleicht kannst du mir behilflich sein, mit ihm ins reine zu kommen.«
»Aber wie?«
»Er weiß, daß du mich besuchst. Du könntest ihm erzählen, daß ich zwar von den Austern genesen sei, aber Anzeichen akuter Hysterie erkennen ließe.«
»Höre auf meinen Rat, Magda! Rede mit Zaharoff ganz unverblümt. Glaub mir, er mag keine Auseinandersetzungen. Das ist nicht seine Art. Wenn du sein Angebot ablehnst, ist die Sache erledigt. Hoffe nur, daß du ihn in der Zukunft nie um Hilfe zu bitten brauchst!« Er beugte sich nieder und küßte mich flüchtig auf die Stirn. Dann bat er mich, ihn anzurufen, wenn ich noch einmal einen Brechanfall haben sollte, und verabschiedete sich schnell.
Ich blieb lange liegen, blickte zu den Nymphen auf dem Deckengemälde hinauf und sehnte mich nach einem Mann oder einer Frau, einem Menschen, der die Einsamkeit mit mir teilen könnte.
So verbrachte ich den Nachmittag, bis um sechs Uhr Basil Zaharoff angemeldet wurde. Er wirkte zwar etwas abgespannt, war aber weltmännisch wie eh und je. Er sei gekommen, sagte er, um sich in aller Form für meine Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und um für den unglaublichen Leichtsinn seines Küchenpersonals um Verzeihung zu bitten. Die »Entschuldigung« hatte die Gestalt eines goldenen Armbands mit einer Schließe aus Diamanten und Rubinen. Ich protestierte und erklärte, dieses Geschenk nicht annehmen zu können.
Zaharoff blieb hartnäckig. Er legte mir das Schmuckstück um das Handgelenk und drückte den Sicherheitsbügel zu. Erst dann erlaubte er mir, ein Wort zu sagen. Ich setzte ihn von meinem Entschluß in Kenntnis. Ich zählte hastig die Gründe auf, weshalb ich sein Angebot nicht annehmen könne, und brachte es sogar fertig, der Selbstgefälligkeit des Paschas Genüge zu tun, der sich hinter der Maske eines Gentleman verbarg.
»Ich fühle mich durch Ihr Angebot geschmeichelt und in Versuchung geführt. Es würde für mich viele Probleme lösen, aber für Sie viele neue heraufbeschwören. Sie gehören zu jenen Männern, die ich außerordentlich bewundere.
Ihre Wertschätzung würde zwar viel für mich bedeuten, aber ich muß ganz offen und ehrlich sein: Ich bin nicht sicher, ob ich mich auf meine Standfestigkeit verlassen kann. In meinem Inneren gehen Dinge vor, die ich noch nicht begreife. Ich bin Ärztin. Ich erkenne die Anzeichen des Abgespanntseins und des Nachlassens meiner Selbstbeherrschung. Es sind noch nicht die Wechseljahre, aber die könnten mir hart zusetzen. Sie stehen vor bedeutenden Unternehmungen. Sie brauchen einen zuverlässigeren Partner als mich.«
Ich war wieder den Tränen nahe, aber ich empfand eine große Erleichterung, daß die Worte einmal ausgesprochen waren. Zaharoff bemühte sich, mich zu trösten.
»Bitte, meine Liebe! Nicht weinen, ich bitte Sie! Ich bedauere natürlich sehr, Ihrer Fähigkeiten verlustig zu gehen, aber ich weiß Ihre Aufrichtigkeit zu schätzen, und ich hoffe, daß wir gute Freunde bleiben.«
»Das hoffe auch ich, glauben Sie mir!«
Er nahm mich in die Arme und sagte, ich sei schön und begehrenswert. Er erinnerte mich an mein Versprechen. Gebe es einen besseren Zeitpunkt als den jetzigen, um uns gemeinsam zu vergnügen? Er hatte recht. War ein besserer Augenblick überhaupt möglich? Wenn ich dem Tiger entkommen wollte, mußte ich mich erst vergewissern, daß die Bestie schläfrig und freundlich geworden war.
Dies mag das einzige sein, was man zur Verteidigung von Basil Zaharoff anführen könnte, dem Strichjungen aus Tatavla, der Tod und Schrecken in ganz Europa verbreitet und nie einen einzigen Blutstropfen an seinen Händen sieht: Er ist ein erfahrener Liebhaber und für sein Alter überraschend vital.
Auch er machte mir ein Kompliment. Als er sich wieder ankleidete, um nach Hause zu fahren, und ich ihm beim Binden seiner seidenen Krawatte half, nahm er mein Gesicht in seine gepflegten alten Hände und sagte mit bedauerndem Lächeln: »Meine liebe Magda, ich wünschte, du würdest dir mein Angebot noch einmal überlegen. Du wärst in diesem Fach unübertrefflich.«
In der folgenden Nacht hatte ich wieder den Alptraum mit der Glaskugel. Diesmal war es jedoch nicht das Auge der Sonne, das mich ängstigte, es war Basil Zaharoff. Er rollte die Kugel mit der Spitze seines Spazierstocks herum und klopfte auf die Glashülle, bis große Risse erschienen – wie die Risse auf dem Gesicht von Humpty Dumpty. Ich hockte, einem Embryo gleich, nackt im Inneren und fragte mich, in welcher monströsen Gestalt ich wohl zur Welt kommen würde, wenn die Schale platzte und ich auf den blutroten Sand geworfen würde.