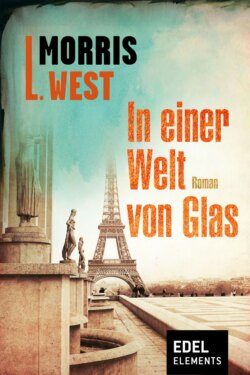Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 7
Carl Gustav Jung
ОглавлениеZürich
Ich habe eine Reise angetreten, die gefahrvoller ist als all die Expeditionen der alten Seefahrer – eine Reise zum Mittelpunkt meiner selbst. Ich muß herausbekommen, wer ich bin und warum ich bin. Ich muß mit dem Dämon fertig werden, der in mir lebt. Ich muß mit meinem längst verstorbenen Vater über jenen Gott rechten, den er predigte und den ich ablehnte. Ich muß mit meiner längst dahingegangenen Mutter reden, die ich nie lieben gelernt habe. Ich muß dem Mann begegnen, der mich als Knaben vergewaltigte, und den dunklen Göttern, die mich jetzt noch im Traum verfolgen. Ich muß das Band zu Freud durchtrennen, und das ist gewiß keine einfache Aufgabe. Ich muß vom letzten Uferstreifen in das wilde Meer meines persönlichen Unbewußten vorstoßen.
Dieses Unterfangen ist voller Schrecknisse, mit denen ich in den Stunden nach Mitternacht ringe. Ich komme mir vor wie der Seefahrer früherer Zeiten, der auf eine uralte Karte blickt, auf welcher der Kartograph gleich hinter den Säulen des Herkules fürchterliche, feuerspeiende Tiere eingezeichnet hat. Solche Monster sind mir vertraut. In meinen Träumen erscheint eine ganze Menagerie von ihnen: der riesenhafte, einäugige Phallus in der Höhle, die Taube mit der Stimme eines Menschen, die lebenden Leichname von Alyscamps, der schwarze Skarabäus und die Felsen, aus denen Blut herausspritzt. Irgendeines dieser herrlichen Wesen hält stets neben meinem Kopfkissen Wache.
Ich strecke im Dunkeln die Hand nach Emma aus, um sie näher an mich heranzuziehen. Mit einem Seufzer des Mißvergnügens wendet sie sich ab und legt die Hand auf ihre Scham. Diese Abwehrreaktion ärgert mich, habe ich mich ihr doch nie aufgedrängt. Ich verstehe, daß sie, im zweiten Monat schwanger, für körperliche Liebe nicht viel übrighat; aber sie ahnt nicht, wie einsam ich mich in diesem Ehebett fühle, wie schutzlos ausgeliefert. Wenn es nicht Toni gäbe, ich wäre längst impotent.
Natürlich ist mehr im Spiel als nur diese zeitlich bedingte Aversion gegen das Sexuelle. Emma ist schon immer eher autoerotisch eingestellt gewesen. In ihrem letzten Briefwechsel mit Freud hat sie dies sogar zugegeben. Sie sehnt sich also weniger nach mir als ich nach ihr. Meine Krankheit hat mich verändert, aber auch meine Rolle in der Familie. Ich bin für alle zu einer Last geworden. Ich arbeite nicht mehr in der Klinik. Ich habe meine Vorlesungen aufgegeben, weil ich mich nicht einmal auf den einfachsten Text konzentrieren kann. Die Liste meiner Privatpatienten ist bedauernswert klein geworden. Ich kann die Familie nicht mehr ernähren, und wir müssen von Emmas Erbschaft leben. Sie ist infolgedessen zur matrona victrix geworden, zur siegreichen Matrone, sicher eingebettet in ihrer Rolle als Mutter und unangreifbar in ihrer Selbstachtung, während mein Selbstgefühl durch Krankheit und finanzielle Abhängigkeit schwer angeschlagen ist. Sie ist also zu guter Letzt in der Lage, sich indirekt für meine tatsächlichen oder eingebildeten Seitensprünge zu rächen.
Ich erhebe nicht den Anspruch, ein Musterbeispiel für eheliche Treue zu sein. Ich gehe nicht mit jeder Beliebigen ins Bett, aber monogam veranlagt bin ich nicht. Meines Erachtens hielten es die alten Griechen richtig: eine Ehefrau für Haus und Kinder, die Hetäre oder den Lustknaben zur Gesellschaft und das Freudenhaus für ausgelassene Späße, wenn einem danach zumute war. Unsere verknöcherte kalvinistische Gesellschaft in der Schweiz legt Männern und Frauen unerträgliche Beschränkungen auf. Jede Ehe bedarf einer gewissen Freizügigkeit.
Natürlich ist Emma anderer Ansicht, und ich versuche nicht, diesen Punkt mit ihr zu diskutieren. Mir reichen die Szenen wegen Toni, und Emma zögert auch nicht, mir lautstark immer wieder Beispiele aus der Vergangenheit vorzuhalten – etwa diese Frau Spielrein, die unbedingt ein Kind von mir haben wollte.
Die analytische Psychologie steckt voller Versuchungen. Auch wenn man tugendhaft wie ein Einsiedler im härenen Gewand ist, kann man ihnen nicht immer widerstehen. Wenn eine Frau ihre Seele offenbart, ist sie viel gefährlicher, als wenn sie bloß Rock und Bluse ablegt. Diejenigen, die man abweist, verbreiten Skandalgeschichten. Gibt man ihnen nach, und sei es auch nur mit einem winzigen Eingeständnis der Zuneigung, werden sie zu unersättlichen Empusen.
Was du auch tust, du wirst verdammt. Und deine Frau gibt dir die Quittung, indem sie wie eine Botticelli-Jungfrau die Scham mit der Hand bedeckt. Zum Teufel damit! Es ist besser, aufzustehen und zu arbeiten, statt hier im Finstern zu liegen und mit juckenden Eiern alten Ängsten nachzugehen.
Im Arbeitszimmer ist es kalt und still wie in einem Grab. Wäre doch Toni hier, um etwas Wärme und Glut zu verbreiten. Ich bin versucht, sie anzurufen; aber so egoistisch bin ich nun auch wieder nicht, sie um zwei Uhr nachts aufzuwecken. Ich gieße mir ein großes Glas Cognac ein und stopfe meine Pfeife. Ich schlage auf dem Lesepult das schwarze Buch auf, in dem ich jeden Schritt meiner Wanderung verzeichne, die hoffentlich einmal zur Erleuchtung führt. Auf den Schreibtisch lege ich die Akte mit den Traumdeutungen, an denen ich mit Toni gearbeitet habe. Daneben lege ich einen Notizblock, eine Kladde, meine Bleistifte und meine Farbstifte. Ich zünde mir die Pfeife an und mache dankbar den ersten Zug. Langsam trinke ich einen großen Schluck Cognac. »So«, sage ich zu mir selbst, »so«, sage ich zu meinem dunklen Doppelgänger, »jetzt fangen wir an. Wir wollen einmal sehen, ob wir uns einander verständlich machen können.«
Ich nehme den schwarzen Bleistift, den weichen, in die Hand und versuche zu schreiben. Sofort gerate ich ins Stocken. Ich kann meine Phantasien einfach nicht schriftlich fixieren. Nur mit größter Anstrengung kann ich die einfachen, üblichen Fragen niederschreiben: »Wer bin ich? Wo wohne ich? Welchen Beruf habe ich?«
Nach wenigen Minuten gebe ich den sinnlosen Versuch auf. Ich trinke. Ich inhaliere den beruhigenden Rauch. Ich verfalle in Tagträume. Ich greife wieder zum Bleistift und beginne, meine Träume zu zeichnen. Dabei überkommt mich eine wunderbare Ruhe. Die Wände meines Arbeitszimmers fallen auseinander. Meine Kleider verschwinden. Ich stehe nackt vor einer gewaltigen Felswand aus ockerfarbigem Gestein und zeichne auf ihr mit einem Kohlestift.
Zuerst mache ich einen großen Kreis, selbstsicher und vollkommen wie Giottos »O«. In den Kreis zeichne ich ein Mädchen und einen Mann hinein. Sie ist jung und gerade zur Frau gereift, er ist alt und ehrwürdig, mit langem, weißem Haar und wallendem Bart. Er hat einen Stab in der Hand. Eine Aura heiterer Autorität umgibt ihn. Ich verstärke das Lächeln um seine Mundwinkel. Hinter mir sagt eine tiefe Stimme anerkennend: »Besser! Viel besser!«
Ich fahre herum, um zu sehen, wer da spricht. Vor mir stehen der alte Mann und das Mädchen. Ich bin wie gebannt. Mein Blick wandert zwischen der Zeichnung und der Wirklichkeit hin und her.
Das Mädchen lacht über meine Verlegenheit. Der alte Mann lächelt und sagt: »Es ist wirklich ganz einfach. Ich bin Elias. Dies hier ist Salome. Du erträumst uns und malst uns auf eine Wand. Aber wer bist du?«
Ich kann ihm nicht antworten. Ich blicke an mir herunter, nackt wie ich bin, und schäme mich. Ich schüttele den Kopf. »Ich weiß nicht, wer ich bin.«
Da sagt der alte Mann: »Das macht nichts. Wir wissen, wer du bist.«
Das Mädchen streckt mir die Hand entgegen. Ich ergreife sie zögernd. Sie zieht mich enger zu sich und dem alten Mann. Ich werde wieder ganz ruhig. Ich erinnere mich, daß ich Carl Gustav Jung heiße, und ich bin stolz, es ihnen sagen zu können. Wir setzen uns gemeinsam auf einen flachen Felsen, und ich frage höflich:
»Herr Elias, ist diese junge Dame Ihre Tochter?«
»Sag es ihm, Kind.« Den alten Mann amüsiert meine Frage, aber er beantwortet sie nicht direkt. »Sag ihm, wer du für mich bist.«
»Ich bin alles: Tochter, Gemahlin, Geliebte und Beschützerin.«
»Bist du zufrieden, Carl Gustav Jung?«
»Ich bin verblüfft, nicht zufrieden.«
»Dann hast du keinen Anspruch darauf, zufrieden zu sein. Dreh dich wieder zur Wand um, und mach die Zeichnung fertig!«
Ich wende mich um – und bin wieder in meinem Arbeitszimmer. Meine Pfeife qualmt im Aschenbecher. Der Cognac ist verschüttet, und ich wische ihn mit meinem Taschentuch auf. Aber in meiner Kladde ist tatsächlich eine Zeichnung. Der Kreis ist vollkommen wie Giottos »O«. Der alte Mann und das Mädchen sehen genauso aus, wie sie mir im Traum erschienen sind und wie ich sie auf die Felswand gezeichnet habe. Was bedeutet das? Wie soll ich mir dieses Phänomen erklären?
Dann fällt mir etwas ein. Ich krame eine Stunde lang in meinen Bücherregalen. Hastig mache ich mir Notizen. Das Schreiben fällt mir jetzt nicht mehr schwer. Um vier Uhr morgens habe ich drei kleine Geschichtsauszüge beisammen: Simon Magus, der Begründer der Gnosis, reiste mit einem Mädchen aus einem Freudenhaus umher. Laotse, der chinesische Weise, verliebte sich in eine Tänzerin. Der Apostel Paulus war, so heißt es, der Jungfrau Thekla zärtlich zugetan. Lauter alte Legenden! Aber was für eine kosmische Magie hat sie in mein Unbewußtes eingepflanzt? Elias und Salome sind mir jetzt so gegenwärtig, daß ich sie mit ausgestreckter Hand berühren könnte. Wenn sie nicht Wirklichkeit wären – eine ganz bestimmte Art von Wirklichkeit –, wie hätte ich sie erträumen können? Ist unsere ganze Geschichte also in unserem Unterbewußtsein begraben, vergessen, aber abrufbereit, und wartet sie nur darauf, wie Irrlichter aus der Tiefe des Sumpfes heraufbeschworen zu werden?
Ich kann mich der Frage jetzt nicht stellen. Ich klappe die Kladde zu und gehe hinaus in das nebelige Grau des dämmernden Morgens. Am Ufer werfe ich flache Kiesel in den See und rufe immer wieder: »Elias! ... Elias! ... Salome, meine Liebe!«
Einzige Antwort ist das Rauschen von Vogelschwingen, während ein Moorhuhn über das seichte Wasser streicht.