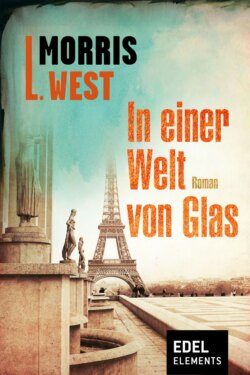Читать книгу In einer Welt von Glas - Morris L. West - Страница 6
Magda
ОглавлениеParis
Zum erstenmal seit zwanzig Jahren wohne ich nicht im Crillon, sondern in einer bescheidenen Pension in der Nähe des Étoile. Ich nehme die Mahlzeiten im Haus ein und gehe nur in solchen Stadtvierteln spazieren, wo ich bestimmt keine Freunde oder Bekannten treffe. In der Nachbarschaft befindet sich ein Kiosk, an dem ausländische Zeitungen verkauft werden. Ich habe mir das »Berliner Tageblatt« abonniert. Bis jetzt habe ich noch keine Meldung über das Schicksal meines Obersten entdeckt. Daß ich in Berlin war, wurde nur einmal in einer kurzen Notiz indirekt erwähnt: »Prinz Eulenburg hat von einem bekannten Gestüt sechs Jagdpferde gekauft, die auf seinem baltischen Gut für die kommende Saison ausgebildet werden.« Ich umreiße meine Situation. Mein Oberst lebt entweder noch, oder er ist tot. Wenn er tot ist, wird dies den Todesanzeigen zu entnehmen sein. Man wird ihn mit militärischen Ehren begraben: gedämpfte Trommelwirbel, ein reiterloses Pferd mit leeren Stiefeln in den Steigbügeln, eine Lafette – kurz, alles, was zur militärischen Tradition gehört. Wenn er lebt, muß er zumindest vorübergehend körperlich behindert sein und sich schwertun, dafür eine plausible Erklärung gegenüber seiner Frau zu finden. Ich weiß, daß er bei Liebeshändeln nie um eine Ausrede verlegen ist, aber diese Episode dürfte sein diesbezügliches Talent aufs höchste strapazieren.
Doch gibt es noch eine dritte, unangenehmere Möglichkeit: daß nämlich mein Oberst sich bald erholt und mich erledigen will. Er hat keinen Grund, mich zu lieben. Zudem ist es durchaus möglich, daß er sich vor Erpressung fürchtet – eines der wenigen Spiele, die ich noch nie ausprobiert habe. Man redet aber seit kurzem immer häufiger von neuen Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten. Bulgarien hat Serbien und Griechenland angegriffen. Im Westen werden Geschichten über Spione, Anarchisten und Attentäter kolportiert. Erst vor drei Monaten wurde auf König Alfonso von Spanien ein Attentat versucht. Wenn der Kaiser und sein Oberst mich loswerden wollen, könnten sie das ganz leicht arrangieren. Es ist allgemein bekannt, daß der Kaiser in diesen Tagen sehr empfindlich reagiert, wenn das Ansehen seines Hofes auf dem Spiel steht. Sogar sein königlicher Vetter in England hat einmal bemerkt: »Willy ist wirklich sehr ungeschickt!« Und mich hätten bereits beinahe Gerüchte ruiniert, die mich – diesmal allerdings fälschlicherweise – zu der »schönen Reiterin« machten, »mit der die Kaiserin angeblich ein Liebesverhältnis unterhält«.
Im Augenblick sitze ich also zurückgezogen in meiner Pension am Étoile. Ich lese die Morgenblätter, mache ein paar Einkäufe, gehe spazieren und hoffe, daß Gräfin Bette in Berlin ihr Wort hält. Ich versuche, das Komische an der Sache zu sehen, aber es ist wirklich nicht zum Lachen. Ich habe Angst. Ich bin zutiefst verwirrt – nicht etwa deshalb, weil mir jemand etwas antun könnte, sondern darüber, was ich mir selbst angetan habe. Plötzlich hat sich vor meinen Füßen ein schwarzes Loch aufgetan, und ich taumle am Rand der Vernichtung entlang.
Eine Erklärung finde ich nur, wenn ich mir ins Gedächtnis zurückrufe, was vor zwanzig Jahren geschah, als ich gerade mein Studium beendet hatte. Papa nahm Lily und mich auf eine Reise in den Fernen Osten mit. Wir fuhren auf dem Flaggschiff der alten Royal Dutch Line und liefen Hongkong, Schanghai, Indien, Siam und Java an. Eines Tages machten wir in Surabaja einen Landausflug und bummelten über den Markt, als plötzlich eine Panik ausbrach. Die Menschen stoben schreiend in alle Himmelsrichtungen auseinander. Wir blickten auf und sahen einen Malaien, der blindwütig mit einem großen, geschwungenen Kris um sich schlug und auf uns zugerannt kam. Er war schon ganz nahe herangekommen, vielleicht bis auf zehn Meter, als ihn ein holländischer Polizist niederschoß. Dies sei, erklärte Papa, die einzige Möglichkeit, ihm Einhalt zu gebieten. Der Mann lief Amok. Er war von einer mörderischen, manischen Wut ergriffen, gegenüber der jede Vernunft versagte.
»Deshalb muß man ihn töten«, sagte Papa lächelnd in seiner gelassenen Art. »Für ihn ist es eine Erlösung und für die Öffentlichkeit notwendig. Diese Art des Wahnsinns kann sich unter diesen Menschen wie die Pest verbreiten.« Ich frage mich, was er wohl gesagt hätte, wenn er seiner Tochter im selben Zustand im Schlafzimmer des Bordells der Gräfin Bette begegnet wäre. Es hatte wie ein ganz gewöhnliches Liebesspiel begonnen, wenn auch wie ein ziemlich heftiges. Mein Oberst, ein großer, kräftiger Kerl, brannte darauf, sich vor Frauen zu demütigen. Er verlangte, erniedrigt und für eingebildete Verfehlungen bestraft zu werden. Für seine Phantasien war ich die perfekte Kumpanin. Ich bin groß, sportlich, eine gute Reiterin, und ich verkehre in Jägerkreisen. Auch mir gefiel dieses Spiel – so wie mir fast alle sexuellen Abenteuer gefallen. Aber plötzlich war es kein Spiel mehr. Ich wurde zu einer reißenden Furie, voller Rachegelüste, die mich plötzlich übermannten. Ich wollte den Mann umbringen und schlug mit dem Griff meiner Reitpeitsche auf ihn ein. Erst als ich sah, daß er einen Herzanfall bekam – sein Brustkorb fiel ein, sein Mund verzerrte sich, und er rang nach Atem –, brachte mich dieser Schock in die Wirklichkeit zurück. Es ist schwer zu glauben, wie nahe ich daran war, einen Mord zu begehen, und wieviel Spaß ich dabei hatte.
Wenn ich aus meiner Pariser Zuflucht zurückblicke, kommt mir der Gedanke, daß sich dergleichen vielleicht wiederholen könnte und daß ich das nächste Mal nicht wieder mit einem blauen Auge davonkomme. Etwas geht in mir vor, und zwar schon seit längerer Zeit, was ich nicht erklären kann.
Jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, trete ich nackt vor den Spiegel. Ich habe allen Grund, mit dem, was ich sehe, zufrieden zu sein. Ich bin fünfundvierzig Jahre alt und habe ein Kind zur Welt gebracht. Aber meine Brüste sind fest, meine Haut ist rein, und meine Muskeln sind kräftig wie die eines jungen Mädchens. Meine Haare haben noch immer ihre natürliche, kastanienbraune Farbe. Zwar entdecke ich ein paar verräterische Linien um die Augen, aber bei günstiger Beleuchtung und sorgfältigem Schminken und Pudern sind auch diese kaum zu sehen. Ich bekomme noch regelmäßig meine Tage und leide noch nicht unter den Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Wenn ich heute abend – wozu ich Lust hätte – in den Club Dorian’s gehe oder Nathalie Barney besuche, kann ich beliebig wählen: Mann oder Frau.
Diese Veränderung, worin sie auch bestehen mag, vollzieht sich in meinem Innern. Es ist, als ob sich – wie soll ich es nur erklären? – in meinem Gehirn eine Tür geöffnet hätte und alle möglichen seltsamen Wesen losgelassen worden wären. Sie entziehen sich meiner Kontrolle. Ich kann ihrer nicht wieder habhaft werden. Nicht alle sind grausam und böse wie der Teufel, der mich bei Gräfin Bette geritten hat. Manche dieser Wesen sind phantasievoll, geistreich, ausgelassen, voll wilder und brillanter Gedanken. Aber sie folgen ihren eigenen Einfällen und nicht meinen Anweisungen. Ich könnte genausogut einen Handkarren durch die Tuilerien-Gärten ziehen wie mit Nathalie Barney bei einem Tango-Tee gewagte Dinge treiben.
Aber genau das ist es, was mich bestürzt. Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Bei Männern, Pferden und Hunden bin ich stets die Herrin gewesen; bei Frauen entweder eine zärtliche Freundin oder eine gefährliche Feindin. Ich bin nie von Alkohol oder Drogen abhängig gewesen, obwohl ich beide ausprobiert habe. Papa war es gewesen, der mich in seiner unverblümten Art darauf hingewiesen hatte: »Verlieb dich nie in die Flasche oder die Opiumpfeife! Du verbaust dir jeden Spaß und die Zukunft damit. Geh nie mit einem Fremden ins Bett! Die Syphilis ruiniert den ganzen Organismus. Denk immer daran, daß der einzige Liebhaber, der dein Herz gewinnen kann, derjenige ist, auf den du dich verlassen kannst!«
Ich wünschte, Papa wäre jetzt hier, damit ich ihm die Fragen stellen könnte, mit denen ich nicht fertig werde: »Was tut man, wenn man sich auf sich selbst nicht verlassen kann? Wohin wendest du dich, wenn du die Straßenschilder nicht mehr lesen kannst? Was soll ich mit all diesen Fremden anfangen, die in meinem Kopf herumschwirren?«
Aber das ist ja reine Narretei. Papa ist schon lange nicht mehr da, und ich kann nicht den Rest meines Lebens damit zubringen, Banalitäten mit der Witwe eines Abgeordneten auszutauschen oder meine längst verlorene Unschuld vor einem Weinhändler aus Bordeaux zu verteidigen, der unter dem Tisch mein Knie tätschelt. Koste es, was es wolle – ich muß aus dieser Unterkunft heraus. Heute abend gehe ich ins Dorian’s. Dort werde ich schon sehen, was mir bevorsteht.
Jahrmarkt der Abnormitäten? Wem sage ich das? Ich bin Clubmitglied bei Dorian’s, solange ich mich zurückerinnern kann. Laut Papa – der gewöhnlich über die Halbwelt sehr gut Bescheid wußte – wurde der Club von Liane de Pougy gegründet, die damals die große Lebedame von Paris war. Der König von Portugal schenkte ihr ein Vermögen. Baron Bleichröder, Lord Carnarvon, Fürst Strozzi und Maurice de Rothschild – sie alle zollten ihr Tribut mit Geld und Leidenschaft. Die Leidenschaft nutzte sie rücksichtslos aus, das Geld gab sie zügellos für lesbische Freundinnen, Ringer und allerlei seltsame Gestalten aus den Spelunken um den Montmartre aus.
Der Club war ihre private Abnormitätenschau, wo sie ihren willfährigen Kunden noch mehr Geld aus der Tasche ziehen konnte. Ihr Geschäftsführer war Dorian, ein kleiner, buckliger Gnom aus Korsika, der wie Zwerg Nase aussah, ein aufbrausendes Temperament besaß und trotz seiner Menschenverachtung ein Herz hatte, das so groß war wie der Buckel auf seinem Rücken.
Papa pflegte die Pougy und Dorian zu besuchen, sooft er nach Paris kam. Sie suchte aufgrund der Krankheiten ihres Gewerbes seinen ärztlichen Rat. Dorian behandelte er wegen der Gelenkschmerzen, die von seinem gekrümmten Rücken herrührten. Als die Pougy ihren Anteil an dem Club verkaufen wollte, überließ Papa Dorian das Geld zum Ankauf. So erbte ich eines schönen Tages die Mitgliedschaft auf Lebenszeit.
Als mein Mann starb und meine kleine Tochter zu ihrer Tante zog, sah ich mich mit einem großen Vermögen konfrontiert und einer Vielzahl lange aufgestauter Gelüste, die sich, falls ich mich nicht auch als Lebedame etablieren wollte, nur insgeheim befriedigen ließen. Dorian’s wurde meine Pariser Absteige. Als ich mich vorstellte und Papas alte Visitenkarte präsentierte, umarmte mich Dorian und ernannte mich auf der Stelle zu seiner Leibärztin.
Ich kann mich noch genau erinnern, wie er mit verschmitztem Lächeln den Zeigefinger an seine Nase legte und sagte: »Ein faires Tauschgeschäft, eh? Sie werden für meine Gesundheit sorgen, ich werde Ihnen alle Schwierigkeiten vom Leibe halten. Ich mochte Ihren Papa. Er war ein Draufgänger, aber er hatte heilende Hände – und, ach, so viel Stil! Die englischen Milords konnten ihm nicht das Wasser reichen. Von den Deutschen wagte keiner, sich mit ihm anzulegen. Und die Franzosen haben ihn nie ganz verstanden. Ich übrigens auch nicht. So war ich mir auch nie ganz sicher, was er mit Ihnen vorhatte ... Er hatte höchst seltsame Vorstellungen von der Erziehung einer Tochter ... Aber das geht mich nichts an. Manche mögen Fisch und manche mögen Geflügel, doch wie soll man das feststellen, bevor man nicht beides probiert hat, eh?«
Dorian ist inzwischen älter geworden, um mehr als ein Jahrzehnt. Seine Haare sind weiß. Seine Gelenke knacken, wenn er sich bewegt. Er hat die fahle Blässe eines Höhlenbewohners. Sein Dienstpersonal befindet sich stets in Rufweite: ein finsterer, wortkarger Bursche aus Ajaccio und eine Barfrau aus Calvi, die aussieht, als könne sie einen Ochsen mit den bloßen Händen erwürgen. Die Barfrau führt ihm den Haushalt. Der Mann aus Ajaccio folgt Dorian wie ein Schatten: er ist immer in der Nähe, kaum zu sehen, aber gefährlich wie eine Viper.
Wenn ich Dorian aufsuche, gehe ich zuerst in sein Haus am Quai des Orfèvres. Es ist ein Akt ritueller Höflichkeit. Ich bin seine Ärztin, und er erwartet, von mir untersucht zu werden. Anschließend begeben wir uns, von dem großen, schweigsamen Kerl gefolgt, über den gepflasterten Innenhof zum Club, wo Dorians Exoten sich produzieren.
Heute abend habe ich beschlossen, mein Poiret-Kostüm anzuziehen: lange schwarze Hose, schwarze Smokingjacke, weiße gerüschte Bluse und darüber einen mit mitternachtsblauer Seide gefütterten Umhang. Beim Ankleiden fragte ich mich, wieviel ich Dorian von meinem Dilemma erzählen dürfe. Wir sind gute Freunde, aber in unserem Zirkus der Absurditäten darf man die Bosheit nie unterschätzen.
Ich hätte mir darüber aber keine Gedanken zu machen brauchen, Dorian wußte schon alles – sogar mehr als ich. Mein Oberst lebte und erholte sich auf seinem Gut in Ostpreußen. Er hatte seinen Herzanfall überwunden, aber sein Rücken war noch in Gips. Aus der näheren Umgebung des Kaisers hatte er sich zurückgezogen und einen Posten im Generalstab übernommen ... Was mich angehe, seien zwar keine Vergeltungsmaßnahmen geplant, aber ich täte gut daran, mich nie wieder in Berlin sehen zu lassen.
»Du bist noch mit einem blauen Auge davongekommen!« Dorian gab sich in dieser Sache kurz angebunden. »Wenn du dich nicht in der Gewalt behalten kannst, fang solche Spielchen gar nicht erst an! Eines kann ich dir sagen: Die Preußen können sehr rüde werden ... Und jetzt sieh mich einmal an und sage mir, wie lange ich noch zu leben habe.«
Während ich seinen entstellten kleinen Körper untersuchte, dem rasselnden Geräusch der Lungen lauschte, sein verkrümmtes Rückgrat und die Knötchen an allen seinen Gelenken befühlte, hielt er mir wie ein Schulmeister einen Vortrag.
»Weiber! Ihr seid so dumm – jede von euch! Ihr begreift nie, daß ihr gegen die Bank spielt – und die Bank gewinnt letzten Endes immer. Zum Beispiel, Chérie. Du bist robust, du bist reich, und du bist intelligent. Aber auch du wirst dich allmählich aufreiben. Es wird nicht mehr lange dauern, und du bist nur noch ein Nervenbündel. Dann beginnt das große Geschrei. Du wirst zwar nicht ›Hilfe‹ schreien, aber ›Mord‹. Und schon wird dich die Polizei ins Gefängnis abtransportieren.«
Er streckte sich und streichelte meine Wange mit seiner kleinen, arthritischen Hand, die sich wie die Klaue eines Vogels zusammengekrampft hatte. Die Geste war zärtlich gemeint, wirkte aber bedrohlich.
»Du machst mir Kummer, Chérie. Die meisten Frauen, die hierher kommen, sind für mich wie ein offenes Buch. Irgendein Mann hat ihnen etwas angetan. Sie fühlen sich elend, weil sie nicht mehr jung sind. Es sind Lesbierinnen oder Einzelgängerinnen, die sich vom Leben noch etwas erwarten. Meist trinken sie, nehmen Drogen oder tun beides. Aber bei dir ist es anders. Einmal bist du eine Madonna mit honigsüßem Lächeln und Brüsten, welche die ganze Welt mit Muttermilch erfreuen könnten, und im nächsten Augenblick bist du eine Medusa mit giftigem Atem und Schlangenhaar.«
»Jage ich dir auch Angst ein, Dorian?«
»Angst?« Er lachte, und der heisere Ton endete in einem Hustenanfall. »Keineswegs! Ich kenne dich zu gut. Außerdem wagt niemand, sich mit einem Buckligen anzulegen. Man reibt ihm vielmehr den Buckel, weil das Glück bringen soll. Du könntest ihn mir auch reiben, wenn du magst. Du kannst etwas Glück gut gebrauchen.«
Auf das Wort »reiben« hatten wir uns seit langem stillschweigend geeinigt. Es war Ausdruck seines Schreis nach sexueller Entspannung mit einem Partner, der ihn nicht auslachen oder über die Geheimnisse seines verunstalteten Körpers herumtratschen würde. Ich tat ihm den Gefallen gern. Es dauerte nicht lange, und ich empfand dabei weder Widerwillen noch Abscheu. Statt dessen überkam mich eine seltsame Zärtlichkeit. Ich wollte ihm Freude bereiten, ihm Gelegenheit geben, sich als Mann zu fühlen, und ihn beobachten, während er schläfrig und zufrieden hinterher ein Glas Cognac mit mir trank.
Bei dieser Gelegenheit überfiel er mich mit der unverblümten Frage: »Warum ziehst du diese ... diese Löwenbändigernummer ab?«
»Löwenbändiger?« Die Vorstellung war so unwahrscheinlich, daß ich in lautes Lachen ausbrach. Dorian wurde böse.
»Mach keine Witze. So nennt man dich jetzt im ganzen europäischen Fachzirkus: la dompteuse des lions.«
»Das ist gar nicht so komisch.«
»Soll es auch nicht sein. Ein solcher Ruf bringt Risiken mit sich. Was erwartest du dir von diesen Verrücktheiten?«
»Nichts.«
»Warum tust du es dann?«
»Ich weiß es nicht, Dorian; ich weiß es wirklich nicht. Wenn es passiert, überkommt es mich wie ein Wutanfall, wie ein Feuersturm. Ich kenne mich dann selbst nicht mehr.«
»Wo wohnst du denn jetzt?«
»In einem Mauseloch mit anderen grauen Mäusen. Es ist eine Pension am Étoile.«
»Kannst du dort Besuche empfangen?«
»Nein.«
»Dann übernachte hier! Nimm mein Gästezimmer! Ich werde dich mit jemandem bekannt machen. Hinterher wirst du so friedlich sein wie eine Nonne bei der Abendandacht.«
»Nein, vielen Dank! Ich konnte jetzt keinen Mann verkraften.«
»Wer hat etwas von einem Mann gesagt?« Er fuhr mir mit seinen kleinen Krallenfingern durch die Haare. »Es ist ein Mädchen wie jenes, das Sappho auf Lesbos besungen hat. Ich glaube, du brauchst gerade jetzt so jemanden. Außerdem – was hast du zu verlieren? Wenn ihr beglückt einschlaft und als Freundinnen wieder aufwacht, geht es euch beiden besser.«
Er hatte recht. Ich verlor nichts, sondern gewann etwas – glaube ich wenigstens. Sie schmiegte sich an meine Brust wie ein Kind und rief: »Hab mich lieb, Mamilein, hab mich lieb! Nimm mich wieder in deinen Schoß!«
Ich dachte an meine verlorene Tochter und liebkoste das Mädchen. Dann versuchte ich meinerseits, den Eingang zu ihrem Schoß zu finden, aber er war zu klein und zu eng, um mir Einlaß zu gewähren. Ich ärgerte mich jedoch nicht, denn sie wollte mir so bereitwillig diesen Gefallen erweisen. Es war nicht ihre Schuld, daß das Haus zu klein und noch nie bewohnt worden war. Wir schliefen ein und hielten uns in den Armen – vielleicht nicht beglückt, aber zärtlich und ruhig. Gegen drei Uhr morgens wachte ich auf. Sie schlief in meiner Armbeuge und hatte die Lippen an meine Brust gedrückt. Der Mondschein fiel auf ihr Gesicht, und ich sah zu meiner Überraschung, daß sie fast so alt war wie ich. Wie ich hatte sie Krähenfüße an den Augenwinkeln und Runzeln um die Mundwinkel.
Ich empfand kein Bedauern, keine Enttäuschung, mir fiel nur plötzlich mein Vater wieder ein, der nach meiner ersten Liebesnacht morgens am Frühstückstisch lächelnd gesagt hatte: »Schon verteufelt schwierig, nicht wahr?«
»Entschuldige, Papa«, erwiderte ich, so keck es ging, »aber ich wüßte nicht, was schwierig sein soll.«
»Du Glückliche!« Er sah mich noch immer eulenspiegelhaft schmunzelnd an. »Als ich jung war, wußte ich nie, was ich ihnen hinterher sagen sollte.«
»Aber inzwischen hast du es gelernt?« Zum Necken gehörten immer zwei.
»O ja! Ich sage immer dasselbe: Danke, und – so leid es mir tut – leb wohl!«
»Das muß sie ja zu Tränen rühren!«
»Nein.« Er lachte und schwenkte ein Croissant vor meinem Gesicht hin und her. »Aber es hält alles im Fluß. Man macht sich keine Feinde. Wenn man Glück hat, behält man eine Freundin für kalte Winternächte.«
Diese Kindfrau wollte ich nicht behalten. Ich stand auf, ohne sie zu wecken, und ließ etwas Geld neben dem Kopfkissen liegen. Ich schlich hinaus in die graue Morgendämmerung, nahm mir eine Droschke und fuhr in die Pension zurück. Der Kutscher war mürrisch, das Pferd ging lahm und war nicht zum Traben zu bewegen; aber durch das langsame Klipp-Klapp seiner Hufe auf den Pflastersteinen konnte ich Lily hören, die ein Wiegenlied aus meiner Kindheit sang.
Reite auf dem Schaukelpferd nach Banbury Cross. Dort siehst du die Dame hoch zu Roß Mit Ringen an den Fingern und Glöckchen am Bein. So hört sie Musik und ist nie allein.