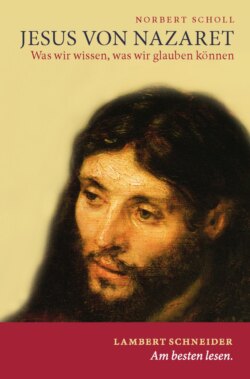Читать книгу Jesus von Nazaret - Norbert Scholl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stammbaum Jesu
ОглавлениеDer Stammbaum enthält eine schier endlose Aneinanderreihung von Namen, die meist niemand mehr kennt. Der Text soll daher hier nicht wiedergegeben werden. Doch einige Beobachtungen sind wichtig und auch interessant.
Matthäus wollte offensichtlich sein Evangelium mit einer Ahnentafel beginnen, wie das bei einer Biografie bedeutender Persönlichkeiten damals üblich war. Die meisten Herrscherhäuser leiteten ihr Selbstverständnis aus der Abstammung von Göttern und Heroen ab.
„Die Abstammung von einem Heroen musste allerdings auch ‚bewiesen‘ werden. So kam es, dass die Ahnenreihen mit Füllnamen vervollständigt werden mussten. […] Aus politischen Erwägungen legten auch ‚Emporkömmlinge‘ (wie Alexander der Große) großen Wert auf edle Abstammung. Dem wirklichen Adel, dessen Macht im Schwinden begriffen war, wollten sie dennoch in diesem Punkt gleichkommen. […] Mit der verstärkten Übernahme griechischer Kultur kam es auch in Rom zur Ahnenjagd und einer Rückverfolgung der Stammväter bis in mythische Vorzeiten.“7
Doch wie sollte Matthäus an den Stammbaum Jesu kommen? Lebten in Nazaret noch Verwandte von Jesus, die er hätte danach fragen können? Selbst wenn das der Fall gewesen wäre, so hätten diese ihm sicher keine Ahnentafel präsentieren können.
Die Väter
Matthäus oder seine Informanten wussten sich zu helfen. Jesus galt als Sohn Davids. Und für die Ahnen des Königs David gab es eine Quelle, auf die Matthäus zurückgreifen konnte: die jüdische Bibel, das aus christlicher Perspektive so genannte Alte Testament. Dort finden sich zwei Geschlechtsregister dieses Königs.8 Auch für die Nachkommen Davids in der Zeit bis zum Exil existiert eine Ahnentafel.9 Aber in diesen Ahnentafeln klafft eine gewaltige Lücke über den Zeitraum von gut 500 Jahren bis zur Gegenwart des Evangelisten. Für diese Zeit gab es in der Schrift keine Aufzeichnungen. Doch ohne eine lückenlose „Beweiskette“ würde der Stammbaum nichts taugen. Bis heute wissen wir nicht, wie Matthäus diese Lücke geschlossen hat und wie er zu den Namen gekommen ist, die er hier einsetzte. Vielleicht hat er irgendeinen im Volk verbreiteten Stammbaum dafür herangezogen.
Dennoch ist die Ahnentafel, die uns Matthäus präsentiert, interessant für alle, die sich ein bisschen in der Schrift auskennen. Der Evangelist hat nämlich nicht einfach jene Namen und Geschlechterfolgen aneinandergereiht, die er in der Schrift vorfand. Er hat diese Ahnentafeln unter ganz bestimmten Gesichtspunkten bearbeitet.
Ganz offensichtlich wollte Matthäus mit der Darstellung der Generationenfolge ein Argument liefern für die Glaubensüberzeugung der christlichen Gemeinde, dass Jesus, gerade er und kein anderer, der Messias, der eine verheißene Erbe des Thrones Davids sei. Der Evangelist ließ darum den Stammbaum Jesu mit Abraham beginnen, einem wirklichen „Heroen“ in der Geschichte Israels, um zu zeigen, dass die mit dem Stammvater anhebende Generationenfolge der Verheißungsträger eindeutig in der Geburt Jesu ihren End- und Zielpunkt erreicht. Jahwe selbst hat bewusst planend und zielstrebig handelnd in die Abfolge der Generationen eingegriffen. Jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch sollte auf diese Weise zu der Erkenntnis gelangen, dass Jesus und nur er der verheißene Messias ist.10
Die Zahlen
Bei seiner Lektüre der Stammbäume in der hebräischen Bibel konnte Matthäus eine interessante Beobachtung machen. Er stellte fest, dass die langen Listen der Nachkommen Adams und Noachs11 sowie der Vorfahren Abrahams12 nicht schematisch einen Namen an den anderen reihen, sondern dass die Stammbäume Noachs und Abrahams jeweils zehn Zeugungen aufweisen. Sollte das purer Zufall sein? Steckte vielleicht eine bestimmte Absicht dahinter? Das Zahlenschema ist auch noch bei anderen Geschlechtsregistern anzutreffen. So finden sich im ersten Chronikbuch 7 mal 10 Nachkommen Judas und Benjamins.13 Dazu muss man wissen, dass Zahlen im Judentum und im gesamten Vorderen Orient einen Symbolwert besaßen. So war die 7 sinnbildlicher Ausdruck für ein geschlossenes, in sich vollkommenes Ganzes. Die Zahl verweist auf die göttliche Struktur irdischer Dinge und Vorgänge.14 Die 10 meint eine beträchtliche Anzahl und steht für eine vollendete, abgeschlossene Reihe. Manchmal bringt sie auch die Vollkommenheit göttlichen Tuns zum Ausdruck.15 Wir dürfen vermuten, dass Matthäus oder zumindest jene, die ihm bei der Abfassung des Evangeliums mit Rat und Tat zur Seite standen, mit der Symbolik der Zahlen vertraut waren.
Matthäus kam zusätzlich zur Zahlensymbolik noch die Eigenheit der hebräischen Sprache zugute. Sie kennt nämlich keine Vokale und keine eigenen Ziffern. Diese Rolle übernehmen die Buchstaben: So besitzt Aleph, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, den Zahlenwert eins; Beth, der zweite, den Zahlenwert zwei und so weiter. Die Konsonanten des Namens David (d – v – d16) haben die Zahlenwerte 4, 6 und wiederum 4. In der Addition (4 + 6 + 4) ergibt das den Zahlenwert 14.
Matthäus fügte im Stammbaum Jesu 3 mal 14 Generationen zusammen. Die 3 galt als Gotteszahl; 3 mal 14 Generationen konnten also auf eine göttliche Fügung und Führung hindeuten, die hier schon durchschimmert. Die 14, das sahen wir schon, verweist auf David. 3 mal 14 Generationen – das bedeutet demnach: Gott ist in der Abfolge der Generationen von Abraham bis zu David und in denen nach David am Werk.17 Matthäus ließ es sich nicht nehmen, mit einem gewissen Stolz ausdrücklich auf seine Zahlkonstruktion hinzuweisen: „Im Ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn Generationen.“18
Die Mütter
Wer den Stammbaum Jesu liest, könnte den Eindruck gewinnen, dass Frauen bei Zeugung und Geburt überhaupt keine oder zumindest eine höchst nebensächliche Rolle spielen. Es werden zwar viele Männer erwähnt, aber nur sehr wenige Frauen – natürlich zuletzt auch Maria, die Mutter Jesu. Man könnte sagen: Das ist typisch für eine patriarchalische Gesellschaftsstruktur, wie sie nun einmal im Alten Orient herrschte.
Aber warum hat Matthäus dann überhaupt Frauen erwähnt? Warum ließ er sie nicht einfach weg? Und warum hat er nicht die Stammmütter Israels erwähnt – Sara, Rebekka, Lea, Rachel –, sondern andere Frauen? Warum gerade Tamar, Rahab und Ruth?
Tamar verkleidete sich als Prostituierte, um von ihrem eigenen Schwiegervater Juda das zu fordern, was ihr nach Recht und Gerechtigkeit zustand19 und was die Zukunft der Familie Judas sichern sollte.20
Rahab war eine Prostituierte.21 Sie hielt die „Kundschafter“ in Jericho versteckt. In der jüdischen Überlieferung gilt sie später als Frau des Josua.
„Die Frau des Urija“ – Batseba, die Mutter des Königs Salomo – war zwar keine Prostituierte, wohl aber eine Ehebrecherin.22 Batseba beging mit David Ehebruch, während ihr Mann Urija an einem Feldzug gegen die Ammoniter teilnahm. Als David erfuhr, dass Batseba schwanger war, schickte er Urija an die vorderste Front, wo er umkommen musste.23
Ruth war eine Moabiterin, also eine Nichtjüdin.24
Ältere Bibelkommentare stellen die vier im Stammbaum Jesu erwähnten Frauen als Sünderinnen dar. In den neueren Kommentaren erfahren sie eine andere Wertung. Jetzt wird vor allem die Freiheit Gottes in seiner Erwählung herausgestellt: Tamar, die auf ungewöhnliche Weise Mutter wird, hat durch ihr eigenwilliges, aber gesetzeskonformes Handeln dazu beigetragen, dass der Träger der Verheißung geboren wird. Ähnliches gilt für Rahab und Ruth, zwei Frauen, die gleichfalls auf außerordentliche Weise in Israels Geschichte gerieten. Rahab wird sowohl im Judentum als auch im Neuen Testament als gerecht und gläubig angesehen,25 weil sie den Gott Israels anerkannte. Ruth wird als Vorbild hingestellt und als Ahnfrau Davids gerühmt.26
Es ist wohl nicht die Absicht des Matthäus, mithilfe dieser Frauen die Erlösungsbedürftigkeit der Welt aufzuzeigen, in die der Messias eintritt. Vielmehr – das will Matthäus vermutlich sagen – sind diese Frauen erwählte Persönlichkeiten, derer Gott sich bedient, um seinen Willen auf ungewöhnliche Weise zum Ziel zu führen. Es gibt ohnehin noch viel Außergewöhnliches im Evangelium zu erzählen.
Darüber hinaus erscheint die Erwähnung der Frauen deswegen bedeutsam, weil sie aus heidnischen Völkern stammen – Tamar gilt als Aramäerin, Rahab ist Kanaanäerin, Ruth Moabiterin. Heidnische Frauen im Stammbaum Jesu weisen voraus auf die Hinwendung des Evangeliums zu allen Völkern. Daran erinnert Matthäus nochmals an anderer Stelle im Kindheitsevangelium, in der Erzählung von den Sterndeutern.
Maria
Das Ende der dritten Generationenfolge des Stammbaums erscheint merkwürdig. Hätte Matthäus das bisher der Aufzählung zugrunde liegende Schema beibehalten (Mann A zeugte Mann B, Mann B zeugte Mann C …), dann müsste es hier heißen: „Jakob aber zeugte Josef, Josef aber zeugte Jesus.“ Stattdessen lesen wir, ziemlich umständlich formuliert: „Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus (der Messias) genannt wird.“27 Im griechischen Urtext steht – wie in der gesamten vorangehenden Liste der Zeugungen – auch hier das Wörtchen „egennäthä“, das in der deutschen Einheitsübersetzung an dieser Stelle mit „geboren“ wiedergegeben wird. Wer der Vater Jesu ist, wird nicht gesagt. Stattdessen steht hier ein merkwürdiges Passivum: „aus ihr (Maria) wurde geboren Jesus.“ Dieses Passiv wird in der Bibel häufig dann verwendet, wenn nicht direkt auf die göttliche Wirksamkeit hingewiesen werden soll. So antwortet Jesus auf die Frage Johannes des Täufers, ob er der erwartete Messias sei: „Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet.“28 Eigentlich sollte man erwarten: „Ich mache Blinde sehend, Lahme gehend und Aussätzige rein.“ Die Absicht der Evangelisten ist klar: Sie wollen mit diesem Passivum behutsam darauf hinweisen, dass Gott selbst es ist, der hier nicht direkt, sondern gleichsam indirekt durch Jesus am Werk ist. Matthäus will hier zurückhaltend und unaufdringlich den Leserinnen und Lesern die Augen für das Geheimnis der Menschwerdung Gottes öffnen. Was hier gewirkt wird, ist nicht das „Erzeugnis“ eines Menschen, sondern es ist eigentlich und letztlich göttlichen Ursprungs.