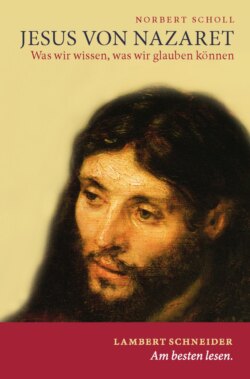Читать книгу Jesus von Nazaret - Norbert Scholl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Israel zur Zeitenwende
ОглавлениеIn der Zeit Jesu unterstand das gesamte Gebiet Israels der Oberaufsicht römischer Statthalter. Diese Herren residierten in Caesarea am Meer und erlegten sich in ihrer Amtsführung gegenüber der Bevölkerung im Allgemeinen Zurückhaltung auf. Nur gelegentlich, vor allem zu den hohen jüdischen Festen, begaben sie sich nach Jerusalem, um möglichen Ausschreitungen sofort begegnen zu können.
Die Juden durften ihre inneren Angelegenheiten weitgehend selbst regeln. Im Jahr 37 vor der Zeitenwende wurde Herodes von der römischen Besatzungsmacht als König von Judäa eingesetzt. Seine Regierungszeit zeichnete sich durch eine glanzvolle Bautätigkeit aus. Er gründete eine Reihe neuer Städte. In Jerusalem ließ er die Burg Antonia und den Königspalast errichten und begann eine großzügige Erneuerung des Tempels. Es ist nicht verwunderlich, dass er wegen der durch seine Bautätigkeit bedingten hohen Steuern beim Volk unbeliebt war.1
Die höchste gesetzgebende und richterliche Gewalt in Judäa besaßen der Hohepriester und das von ihm präsidierte Synedrium (= Hoher Rat) mit seinen 70 Mitgliedern. Nur die Vollstreckung von Todesurteilen hatten sich die Römer vorbehalten.
Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse waren ähnlich wie in den anderen Gebieten rund ums Mittelmeer. Es gab zwei Bevölkerungsschichten: Eine reiche Oberschicht von Großgrundbesitzern, Senatoren, Rittern und „Freien“, insgesamt etwa ein bis fünf Prozent der Bevölkerung, übte die Macht aus. Die politisch machtlose Unterschicht bestand aus Kleinbauern, Sklaven, Handwerkern, Kaufleuten, Lehrern, Tagelöhnern.
Nach dem Tod des Herodes und der danach folgenden, nahezu vollständigen Einstellung der Bautätigkeit gab es eine große Zahl von Arbeitslosen. Allein in Jerusalem wurden nach Beendigung der Bauarbeiten am Tempel im Jahr 10 nach der Zeitenwende Notstandsarbeiten für 18 000 Arbeitslose ausgeschrieben.
Das Land gehörte meist einigen wenigen Großgrundbesitzern, die ihre Untertanen skrupellos ausbeuteten. Den spärlichen Lebensunterhalt verdiente sich das Volk durch Landwirtschaft, Handwerk und Kleinhandel. Das karge Gebiet von Judäa ermöglichte nur eine bescheidene Vieh- und Weidewirtschaft.
Manche Berufe waren verachtet – vor allem der der Zollpächter. Sie standen im Dienst der römischen Besatzer. Häufig benutzten sie ihre Stellung zu persönlicher Bereicherung, indem sie die von den Römern festgelegten Zolltarife eigenmächtig heraufsetzten und die Mehreinnahmen für sich behielten.
Es gab eine Vielzahl religiöser Gruppierungen. Zu den wichtigsten zählten Sadduzäer, Samaritaner, Pharisäer und Zeloten.
Die Bezeichnung Sadduzäer rührt wohl von Sadok her, der zunächst unter David, später unter Salomo vornehmster Priester in Jerusalem war. Die Sadokiden verstanden es, ihre kultische Funktion immer mehr mit einer politischen Führungsrolle zu verbinden. Auch unter Herodes besaßen die Sadduzäer einen starken Einfluss. Ihre Anhänger fanden sich in Kreisen des Jerusalemer Adels und der Priesterfamilien. Sie vertraten eine eher konservative Richtung des Judentums und sahen ihre Hauptaufgabe im Bewahren der überkommenen Tradition. Ihre religiöse Bedeutung war gering. Weit stärkeren Einfluss übten sie im Hohen Rat aus, in dem sie durch eine kleine, aber rührige Gruppe vertreten waren.
Eine weitere Gruppierung waren die Samaritaner. Wahrscheinlich haben Rivalitäten innerhalb der sadokidischen Priesterschaft im 3. Jahrhundert v. Chr. zur Abwanderung einiger Priester und ihrer Familien geführt. Sie ließen sich auf dem Berg Gerisim nieder. Dieser Berg liegt südlich der von Herodes prunkvoll ausgebauten Provinzhauptstadt Samaria. Heute heißt der Ort Nablus. Dort erbauten die Samaritaner einen eigenen Tempel. Separatistische Tendenzen führten zum Bruch mit Jerusalem. Die Samaritaner galten seitdem als Heiden und ihr Kult als illegitim. Die Bezeichnung „Samaritaner“ wurde als Schimpfwort verwendet.
Eine besondere Rolle spielt in den Evangelien die Auseinandersetzung Jesu mit den „Schriftgelehrten und Pharisäern“. Die Pharisäer bildeten eine etwa 6000 Mitglieder umfassende Volksbewegung, die am Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. entstanden ist. Sie verstanden sich als Oppositionsbewegung gegen den selbstherrlichen Führungsanspruch und den ausufernden Klerikalismus der herrschenden Sadduzäer-Klasse und rekrutierten ihre Anhänger aus der breiten Masse des Volkes. Ihre religiöse Leistung bestand darin, die Ausrichtung des Judentums auf den Tempel durch striktes Einhalten des mosaischen Gesetzes im Alltag zu überwinden. Die Loslösung von Tempeldienst und Priesterschaft bedeutete gleichzeitig eine Betonung des Einzelnen und seiner individuellen Frömmigkeitspraxis. Wir wissen heute aus zahlreichen zeitgenössischen jüdischen Quellen, dass Jesus diesem Bemühen weitgehend positiv gegenüberstand. So vertrat er mit den Forderungen der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit Positionen, die auch in der Schule des Pharisäers Rabbi Hillel gelehrt wurden. In der christlichen Schriftauslegung beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die in den Evangelien geschilderten Reden und Weherufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten in dieser Form kaum auf Jesus zurückgehen dürften. Sie sind eher zu verstehen als eine Mahn- und Warnrede an christliche Schriftgelehrte in der Zeit der Evangelisten. Die häufig zitierte Feindschaft der Pharisäer gegen Jesus ist wohl eher ein Produkt frühchristlicher Polemik.
Schließlich ist noch die Gruppe der Zeloten (griech. = Eiferer) zu erwähnen. Diese waren besonders in Galiläa verbreitet. Sie hatten sich dem bewaffneten Widerstand gegen die römischen Besatzer verschrieben. Wie zeitgenössischen Quellen zu entnehmen ist, traten manche Führer solcher Aufstände mit messianischen Ansprüchen auf. Jüdischen Realpolitikern und natürlich insbesondere der römischen Besatzungsmacht galten sie als lästige und gefährliche Unruhestifter, die so rasch wie möglich zu beseitigen waren, falls man ihrer habhaft wurde.