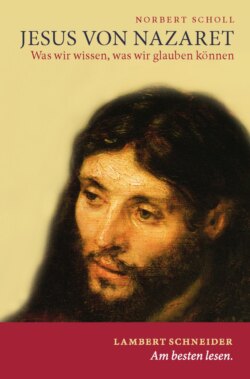Читать книгу Jesus von Nazaret - Norbert Scholl - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anfang der Jesusgeschichte nach dem Johannesevangelium
Оглавление1 Im Anfang war das Wort, / und das Wort war bei Gott, / und das Wort war Gott.
2 Im Anfang war es bei Gott
3 Alles ist durch das Wort geworden, / und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.
4 In ihm war das Leben, / und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, / und die Finsternis hat es nicht erfasst. […]
9 Das wahre Licht, das jeden erleuchtet, / kam in die Welt.
10 Er war in der Welt, / und die Welt ist durch ihn geworden, / aber die Welt erkannte ihn nicht […]
11 Er kam in sein Eigentum, / aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, / allen, die an seinen Namen glauben,
13 die nicht aus dem Blut, / nicht aus dem Willen des Fleisches, / nicht aus dem Willen des Mannes, / sondern aus Gott geboren sind
14 Und das Wort ist Fleisch geworden / und hat unter uns gewohnt, / und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, / die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, / voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1–18; hier: 1,1–5.9–14)
Jetzt geraten wir in eine ganz andere Welt. Der Prolog zum Johannesevangelium unterscheidet sich grundlegend von den Kindheitsevangelien nach Matthäus und Lukas. Während diese ihre theologische und christologische Botschaft in eine anschauliche Erzählung kleiden, setzt Johannes sofort höchst spekulativ und wenig anschaulich an. Die Evangelien nach Matthäus und Lukas begannen ihre Vorgeschichte Jesu „ganz unten“. Der Evangelist Johannes beginnt seine Vorgeschichte „ganz oben“.
An den Beginn seines Evangeliums stellt Johannes einen rätselhaften Satz: „Im Anfang war das Wort“. „Wort“ steht hier in der deutschen Übersetzung für das griechische „logos“. Dieses Wort kennen wir aus den Begriffen Theo-logie, Geo-logie, Bio-logie. Darunter verstehen wir die wissenschaftliche, systematische Lehre von Gott, von der Erde, vom Leben.
Darüber hinaus war „Logos“ nach der Lehre griechischer Philosophen eine Umschreibung für jene Kraft, die alle Wesen dieser Welt bestimmt und die ihnen Gestalt und Bewegung verleiht. Durch den Logos, so sagten sie, habe Gott die Welt gegründet. In dieser Kraft und durch diese Kraft ist alles geschaffen.
Auch im Judentum zur Zeit des Evangelisten Johannes hatte man diesen Begriff übernommen. Der jüdische Philosoph und Theologe Philon (ca. 25 v. Chr. bis 50 n. Chr.) setzte nämlich die göttliche „Weisheit“, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments begegnet, mit dem „Logos“ der griechischen Philosophie gleich. Er verstand den „Logos“ als ein Zwischenwesen, durch das der jenseitige, geistige Gott mit der diesseitigen, materiellen Welt in Verbindung tritt. Der „Logos“, so meinte er, ist nicht Gott, sondern (nur) „Sohn Gottes“, sein „erstgeborener Sohn“. Durch den „Logos“ offenbart sich Gott.
Weil Johannes ein Evangelium auch für gebildete Juden und Griechen schreiben wollte, ist anzunehmen, dass er an den Anfang seiner Schrift diesen lapidaren Satz stellte, der die Gedanken jüdischer und hellenistischer Philosophen aufgreift und sie im Hinblick auf das Jesusgeschehen transparent macht. Johannes will seine Adressaten nicht mit etwas völlig Neuem überfallen, sondern ihnen zeigen, dass „sein“ Jesus, den er ihnen verkünden will, genau jener „Logos“ ist, den ihre Philosophen und Theologen schon verschwommen und verschleiert erahnt haben: „Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott.“
Einige Zeilen später erwähnt Johannes diesen Logos ein zweites Mal: „Und der Logos (das Wort) ist Fleisch geworden.“ Damit tut sich ein gewaltiger Kontrast auf: geistiger Logos – materielles Fleisch! Der Logos, die schöpferische, weltordnende Kraft und Weisheit Gottes, soll Fleisch geworden sein und „unter uns gewohnt“ haben! Hier wird in drastischer Weise die eigentlich unüberwindliche Grenze zwischen Göttlichem und Menschlichem durchbrochen. Denn wenn es etwas gibt, womit die Gottheiten des Alten Orient und auch Jahwe, der Gott des Alten Bundes, überhaupt nichts zu tun hatten, von dem sie scharf abgesetzt wurden, dann war es das „Fleisch“, der Inbegriff der Hinfälligkeit und Sterblichkeit.
Wir können nur Vermutungen anstellen, was den Evangelisten bewegt haben mag, hier dieses ominöse Wort „Fleisch“ zu verwenden. Er hätte ja auch schreiben können: „Der Logos ist Mensch geworden.“ Das hätte viel harmloser geklungen. Selbst die Kirchenväter, 300 Jahre später, waren vorsichtiger. Im Nizäno-Konstantinopolitanischen Credo gingen sie weniger krass zu Werke. Dort heißt es: „Er (Christus) hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist […] und ist Mensch geworden.“ Das sieht fast so aus, als wollten die Bischöfe den Evangelisten korrigieren: Jesus hat das Fleisch nur angenommen, er ist nicht wirklich „Fleisch geworden“.
Warum formulierte Johannes so krass? Vielleicht wollte er mit diesem auf viele Leserinnen und Leser sicher höchst anstößig wirkenden Wort den auch in seiner Gemeinde kursierenden Spekulationen entgegentreten, nach denen Jesus nur einen Scheinleib gehabt habe und in Wirklichkeit gar nicht wahrhaft ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen sei.
Es könnte aber auch sein, dass Johannes darüber hinaus einige seiner weiter blickenden Leserinnen und Leser nachdenklich stimmen und in ihnen das Gespür dafür wecken wollte, dass der Gott des Anfangs, der Schöpfer, in allen Dingen seiner Schöpfung gegenwärtig und erfahrbar ist, also auch im „Fleisch“, in der Materie. Auch in der glitzernden Pracht und in der unendlichen Weite des nächtlichen Sternenhimmels ist etwas von der ordnenden Macht der göttlichen Weisheit, des „Logos“, zu erahnen. Ebenso offenbart sich in der farbigen Vielfalt edler Steine, im knorzigen Urwuchs alter Bäume, im andächtig geöffneten, glühend roten Blütenkelch des Klatschmohns, im grazilen Körperbau und der bewundernswerten Leichtfüßigkeit der Gazelle etwas göttlich Großes und Schönes. Ist „nur“ der Mensch Ebenbild Gottes, sind es nicht auch die unendlich vielen anderen Wesen, wenn auch vielleicht in einer weniger auffälligen und staunenswerten Weise? Gott, vielleicht will das Johannes auch sagen, ist in allen Dingen seiner Schöpfung geheimnisvoll gegenwärtig – in den großen und kleinen Wundern, aber auch in den bedrohlichen und Angst einjagenden Unverständlichkeiten. 1200 Jahre später schreibt der deutsche Mystiker Meister Eckhart: „Jegliche Kreatur ist Gottes voll. […] Wenn sich Gott einen Augenblick von allen Kreaturen abkehrte, so würden sie zunichte.“78 Das Leben Gottes selber entfaltet sich in den Dingen. „Wer weiter nichts als die Kreaturen erkennen würde, der brauchte an keine Predigt zu denken, denn jegliche Kreatur ist Gottes voll und ist ein Buch.“79 „Alle Dinge“ sind für Meister Eckhart „reiner Gott.“80 Es liegt nur am Menschen, dieses innerste Geheimnis der Dinge zu entdecken und ihm gemäß zu leben.
Johannes wollte von der Menschwerdung des Logos künden. Aber er wollte darüber hinaus auch davon künden, dass alle Dinge dieser Welt vom Logos erfüllt sind. Gewiss, zuerst und zutiefst sind es die Menschen und hier wieder in einzigartiger Weise der Mensch Jesus von Nazaret. Vielleicht wählte Johannes deswegen diese Ausdrucksweise, die vieles offenlässt und gleichzeitig vieles einschließt: „Der Logos ist Fleisch geworden.“ Der göttliche Logos ist in seiner „Fleischwerdung“ den Menschen gleichsam „in den Leib gefahren“. Die können nun nicht mehr die Ausrede geltend machen, Gott throne in weiter Ferne „hoch oben überm Sternenzelt“. Der Abstand zwischen Gott und Mensch ist überbrückt. Die „Fleischwerdung“ bedeutet das Eingehen des Schöpfers in seine Schöpfung. Das ist das eigentlich Anstößige an der Menschwerdung des Logos.81
Das Kind in der Krippe und der Fleisch gewordene Logos, die Hirten mit ihren Schafen und das krude „Fleisch“ liegen gar nicht so weit auseinander.