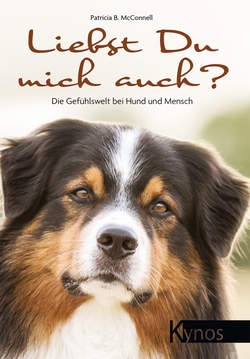Читать книгу Liebst Du mich auch? - Patricia B. McConnell - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»VERMENSCHLICHUNG« IST NICHT IMMER EIN SCHLIMMES WORT
ОглавлениеDie obigen Beispiele illustrieren, warum viele Vermenschlichungen, im Fachbegriff Anthropomorphismen, für gefährlich halten. Anthropomorph bedeutete im griechischen ursprünglich, den Göttern menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Heute wird »Anthropomorphismus« häufig für die vermenschlichende Darstellung von Tieren verwendet. In manchen Kreisen wird diese Vermenschlichung als so große Sünde betrachtet, dass »Anthropomorphismus« schon beinahe ein Schimpfwort ist. Zum Glück ist es ein bisschen zu lang, um als guter Fluch dienen zu können. »Du anthropomorpher Idiot« hat zwar einen gewissen Klang, wird aber sicher niemals eins der beliebten kurzen, knackigen Fluchworte ersetzen.
Mir wurde in den Zoologie- und Psychologiekursen genau wie allen anderen eingeschärft, Anthropomorphismen zu meiden wie die Pest. Aber wie es bei unserer Spezies so oft der Fall ist, wurde etwas eigentlich Vernünftiges ins Extreme übertrieben und viele begannen so zu sprechen, als ob Vergleiche zwischen Menschen und Tieren immer unkorrekt seien. Jede Eigenschaft, die Teil unseres Ich ist, wie zum Beispiel Denken, Planen oder sogar Fühlen, wurde in ihren Augen zu etwas für Tiere Unzulässigem. Obwohl Rationalität und Verstand am häufigsten als einzigartig für unsere Spezies betrachtet werden, ist ein überraschender Mangel an Rationalität feststellbar, wenn man sich die menschlichen Attribute anschaut, die diese Skeptiker anderen Tieren zugeschrieben haben.
Viele von denen, die immer wieder vor den Gefahren der Vermenschlichung warnen, zögern nicht, von »egoistischen« oder »konkurrierenden« Tieren zu sprechen. Es scheint fast so, als würde die Zuschreibung negativer menschlicher Eigenschaften an Tieren selten Kritik auslösen. Tiere können »manipulativ« oder »eigennutzig« sein, aber Gott behüte, Sie sprechen von Tieren als »versöhnlich« oder »liebevoll«. Der Primatologe Frans de Waal wurde rundweg kritisiert, als er erstmals »Versöhnungsverhalten« bei Schimpansen beschrieb – obwohl die Beweise dafür überwältigend waren. Selbst scheinbar neutrale Begriffe lösen bei manchen Wissenschaftlern Unbehagen aus. Die beiden hervorragenden Wissenschaftler Donald Owings und Eugene Morton, deren Arbeit ich insgesamt respektiere, argumentierten kürzlich, es sei falsch, Kommunikation unter Tieren wie zum Beispiel den Gesang der Wale oder das Winseln eines Welpen als »Informationsübermittlung« zu betrachten. Dies sei ein vermenschlichendes Konzept, so ihre Begründung. Stattdessen sollten wir ihrer Meinung nach Kommunikation unter Tieren als Beispiele für »Einschätzung, Manipulation oder Beeinflussung« betrachten. Ich stimme größtenteils mit dem Gedanken überein, dass es in der Kommunikation häufig um den Versuch geht, jemand anderen dazu zu bewegen, zu tun, was man möchte. Aber ich sehe nicht, warum die Begriffe »Manipulation« oder »Beeinflussung« weniger vermenschlichend sein sollten als »Informationsübermittlung«.
Ein weiteres Beispiel für das Zögern, Tieren positive Eigenschaften zuzuschreiben, ereignete sich 1996, als ein drei Jahre alter Junge im Brookfield Zoo von Chicago in das Gorillagehege fiel. Binti Jua, ein acht Jahre altes Gorillamädchen, hob das Kind auf, wiegte es in seinen Armen und reichte es dann vorsichtig einem seiner Pfleger. Die Geschichte schlug landesweit wie eine Bombe in den Medien ein und schon Stunden später interviewte man Experten zu diesem »unglaublichen« Ereignis. Einige der Befragten sagten, es sei dumme Vermenschlichung, Binti Freundlichkeit oder Mitleid zuzuschreiben. Sie habe nur das getan, was ihre Pfleger ihr beigebracht hätten.8 In seinem Buch Der Affe und der Sushi-Meister stellt Frans de Waal heraus, dass wir ähnliche Handlungen eines Menschenkindes niemals als bedeutungslos bezeichnen würden, selbst wenn es ebenfalls von seinen Eltern angewiesen worden sei, freundlich und sorgsam zu sein. Was Binti tat, ist typisch für Gorillas und in keiner Hinsicht ungewöhnlich. Gorillas sind im Allgemeinen ruhige, freundliche Vegetarier, die den größten Teil des Tages damit verbringen, auf wildem Sellerie herumzukauen und die wilde Spielattacken der Jungtiere gutmütig tolerieren. Ganz anders hätte die Sache ausgesehen, wenn der Junge in eine Löwengrube gefallen wäre, eine junge Löwin ihn vorsichtig aufgehoben, ins Maul genommen und zu einem Pfleger gebracht hätte. Kleine Jungs sehen für Löwen wie Abendessen aus, aber für Gorillas sehen sie aus wie … eben kleine Jungs. Das Überraschendste für viele von uns war nicht Bintis Verhalten, sondern der empörte Aufschrei mancher, dass es hoffnungslos romantisch und unwissenschaftlich sei, einem Gorilla so etwas ähnliches wie menschliche Gefühle zuzusprechen.
Aber nicht nur Wissenschaftler scheinen sich wohler damit zu fühlen, Tiere lieber mit negativen als mit positiven Begriffen zu beschreiben. Selbst Hundebesitzer, die ihre Hunde lieben, tun das. Millionen unglücklicher Hunde wurden angeschrieen oder sogar geschlagen, weil wir ihnen so leicht die schlechtesten Eigenschaften unserer eigenen Spezies zuschreiben. Wie schnell wir doch darin sind, unsere schlechtesten Eigenschaften auf Hunde zu übertragen. Überlegen Sie einmal, wie reich Sie wären, wenn Ihnen jemand jedes Mal, wenn er sagen würde »Er macht das nur, um mich zu ärgern!« oder »Er weiß doch, dass er das nicht tun soll!«, einen Dollar zahlen würde. Ja, vielleicht »weiß« Ihr Hund in der Tat, dass er Besucher nicht anspringen soll, aber mal ehrlich, haben Sie noch nie Ihre guten Manieren vergessen, wenn Sie aufgeregt waren und haben Sie noch nie vergessen, was Sie sagen wollten, wenn Sie nervös waren? Was hatte »wissen« damit zu tun, dass Sie beim letzten Weihnachtsessen bei den Eltern Ihres Verlobten Ihre Gabel fallen ließen? Haben Sie das absichtlich gemacht, um Ihren Verlobten zu ärgern? Ich bezweifle das. Warum dann sind wir so schnell dabei, unseren Hunden absichtlichen Ungehorsam zu unterstellen, aber zögern, ihnen Dinge wie Angst oder Verwirrung zuzuerkennen, obwohl genau diese auch unsere eigenen Handlungen beeinflussen?
Vielleicht liegt die Antwort darin, was Psychologen den fundamentalen Attributionsirrtum nennen. Scheinbar neigen wir Menschen zu der Annahme, dass das Benehmen uns unbekannter Individuen eher auf deren Veranlagung beruht als auf äußeren Einflüssen. Am besten wird das von einer erhellenden Studie illustriert, in der Studenten mit einer Frau sprachen, der zuvor gesagt worden war, sie solle entweder freundlich und warmherzig oder kühl und abweisend sind. Der Versuchsleiter, der der Frau die Verhaltensanweisungen gegeben hatte, teilte der Hälfte der Studenten vor dem Gespräch mit, dass sich die Frau auf eine bestimmte Weise verhalten würde. Der anderen Hälfte wurde nichts gesagt, was das Verhalten der Frau irgendwie hätte erklären können. Spannenderweise bewerteten beide Gruppen hinterher die Frau als von Natur aus unfreundlich, obwohl die eine Hälfte der Studenten ja gewusst hatte, dass sie dieses Verhalten nur spielte. Es stellt sich heraus, dass wir alle das genau Gleiche tun und es fast unmöglich ist, das zu vermeiden. Vielleicht kennen Sie Ihre beste Freundin gut genug, um sagen zu können, dass ihre unfreundlichen Bemerkungen einer Verkäuferin gegenüber mit dem schrecklichen Tag zu erklären sind, den sie gerade hinter sich hat, aber wenn Sie das Gleiche bei einer fremden Person sehen, neigen Sie zu der Annahme, dass es sich hier um einen unfreundlichen Menschen handelt. Leider können Hunde uns nicht sagen, dass sie heute einen schlechten Tag hatten oder dass ihnen die Hüftgelenke schmerzen – und nur zu oft unterstellen wir ihnen das Schlechteste.
Natürlich neigen manche Hundebesitzer auch zum anderen Extrem. Erst gestern sprach ich mit einer guten Freundin, die mir gegenüber ihre Überzeugung ausdrückte, Hunde seien die Verkörperung der absoluten Liebe. Ich bin mit ihr einer Meinung, dass Hunde uns eine reine und unkomplizierte Form der Liebe schenken können, aber ich glaube nicht, dass Hunde jeden Augenblick des Tages nichts anderes als Liebe kanalisieren. Die Vorstellung, alles, was ein Hund tue, sei von Liebe und Mitgefühl motiviert, ist genauso falsch wie das entgegengesetzte Extrem. Ich hatte einmal eine Kundin, die mir erklärte, die Narben auf ihren Armen seien »Liebesbisse« ihres fünfunddreißig Kilo schweren Labradors. Nachdem ich gesehen hatte, wie dieser Hund die Individualdistanz seiner Besitzerin missachtete, ihr vor die Füße lief, wenn sie durchs Zimmer ging, sich förmlich in ihr Gesicht warf und wiederholt in ihren Arm biss, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, war meine Interpretation der Dinge eine etwas andere.
Wie dem auch sei, das Beste für unsere Hunde ist, einen gesunden Mittelweg dazwischen zu finden, ihnen alle »menschlichen« Eigenschaften abzusprechen oder alle unsere schönsten Traumvorstellungen und schlimmsten Ängste auf sie zu projizieren. Mir kommt es so vor, als ob die Frage, welche geistigen Eigenschaften wir mit Hunden gemeinsam haben, ein typischer Fall von »Ist das Glas halb voll oder halb leer?« sei. Natürlich unterscheidet sich unsere subjektive Erfahrung der Welt grundlegend von der unserer Hunde, aber wir haben so viel mit ihnen gemeinsam, dass es unwissenschaftlich wäre, das zu ignorieren. Das Glas mag zwar halb leer sein, aber es ist ein großes Glas und es ist so viel Flüssigkeit darin, dass man sie nicht übersehen kann.
Eine ständig wachsende Zahl an Wissenschaftlern betrachtet das Glas als halb voll und vertritt die Meinung, dass Anthropomorphismus nicht immer etwas Schlechtes ist. Wovon sonst, so argumentieren sie, sollten wir ausgehen, wenn nicht von unseren eigenen Erfahrungen? Wenn Tiere ähnlich organisierte Gehirne haben wie wir, eine ähnliche Physiologie und ähnliches Verhalten, dann ist es natürlich vernünftig, zu mutmaßen, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch ähnliches erfahren und erleben wie wir. Was wir brauchen, ist eine ausgewogene Sicht der Dinge, in der wir es vermeiden, Tiere als sprachlose, bepelzte Versionen von Menschen zu betrachten, sondern alles dafür tun, zu verstehen, wie unser eigenes Erleben sich mit dem von Tieren vergleichen lässt. Noch vor nicht allzu langer Zeit widersprach dem ein Wissenschaftler namens Jacques Vauclair und sagte: »Zum Glück ist es nicht das Hauptziel der wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf den Verstand von Tieren, herauszufinden, wie es ist, eine bestimmte Tierart zu sein, sondern vielmehr, zu erklären, wie geistige Zustände beobachtbares Verhalten verursachen.« Als aber die Teilnehmer der jährlichen Konferenz der »Animal Behavior Society« gefragt wurden, warum sie damals mit dem Studium von Tierverhalten begonnen hätten, antworteten sie, ihre Hauptmotivation sei es gewesen, die Welt durch die Augen von Tieren sehen zu können. Genau dieser Wunsch hat Tausende Wissenschaftler dazu inspiriert, für wenig Geld außergewöhnlich hart zu arbeiten, und zwar meistens in Schlamm, Regen oder tropischer Hitze – nur, um ihr Wissen um das Universum zu erweitern. Entsprechend sollten auch wir Hundefreunde uns nicht dafür entschuldigen, dass wir wissen möchten, wie es wäre, ein Hund zu sein. Sich vorzustellen zu wollen, wie das Leben aus der Perspektive eines anderen Tieres aussehen könnte, ist möglicherweise eine Fähigkeit, zu der tatsächlich nur Menschen in der Lage sind – warum sollten wir uns dafür schämen? Natürlich werden wir niemals bis in Letzte hinein erfahren, wie es ist, ein Hund, ein Warzenschwein oder ein Grashüpfer zu sein. Wir werden auch niemals wirklich wissen, wie es ist, ein anderer Mensch zu sein – aber das sollte uns nicht davon abhalten, es weiterhin zu versuchen.
Niemand wird bezweifeln, dass Tammy Ogles Hunde ihre Besitzerin vor dem knappen Tod bewahrt hatten. Die Geschichte war so überwältigend, dass die Tierärztevereinigung von Wisconsin die Hunde in ihre »Hero Hall of Fame 2004« aufnahm. Meine eigene Interpretation der Geschehnisse ist, dass Double, Lily und Golly sich sehr wohl bewusst waren, dass ihre Besitzerin schwer verletzt war und in gewisser Weise auch wussten, dass sie Hilfe brauchte. Ohne übermäßig romantisch zu sein, erscheint mir diese Erklärung schlicht die einfachste. Wissenschaft kann zwar sehr kompliziert werden, aber alle angehenden Wissenschaftler lernen, dass immer dann, wenn man keinen sicheren Beweis hat, die einfachste Erklärung die beste ist. Es erscheint wesentlich komplizierter, wenn nicht sogar weit hergeholt, sich eine Welt vorzustellen, in der Ogles Hunde reflexartig auf äußere Ereignisse reagierten und keine Vorstellung von ihren Verletzungen hatten. Als hoch soziale Tiere sind Hunde eine der wenigen Spezies, deren Individuen ihr Leben aufs Spiel setzen, um ein Rudelmitglied zu retten.9Sie sind Beutegreifer, die gemeinschaftlich jagen, deshalb ist Zusammenarbeit Teil ihres biologischen Aufbaus. Sie haben sich zu Problem- lösern, Teamspielern und besorgten, liebevollen Eltern entwickelt, die sich um bedürftige Rudelmitglieder kümmern. Es ist deshalb keine dumme Romantik, anzunehmen,: dass Tammys Hunde ihrer Besitzerin helfen wollten. Es ist gute, pure Biologie.
Dumm wäre allerdings die Vorstellung, Tammys Hunde hätten eine eingehende Analyse des Problems betrieben und ihre Gehirne hätten genauso funktioniert, wie unsere das in dieser Situation getan hätten. Meine eigene Meinung ist, dass die beiden zu Beginn dieses Kapitels vorgestellten Erklärungen etwas für sich haben, vermute allerdings, dass die Wahrheit eher näher an der ersten Erklärungsmöglichkeit als an der letzten zu suchen ist. Dass mir die Version von der selbstlosen Nächstenliebe gefühlsmäßig besser gefällt, heißt noch nicht, dass sie falsch sein muss. Die Tatsache, dass die Geschichte von Tammy und ihren Hunden in uns warme Gefühle auslöst und unsere Herzen dahinschmelzen lässt, bedeutet keinesfalls, dass unsere Deutung gegen die Regeln der Wissenschaft verstößt. Nur, weil eine Erklärung sich für uns gut anfühlt, heißt das nicht, dass sie nicht stimmen kann. Es ist ein dummer Fehlglaube, dass das Gefühl der Feind des Verstandes sei, wie wir noch später im Buch sehen werden. Ich jedenfalls werde auch weiterhin glauben, dass Tammys Hunde wussten, dass ihre Besitzerin Hilfe brauchte – weil das eine vernünftige Erklärung für ihr Verhalten ist und weil ich erlebt habe, wie mein eigener Hund Luke, der Grund für dieses Buch war, sein Leben riskierte, um meins zu schützen.
Ich werde nie erfahren, was genau er dachte, als er damals unaufgefordert über eine hohe Holzwand kletterte, um mich vor einem wild gewordenen, gehörnten Schaf zu retten, das mir offenbar nach dem Leben trachtete. Aber er hatte lange genug mit Schafen zu tun, um zu wissen, dass er selbst schwere Verletzungen riskierte. Ich weiß, dass er aus eigener Initiative über diese Abzäunung sprang, ohne, dass ich ein Wort gesagt hatte. Er hat dies nie vorher und nie nachher jemals wieder getan. Er attackierte das Schaf gerade lange genug, dass ich mich aus dem Gatter in Sicherheit bringen konnte und schoss dann gleich hinter mir heraus. Und ich weiß, dass wir zwei Freunde waren, als wir dann beide nach Luft schnappend, blutend, erschöpft und aufgeregt nach dem überstandenen Abenteuer auf dem Scheunenboden lagen. Wir mögen zwar Angehörige verschiedener Spezies sein, aber was wir miteinander teilen – was Tammy und ihre Hunde teilen und was so viele von uns mit ihren Hunden teilen – ist sicherlich größer als das, was uns voneinander unterscheidet.