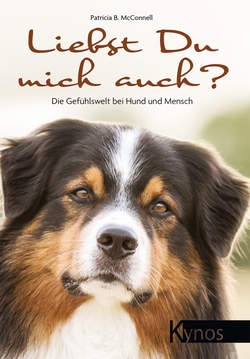Читать книгу Liebst Du mich auch? - Patricia B. McConnell - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINLEITUNG
ОглавлениеTulip rannte mir voraus, als wir uns dem toten Körper eines Schafes namens Harriet näherten, und beschnüffelte ihn vom Kopf bis zu den Klauen. Harriets Tod war ein bedeutendes Ereignis auf meiner kleinen Farm. Bis zum Ende, selbst im hohen Alter von vierzehn, war Harriet ein bemerkenswertes Individuum gewesen. In ihrer Jugend hatten ihr zierlicher Körperbau und ihre karamellfarbene Wolle sie für den Supermodel-Status qualifiziert. Im Alter war sie kaum noch mehr als ein klappriges Knochengerüst, aber selbst als wir sie über eine Pipette mit Flüssignahrung fütterten, schaffte sie es, einen Ausdruck von Würde beizubehalten, der Schafen, Menschen und Hunden gleichermaßen Respekt abverlangte. Ich hing mehr an Harriet, als ich je zuvor an einem meiner Schafe gehangen hatte, und hatte bereits wie ein Baby geweint, als Tulip und ich gingen, um ihrem kalt und steif im Gras liegenden Körper einen letzten Besuch abzustatten.
Tulip, meine die Schafe bewachende Pyrenäenberghündin, war nicht im Stall gewesen, als der Tierarzt Harriet eingeschläfert hatte. Ich hatte sie ins Haus gebracht, damit der Tierarzt seine Arbeit ungestört verrichten konnte. Tulips Aufgabe ist es, die Schafe vor den Kojoten und streunenden Hunden zu beschützen, die sich überall im ländlichen Wisconsin umhertreiben. Tulips Liebe zur Gewalt- losigkeit ist beeindruckend, aber man kann darauf zählen, dass sie ihre Schafe beschützen wird, wenn diese sie brauchen. Die normalerweise sanftmütige Tulip kann sich in einer Mikrosekunde von einem freundlichen Kindermädchen zum Kriegshund Xena verwandeln. In den zehn Jahren ihres Herdenschutzdienstes auf meiner Farm hat sie noch nie einen Menschen, einen Hund oder ein Schaf verletzt, aber sie ging dazwischen wie eine Furie, als mich einmal ein hundertdreißig Kilo schwerer Widder angriff, als einmal ein fremder Hund einen meiner Hunde attackierte oder als ein dummer Border Collie in seinem jugendlichen Übermut einmal vom Schafehüten zum Schafejagen überging. Weil sie außerdem verspielt und neugierig ist, erschien es mir klüger, den Tierarzt seine Arbeit ohne sie tun zu lassen. Tulip hatte also nicht gesehen, wie Harriet vom Leben zum Tod wechselte, und als sie ihren Körper im Gras liegen fand, schien sie zutiefst betroffen zu sein.
Sie roch daran, umkreiste ihn schnüffelnd und stieß ihn immer wieder mit der Nase an. Nach ein paar Minuten legte sie sich neben das tote Schaf. Sie legte ihren großen, weißen Kopf auf ihre Pfoten, seufzte einmal – ein langes, langsames Ausatmen, das wir beim Menschen als Zeichen für Resignation deuten würden – und weigerte sich dann, sich weiter zu bewegen. Als meine Border Collies sich näherten, knurrte sie sie an, woraufhin diese sich zurückzogen und herkamen, um sich in angemessener Entfernung zu mir zu setzen. Ich weiß nicht mehr, wie lange Tulip neben Harriet lag, aber freiwillig wollte sie von ihr nicht fort. Als dann schließlich die Dämmerung den Himmel weicher machte, nahm ich sie sanft beim Halsband und führte sie zurück ins Haus.
Tulip sah ganz genauso aus, als wüsste sie, dass Harriet gestorben war und sie wirkte genauso traurig, wie ich mich fühlte. Es gibt nur einen Haken: Sie benimmt sich ganz ähnlich gegenüber den Tauben, die sie selbst gerissen hat. Und letzte Woche benahm sie sich so gegenüber einem Maiskolben, den ich ihr zum Kauen gegeben hatte. Während meine drei Border Collies fröhlich an ihren Maiskolben nagten und ihnen der milchige Saft das Kinn herablief, trug Tulip ihren mit großer Gravität zu ihrem Lieblingsplatz, legte ihn sanft und vorsichtig zwischen ihre Pfoten und bewachte ihn von allen Seiten. Sie knabberte nicht daran. Sie leckte nicht daran. Sie lag daneben, das Gesicht ruhig und bedeutungsvoll, genauso, wie sie an jenem traurigen Morgen auf Redstart Farm neben der toten Harriet gelegen hatte.
Ich würde mir nur zu sehr wünschen, dass Tulips Verhalten gegenüber Harriet der Ausdruck von etwas Bedeutungsvollerem war als der ihres Umgangs mit einem Maiskolben. Ein respektvolles Bewusstsein von Harriets Leben passt zu meinem Bild davon, wer Tulip ist – oder vielmehr davon, wie ich sie gerne hätte. Vielleicht hat es etwas zu bedeuten, dass Tulips Verhalten gegenüber Harriet nicht ganz genau identisch war mit dem, was sie gegenüber toten Tauben oder Maiskolben zeigte. Sie hatte nie ihren Kopf auf die Pfoten gelegt, wie sie es bei Harriet getan hatte, und sie hatte nie einen tiefen, langen Seufzer ausgestoßen, wenn sie sich vor eine tote Taube gestellt hatte. Ich kann kaum glauben, dass mein großäugiger, seelenvoller Hund auf Harriets toten Körper hin die gleiche Reaktion gezeigt haben sollte wie auf ein Stück Gemüse.
Die nackte Wahrheit aber ist, dass ich keine Ahnung habe, was in Tulips Kopf vorging, als sie sich neben die tote Harriet legte. Wusste sie, dass Harriet tot war und was das für die Zukunft bedeutete? Ich wüsste nur zu gern, was sie an diesem ruhigen Sommerabend nach Harriets Tod dachte, aber wie kann ich eine Möglichkeit finden, in ihren Kopf zu schauen? Was kann überhaupt irgendjemand von uns über das Gefühlsleben von Hunden wissen? Es ist ja schon schwierig genug, herauszufinden, was im Kopf eines anderen Menschen vorgeht, wie viel weniger kann das dann bei einem Wesen einer anderen Art gelingen.
Wir möchten es aber gerne wissen. Zu verstehen, was ein anderer gerade erlebt, ist der Schlüssel zum Gefühl der Verbundenheit, und Verbundenheitsgefühl ist ein integraler Bestandteil jeder guten Beziehung. »Könnte ich nur deine Gedanken lesen« ist mehr als ein altmodischer Ausspruch – es ist der Ausdruck unseres Wunsches, die Gedanken und Gefühle derjenigen zu verstehen, die wir lieben. Wir Menschen sind soziale Lebewesen, unser Wunsch nach Verbundenheit ist tief und drängend.
Diejenigen von uns, die ihre Hunde zutiefst lieben und sie als ihre Freunde und Familie betrachten, möchten wissen, was in ihrem Kopf vorgeht – genauso, wie wir das von Menschen wissen möchten, die uns etwas bedeuten. Wir müssen uns Hunde nicht als bepelzte kleine Menschen vorstellen, um verstehen zu wollen, wie ihr Gefühlsleben im Vergleich zu unserem aussieht. Ich, genau wie viele andere, möchte nichts mit sprachlosen, unordentlichen Menschen zu tun haben, die auf vier Beinen laufen und sich in Kuhfladen wälzen. Wir mögen es, dass unsere Hunde Hunde sind. Die Unterschiede zwischen uns bereichern unsere Beziehungen und verstärken unser Gefühl der Verbundenheit mit der Welt um uns herum. Aber der genetische Graben zwischen uns macht es noch schwieriger, zu erfahren, was unsere Hunde denken und fühlen, als es das bei unseren menschlichen Freunden ist. Kein Wunder, dass Tierkommunikatoren, die für sich beanspruchen, Zugang zu den Gedanken unserer Haustiere zu haben, so beliebt geworden sind.
Manchmal knüpfen wir auch ohne die Hilfe gesprochener Sprache tiefgehende Verbindungen zu den Hunden in unserem Leben. Zu anderen Zeiten läuft – wie in jeder Beziehung – vielleicht nicht alles so gut. Ich werde nie diesen Hund vergessen – einen von denen mit diesem ganz durchdringenden Blick – der einfach aufhörte, seinen Besitzer anzusehen. Ich beobachtete die beiden auf einem Hütehundkurs mehrere Stunden lang: Eine kleine, grauhaarige Frau mit einem schmucken, schwarz-weißen Border Collie an einer leuchtend roten Leine. Der Hund schaute überall hin, nur nicht zu der Frau, die ihn liebte. Er saß sogar fast eine ganze Stunde lang ruhig an ihrer Seite, aber mit dem Kopf um hundertachtzig Grad weggedreht.
Die Frau, die diesen Hund besaß und liebte, hatte die besten Absichten, aber ihre Worte und Bewegungen waren so verwirrend, dass selbst ich keine Ahnung hatte, was sie mitzuteilen versuchte. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wozu sie ihren Hund bringen wollte, und schon gar nicht davon, was sie dachte. Ich nehme an, dass dieser schlaue, willige kleine Hund seine Besitzerin so frustrierend fand, dass er es nicht mehr ertragen konnte, weitere Verständigungsversuche zu unternehmen und deshalb beschloss, jeder Kontaktaufnahme gleich ganz aus dem Weg zu gehen. Es erinnerte mich daran, wie ich schon so manches Mal das Autoradio ausgeschaltet habe, weil der Empfang so schlecht und das Rauschen so laut war, dass ich das Zuhören nicht mehr ertrug.
Die unpassende Konstellation ging mir so ans Herz, dass ich die Dame am Ende des Tages fragte, ob ich ihren Hund kaufen könnte. Ich war nicht überrascht, als sie nein sagte, denn sie schien ihren Hund sehr zu lieben. Man kann ja auch nicht unbedingt geradewegs auf einen Fremden zugehen, ihm mitteilen, dass er unabsichtlich seinen Hund quält und dann erwarten, dass er einem dankt und die Leine überreicht. Aber ich kann immer noch das liebe, ehrliche Gesicht dieser Hündin vor mir sehen und frage mich, ob sie wohl noch lebt, ob sie immer noch in den Himmel schaut und versucht, das Rauschen so gut es geht abzustellen.
Den meisten von uns gelingt es besser als der oben beschriebenen Frau, die Lücke zwischen unserem Geist und dem unserer Hunde zu schließen, aber das heißt nicht, dass es einfach wäre. Wir meinen vielleicht zu wissen, was unser Hund denkt, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch stimmt. Wir meinen, sicher zu wissen, was in Herz und Verstand unserer Mutter, unseres Sohnes oder unseres Partners vorgeht, aber in Wahrheit liegen wir oft daneben. Psychologen sagen, dass irrtümliche Annahmen darüber, was andere denken und fühlen, endlose Probleme im Zusammensein von Menschen verursachen. Die Hälfte der Zeit wissen wir noch nicht einmal, was in unserem eigenen Verstand vorgeht. Wie wir später noch sehen werden, wird ein großer Teil unseres Verhaltens von Vorgängen beeinflusst, die außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung liegen. Kein Wunder, dass es eine echte Herausforderung ist, die Gedanken hinter einer Hundestirn zu erraten.
Aber auch wenn es schwierig ist, in einen Hundekopf zu schauen, so sind wir doch nicht ganz ohne Anhaltspunkte. Wir machen zum Beispiel riesige Fortschritte darin, zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wir sprechen zwar gerne vom Herzen als dem Sitz der Gefühle, aber es ist das Gehirn, das im Zentrum unserer Gefühle liegt. Wenn wir unsere Gefühle verstehen möchten, müssen wir damit anfangen, unser Gehirn verstehen zu lernen. Unser Gefühlsleben beginnt und endet in unserem Gehirn, und je besser wir verstehen, wie dieser unglaubliche Mix aus Neuronen, Hormonen und Elektrizität funktioniert, umso besser werden wir auch unsere Gefühle verstehen. In diesem Moment arbeiten ganze Heerscharen von Forschern am Thema Gehirn und reiten auf einer riesigen Welle wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses am Verstand und an dessen Funktion. Ein Großteil dieses Interesses und dieser Aufmerksamkeit wurde von den aufregenden neuen Technologien angeregt, die es uns ermöglichen, dem Gehirn bei der Arbeit zuzusehen. Eine der nützlichsten neuen Technologien, die fMRT, macht für uns sichtbar, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind, während es arbeitet1.
Man kann Menschen Bilder zeigen, ihnen Fragen stellen oder ihnen Hormone spritzen und dann schauen, welche ihrer Gehirnbereiche aktiv sind, während sie nachdenken oder die Dinge verarbeiten. Solche Studien haben uns zum Beispiel gelehrt, dass die meisten Menschen einen besonders gut entwickelten Gehirnbereich zur Wiedererkennung von Gesichtern haben, während der Bereich, der für die Wiedererkennung von Gegenständen zuständig ist, schwächer entwickelt ist. Autisten hingegen nutzen den Gegenstands-Erkennungsbereich, wenn sie Gesichter anschauen – kein Wunder, dass es ihnen so schwer fällt, Gefühlsregungen in Gesichtern zu erkennen.
Die Neurowissenschaft mag spannend sein, aber sie ist nichts für Leute mit schwachem Herz (und natürlich auch nicht für solche mit schwachem Verstand). Gehirne sind absurd komplizierte Gebilde und es ist eine Riesenherausforderung, zu verstehen, welche Rolle sie in unserem Gefühlsleben spielen. Genauso, wie die zur Beschreibung von Struktur und Funktion des Gehirns verwendete Sprache … na ja, sagen wir mal hoch entwickelt ist. In seinem wunderbaren Buch Das menschliche Gehirn. Eine Gebrauchsanweisung sagt John J. Ratey, dass das zweitkomplexeste Gebilde im Universum nach dem Gehirn die Sprache ist, in der wir über das Gehirn sprechen. Wie wahr! Ich habe an dieser Stelle des Buches vor Lachen gebrüllt, hatte ich doch gerade kurz zuvor den entmutigenden Prozess begonnen, mich durch Artikel zu Themen wie beispielsweise zur Bedeutung des anterioren Gyrus cinguli für die Pathogenese ideomotorischer Apraxie zu kämpfen.
Glücklicherweise schreiben immer mehr Neurowissenschaftler Bücher für diejenigen von uns, die nicht vom Fach sind, aber etwas darüber wissen möchten, wie das Gehirn unser Verhalten beeinflusst. Wenn es Sie interessiert, warum Sie mit der Absicht zum Kauf eines Beaglewelpen aus dem Haus gegangen, aber mit einem Jack Russell Terrier wiedergekommen sind oder warum Sie immer noch um Ihren Golden Retriever weinen, der vor zehn Jahren starb, können solche Bücher Ihnen helfen, den Graben zwischen den zwar dualen, aber miteinander verbundenen Mysterien von Gehirn und Verhalten zu überbrücken. Bücher wie Decartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn von Antonio Damasio oder Biology of Mind von Deric Bownds ermöglichen es uns Nicht-Wissenschaftlern, auch an dem Vergnügen teilzuhaben.
Unser Interesse an mentalen Prozessen mag zwar von neuen Technologien angeregt worden sein, aber das Interesse an der Arbeit des Gehirns ist nicht neu. Unser Interesse am Verstand nichtmenschlicher Lebewesen hat in den letzten Jahrhunderten mal zu- und mal abgenommen. Vor dreißig Jahren war das wissenschaftliche Interesse am Verstand von Tieren zumindest in den USA kaum vorhanden, im Moment nimmt es sprunghaft zu. Eins der interessantesten Ergebnisse dieser Forschungen ist die Erkenntnis, dass Gedanken und Gefühle gar nicht so streng voneinander getrennt werden können, wie wir das einmal angenommen hatten. Voller verständlichem Stolz auf unsere eigenen intellektuellen Fähigkeiten hatten wir die meiste Aufmerksamkeit dem denkenden und problemlösenden Teil unseres Verstandes gewidmet und diesen (natürlich zu unseren Gunsten) mit den Fähigkeiten anderer Tiere verglichen. Neuere Ansätze der Gehirnforschung haben zu einem verstärkten Interesse an Gefühlen geführt – was sie sind, wie sie erzeugt werden und was ihr Sinn und Zweck sein könnte. Wir beginnen jetzt nicht nur zu verstehen, was Gefühle tatsächlich sind, sondern begreifen auch, welche Wichtigkeit sie sowohl für Menschen als auch für Tiere haben.
Das gestiegene Interesse am Innenleben von Tieren ist für Hundefreunde eine wunderbare Sache, denn das aufkeimende Interesse an den mentalen Erfahrungen von Tieren hat gleichzeitig auch zu einem Interesse am Verstand unserer Hunde geführt. Endlich bekommen Hunde etwas von der Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht, nachdem jahrzehntelang für sie in der akademischen Welt eher der Ausspruch »Zu viel Vertraulichkeit schadet« galt. Als Wissenschaftler konnte man Serengetilöwen, Bartwale oder Scherenschwanz-Königstyrannen studieren, aber um Himmelswillen nicht auf die Idee kommen, sich mit der Erforschung von Hunden einen Namen machen zu wollen. Das allerdings hat sich in den letzten Jahren geändert und selbst in renommierten Wissenschaftszeitschriften wie Journal of Comparative Psychology oder Science gab es kürzlich Artikel, die unser Wissen um die kognitiven Fähigkeiten von Hunden erweitern. Dieses Interesse spiegelt sich auch in einer Gruppe lesenswerter Bücher wider, die mit viel Sachkenntnis speziell zum Thema »geistige Fähigkeiten von Hunden« geschrieben wurden. So schlagen zum Beispiel Wenn Hunde sprechen könnten von Vilmos Csányi, Wie Hunde denken und fühlen von Stanley Coren oder The Truth about Dogs von Stephen Budiansky wichtige Brücken zwischen dem, was Menschen über den Verstand ihrer Hunde wissen möchten und dem, was die Wissenschaft tatsächlich herausgefunden hat.
Hunde liegen nicht herum und sinnieren über die Evolution der Gefühle oder darüber, ob ihre Menschen die gleichen Gefühle haben wie sie, aber für uns ist es das Natürlichste von der Welt, uns zu fragen, was unsere Hunde wohl fühlen. Wie könnte es auch anders sein? Wir haben sie jahrhundertelang unsere besten Freunde genannt – und was ist für eine Freundschaft grundlegender als eine gefühlsmäßige Verbindung? Eine Freundschaft ohne emotionale Komponente ist überhaupt keine Freundschaft, sondern eine Geschäftsbeziehung (und selbst in denen gibt es meistens noch einen emotionalen Anteil). Hunde wecken ein ganzes Meer von Gefühlen in uns – und wir tanzen fast jeden Tag mit den Wellen auf und ab, von Freude und Liebe bis hin zu Wut und Traurigkeit. Jahrhundertelang waren Hundenarren davon überzeugt, dass wir nicht alleine auf diesem Meer paddeln, sondern dass unsere Hunde selbstverständlich mit uns da draußen sind und die gleichen Gefühle mit uns teilen. Wer kann schon spielenden Welpen zuschauen oder beobachten, wie ein Hund nach dem Verlust eines Freundes tagelang bewegungslos daliegt, und dann behaupten, Hunde hätten keine Gefühle wie wir?
Im Gegensatz zu den Hundefreunden vertreten Wissenschaftler und Philosophen heute aber die unterschiedlichsten Ansichten zum Gefühlsleben unserer Hunde. Manche argumentieren, dass nur Menschen Gefühle erleben könnten, andere vertreten die Ansicht, dass Tiere primitive Gefühle wie Angst und Wut empfinden könnten, aber keine komplizierteren wie Liebe oder Stolz. Und am anderen Ende des Spektrums sitzen diejenigen, die es für wissenschaftlich vertretbar halten, zu sagen, dass viele Säugetiere mit dem Gesamtpaket ausgestattet sind und ihre Gefühlswelt in mancherlei Hinsicht mit der unsrigen vergleichbar ist.
Tatsache ist, dass wir noch nicht genug wissen, um wirklich sicher zu sein, was im Verstand unserer Hunde vorgeht. Aber wir wissen genug, um innezuhalten und uns umzusehen, was wir wissen, was wir nicht wissen und was wir noch lernen möchten. Und darum geht es in diesem Buch. Es ist eine Bestandsaufnahme zu den Gefühlen von Hunden und von den Menschen, die sie lieben. Es wurde in der Überzeugung geschrieben, dass das Thema gleichzeitig sowohl wunderbar einfach als auch kopfzerbrechend komplex ist. Auf der einen Seite: Natürlich haben Hunde Gefühle. Das erscheint so offensichtlich, dass die meisten von uns sich dumm dabei vorkommen, es sagen zu müssen. Hunde drücken Gefühle so pur und klar aus wie ein fünfjähriges Kind, was sicher einer der Gründe dafür ist, warum wir sie so lieben.
Und trotzdem: Sobald einem diese Tatsache klar ist, werden die Dinge sehr schnell komplizierter. Gefühle sind erstaunlich komplex, und wie es oft der Fall ist, werden die Dinge umso komplizierter, je mehr wir über sie wissen. Je umfassender unser Wissen über das Gehirn wird, desto mehr beginnen wir zu verstehen, dass Gefühle unersetzliche Bestandteile unseres bewussten und unbewussten Lebens sind und untrennbar mit unserer Fähigkeit zu tun haben, gute (oder schlechte) Entscheidungen treffen zu können. Früher betrachteten wir rationelle Gedanken als den Gefühlen gegenüber höherwertig, aber dann stellte sich heraus, dass »rationelle« Gedanken ohne die Information des Gefühls uns in Probleme ohne Ende stürzen können.
Probleme, so wie die zwischen Menschen und Hunden, sind einer der Gründe, warum ich mich für dieses Thema interessiere. Ich bin zertifizierte Tierverhaltenstherapeutin und habe siebzehn Jahre lang mit Hunden gearbeitet, die schwerwiegende Verhaltensprobleme hatten. Teil meines Jobs ist es, zu versuchen, in den Kopf dieser Hunde mit problematischem Verhalten zu schauen. Der häufigste Grund, warum Hundebesitzer zu mir ins Büro kommen, ist Aggression – Hunde, die knurren, wenn man ihnen ans Halsband fasst, die den Nachbarn beißen oder die im Park Raufereien mit anderen Hunden anfangen. Andere kommen, weil ihre Hunde panisch werden, sobald sie aus dem Haus gehen oder weil sie durchs geschlossene Fenster springen, wenn es donnert.
Alle diese Probleme, so werde ich argumentieren, sind von Gefühlen beeinflusst – von Angst, Glück, oder Wut, die aus Frustration entstanden ist. Für mich ist wichtig zu wissen, welche Gefühle beteiligt sind – nicht nur, um dem Hund und seinem Besitzer zu helfen, sondern auch, um mich selbst zu schützen, wenn ich mit einem Hund, der Menschen beißt, zusammen in einem kleinen Raum bin. Anders als manche denken sind Verhaltenstherapeuten, Trainer und Tierärzte keinesfalls automatisch mit einem Schutzschild ausgestattet, das sie davor bewahrt, gebissen zu werden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gehört habe »Oh, normalerweise hätte er Sie jetzt schon längst gebissen!« – und zwar von Besitzern, deren Vorhersage, dass der Hund gleich beißen würde, nicht etwa dazu geführt hätte, dass sie vorbeugend etwas unternommen hätten. Wir, die wir mit aggressiven Hunden arbeiten, werden meistens deshalb nicht gebissen, weil wir gelernt haben, sie zu lesen und Vermutungen über ihre Gefühle und Motivationen anzustellen. Diese Vermutungen helfen uns, vorherzusagen, was ein Hund als Nächstes tun wird und wie wir, einem guten Tanzpartner gleich, darauf reagieren müssen. Und zwar so, dass es uns beiden hilft.
Wenn wir einen Hund beobachten, der ängstlich aussieht, heißt das natürlich noch nicht, dass wir wissen, inwiefern dieses Angstgefühl unserem eigenen ähnelt. Im Beruf ist aber nur wichtig, dass das Äußere eines Hundes mir etwas über sein Inneres verraten kann. So kann ich einen Behandlungsplan entwerfen, der die Persönlichkeit des Hundes berücksichtigt, anstatt ein kochrezeptähnliches Schema aus einem Handbuch zu übernehmen. Und selbst wenn es keinen Nutzen hätte: Tatsache ist, dass ich ganz einfach wissen möchte, wie es ist, ein Hund zu sein. Wie Jeffrey Moussaieff Masson in seinem Buch Dogs Never Lie About Love (Hunde lügen niemals Liebe) so schön sagt: »Ich kenne sie so gut wie meinen engsten Freund, und doch habe ich keine Ahnung, wer sie sind.« Was für ein herrliches Paradox. Es jagt mir Schauer über den Rücken.
Ich möchte mehr darüber wissen, was Hunde fühlen und wie diese Gefühle sich mit meinen eigenen vergleichen lassen. Ich möchte es wissen, weil ich als Wissenschaftlerin ausgebildet bin und der Entdeckerdrang wie eine Droge auf mich wirkt. Ich möchte es wissen, weil es meiner Meinung nach für unsere Spezies wichtig zu wissen ist, wie wir in den Rest des Lebens hineinpassen. Außerdem könnte bei beiden Spezies so viel Leid vermieden werden, wenn wir mehr über das Gefühlsleben unserer Hunde wüssten. Vor allem aber möchte ich es wegen meiner eigenen Hunde wissen. Meine Hunde sind für mich genauso wichtig wie meine menschlichen Freunde. Sie sind meine Kumpel, meine Familie, meine Mitarbeiter, meine Therapeuten – und, wie alle guten Freunde, gelegentlich auch eine Last. Ich möchte mehr darüber wissen, wer sie sind und was sie fühlen – zum Teil deshalb, weil ich ihnen gerne ein so schönes Leben wie möglich bieten möchte und zum Teil aus dem Wunsch heraus, unsere Freundschaft noch zu vertiefen.
Ich habe jetzt drei Hunde. Drei Hunde und einen Grabstein im Garten für meinen Seelenpartner-Hund Cool Hand Luke, der kürzlich starb und immer noch so sehr Teil der Farm zu sein scheint wie ich selbst. Seine Tochter, die zwölf Jahre alte Lassie, ist immer an meiner Seite – ein hart arbeitender Border Collie, der die Schafe hütet, mir bei der Arbeit mit aggressiven Hunden hilft und bei meinen öffentlichen Auftritten mit dabei ist. Lassie ist sanft wie Seide, so reaktionsschnell wie ein Formel-Eins-Wagen und, so denke ich, die meiste Zeit über irgendwie besorgt.
Die fünfzehn Jahre alte Pip ist ebenfalls ein Border Collie, hat aber das Buch nicht gelesen, in dem steht, wie Border Collies sich benehmen sollten. Selbst als Welpe war sie schon ruhig und sanft, sie wedelt sturköpfige Schafe mit dem Schwanz an und rennt in Panik weg, wenn ein altes Mutterschaf sich nur umdreht und sie ansieht. Pip war immer die Ruhige, der Kindermädchen-Hund. Man konnte sich darauf verlassen, dass sie zuhause blieb und auf die Kinder aufpasste, wenn die anderen spielen gingen. Für Hunde mit angstbedingter Aggression ist Pippy der ideale geistige Führer, sie liebt andere Hunde und Menschen gleichermaßen und ich habe mich immer gefragt, ob sie sich nicht, wenn sie die Wahl gehabt hätte, lieber einen alleinstehenden Mann als Besitzer ausgesucht hätte. Pip sieht aus wie eine Kreuzung aus Border Collie und Labrador: außen der typische sanftmütige, nettdümmliche Gesichtsausdruck eines Retrievers und innen ein Verstand so scharf wie ein Rasiermesser. Pip kann einen neuen Trick nach ein- oder zweimal Üben lernen, während Lassie Tage oder Wochen braucht, um dahinterzukommen. Mit fünfzehn ist Pip nun alt, sie hört nicht mehr sehr gut und folgt mir auf Schritt und Tritt. Mir bricht fast das Herz, wenn sie am Fenster steht und mir nachschaut, wenn ich mal wieder auf Geschäftsreise muss.
Und dann ist da noch Tulip, meine elf Jahre alte Pyrenäenberghündin, das Musterbeispiel für Hunde als gefühlsbetonte Wesen. Sie strahlt Freude aus wie Sonne an einem Wintertag. Tulip ist ein riesiges, zotteliges, umherhüpfendes und im Kreis springendes Spielkind und ich liebe sie so sehr, dass es mir schon die Brust zusammenzieht, wenn ich nur darüber schreibe.
Und darum dreht sich ja irgendwie alles, oder? Unsere Bindung zu Hunden beruht auf Gefühlen – auf der Freude, die sie uns geben, der Liebe, die wir für sie empfinden und die sie uns geben. Wenn wir ehrlich sind, gehören auch die ärgerlichen und verletzten Gefühle dazu, wenn wir uns von ihnen verraten fühlen und die Angst, die sie in uns wecken, wenn sie uns ihre Zähne zeigen oder uns ins Gesicht beißen. Hunde bringen Gefühle aus uns hervor, wie man Wasser aus einem Schwamm drückt und die Diskussion darüber, ob sie selbst Gefühle haben, erscheint so absurd wie die Frage, ob es am Himmel eine Sonne gibt. Aber für all die Liebe, die wir für Hunde empfinden, für all die Freude und die Tränen müssen wir viel über unsere eigenen Gefühle lernen, die wir im Umgang mit ihnen haben und über die Gefühlsreaktionen der Hunde auf uns.
Liebe ist, wie jeder Partner oder jede Mutter Ihnen sagen kann, nicht das Gleiche wie Verstehen. So wie die Frau, die ihren Border Collie genauso sehr liebte wie sie ihn verwirrte, können wir alle davon profitieren, mehr über die Gefühle beider Spezies zu lernen. Manche Leute, die ihre Hunde lieben, übersehen ganz offensichtliche Gefühlsausdrücke in den Gesichtern ihrer Hunde (fragen Sie mal einen beliebigen Hundetrainer). Andere sind nicht sehr gut darin, ihre eigenen Gefühle im Umgang mit Hunden zu kontrollieren und verursachen bestenfalls Verwirrung oder im schlimmsten Fall furchtbares Leid. Viele Hundebesitzer wissen nicht, dass Hunde, genau wie Kinder, lernen müssen, ihre eigenen Gefühle zu kontrollieren. Ich habe zahllose Male gesehen, dass Hunde aus Gründen gebissen haben, die meiner Meinung nach mit Frustration zu tun hatten – es waren Gefühlsausbrüche, die hätten verhindert werden können, wenn sie gelernt hätten, was alle Wesen lernen müssen, die mit anderen zusammenleben: Dass Geduld eine Tugend ist.
Es sind viele Gefühle, die unsere Beziehungen zu Hunden festigen oder untergraben, aber der weitaus häufigste Grund schwerwiegender Verhaltensprobleme bei Hunden ist Angst. Hunde verwüsten das Haus, weil sie Angst haben, alleine zu bleiben, kauern zitternd im Bad, weil sie eine Phobie vor Gewittern haben oder verkriechen sich, wenn die Nachbarskinder zum Spielen kommen – um dann anzugreifen, wenn sie in eine Ecke gedrängt werden. Vielen Menschen ist nicht klar, wie oft Hundebisse aus Angst entstehen und wie es die Angst nur vergrößert und die Wahrscheinlichkeit des nächsten Bisses steigert, wenn man einen solchen Hund anschreit.
Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch nicht nur von intellektuellem Interesse ist, sondern auch dazu beiträgt, einige dieser Beißunfälle zu verhindern und einige der Leiden zu mildern, die entstehen, wenn zwei Wesen sich ohne das für eine gesunde Beziehung notwendige gegenseitige Verständnis lieben. Liebst du mich auch ist eine Kombination aus erzählten Begebenheiten, Wissenschaft und praktischem Rat dazu, wie Wissen um die Gefühle von Hund und Mensch unsere Beziehungen zu Hunden verbessern kann. Es ist kein Hundeerziehungsbuch, aber voller Informationen, die Ihrem Hund zu besserem Verhalten verhelfen können und Ihnen dazu, ein besserer Hundebesitzer zu sein. Es beginnt nicht mit einer Aufzählung all dessen, was wir über die Biologie von Gefühlen wissen – ein solches Buch wäre zu schwer, um es anzuheben. Ich habe mich auf diejenigen Gefühle konzentriert, die in Mensch-Hund-Beziehungen am wichtigsten sind: Angst, Wut, Freude und die Schwester der Freude, die Liebe. Mein Ziel ist, all denjenigen etwas Interessantes und Hilfreiches zu bieten, die ganz einfach verrückt vor Liebe nach Hunden sind. Ich habe dieses Buches genauso für die Hunde geschrieben wie für uns, in der Hoffnung, dass es – wenn auch indirekt – Hunden hilft, uns besser zu verstehen, denn mit Sicherheit sind wir die verwirrendste Spezies auf der Welt.
1 Die Abkürzung »fMRT« steht für »funktionelle Magnetresonanztomographie«. Damit kann man den Blutfluss im Gehirn verfolgen und so feststellen, welche seiner Bereiche zu irgendeiner gegebenen Zeit aktiv sind.