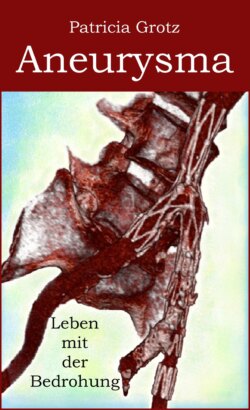Читать книгу Aneurysma - Patricia Grotz - Страница 15
10. Das Leid beginnt
ОглавлениеAm einundzwanzigsten Januar des Jahres 2002, also nur fünf Monate nach unserer Rückkehr nach Deutschland, erlebte ich ein Déjà-vu. Es war genau zwanzig Uhr, als ich Peter in einer merkwürdig gekrümmten Haltung vorfand. Er stand, die Knie an die Couch gelehnt, vornübergebeugt, hatte die gestreckten Arme auf die Rückenlehne der Couch gestützt und konnte seine Position nicht mehr verändern. Er hatte Schmerzen und bekam kaum mehr Luft zum Atmen. Nein, es war keine Täuschung, genau das hatten wir schon einmal in gleicher Weise erlebt. Ich schämte mich für den Gedanken, der mir durch den Kopf schoss: Was darf es denn diesmal sein? Ein Nierenstein oder eine kleine Panikattacke? Peter berichtete allerdings von einem neuen, diffusen, nicht tastbaren Schmerz im Rücken, der sich innerlich ausbreitete.
Es war mir in diesem Moment natürlich nicht bewusst, aber bis zu diesem Tag hatte ich ein wirklich schönes Leben gehabt.
Die Telefonnummer für ärztliche Notfälle wusste ich noch auswendig, aber sie war nicht mehr gültig. Ich musste die ziemlich lange Nummer eines zentralisierten ärztlichen Notdienstes wählen. Unter dieser Nummer landete ich nun offensichtlich in einem Call-Center. Nachdem ich mein Anliegen erläutert hatte, wurde ich für eine gefühlte Ewigkeit in eine Warteschleife gehängt, bis sich die Dame wieder meldete, um mir mitzuteilen, dass sie mich mit dem diensthabenden Notarzt unseres Landkreises verbinden würde, der mit Peter sprechen wolle. Ich hielt Peter den Hörer ans Ohr. Der berichtete von seinem Aneurysma, den diffusen Schmerzen im Rücken und seinem Verdacht, dass die Aorta gerissen sei. Der Notarzt hatte keine Ahnung, sagte, wir sollten den Schmerz weiter beobachten und verabschiedete sich.
Ich fragte mich, warum ein super funktionierendes ärztliches Notdienstsystem, so wie wir es ja erlebt hatten, in sein Gegenteil umgestülpt worden war. Hatte ich etwa weitere Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen verpasst? Aber zum Lamentieren war keine Zeit. Peters Körperhaltung wurde immer verkrampfter und die Schmerzen nahmen zu. Ich maß seinen Blutdruck, der gleichbleibend hoch war. Das sei gut, beruhigte ich Peter, bei einem Riss der Aorta würde er abfallen. Peter nickte, wies aber darauf hin, dass er schon kurz nach Abfall des Blutdrucks tot sein würde. Dem konnte ich nicht widersprechen. Um die Stimmung nicht weiter absacken zu lassen, schlug ich Eigendiagnose im Ausschlussverfahren zwischen den Blutdruckmessungen vor. Peter hatte mit seinen zweiundfünfzig Jahren schon reichlich Schmerzerfahrung und schloss (als sachverständiger Patient, Sohn eines Arztes und ausgebildeter Krankenpfleger) alles schon Dagewesene aus. Auch mein Tipp auf eine erneute Nierenkolik fand keine Zustimmung. Vielmehr verfestigte sich die Vermutung eines Risses der Aorta. Natürlich mussten wir zugeben, dass die Tatsache, dass Peter immer noch stehen konnte, dem vehement widersprach.
Um einundzwanzig Uhr, also fast eine Stunde später, telefonierte ich erneut mit dem ärztlichen Notdienst und bat darum, nun doch so schnell wie möglich einen Arzt zu schicken. Der rief nach zehn Minuten zurück und sagte, dass er in einem Besuch keinen Sinn sähe, Peter solle doch ins Krankenhaus fahren und ein CT machen lassen. Gute Nacht.
Beim Anblick meines mittlerweile kurzatmig stöhnenden Mannes, der in einem spastisch wirkenden Vierfüßlerstand auf dem Boden verweilte, wurde mir schnell klar, dass er in diesem Zustand nirgendwohin fahren konnte. Ich wählte zum dritten Mal dieselbe Nummer und bat um einen Rettungswagen. Wir warteten quälende fünfundvierzig Minuten, in denen ich mich mehrmals nach dem Verbleib der Sanitäter erkundigte. Der Zustand des Patienten hatte sich inzwischen deutlich verschlechtert, sodass man sich auf mein Drängen hin dazu durchrang, den Krankentransportwagen mit Blaulicht weiterfahren zu lassen.
Um zweiundzwanzig Uhr trafen drei junge, völlig ahnungslos wirkende Sanitäter ein. Zumindest stellten sie eine absolut zutreffende Diagnose: Jener, auf dem Boden röchelnde, im Vierfüßlerstand festgekrampfte Patient war so nicht transportfähig.
Via Telefon begann eine Diskussionen zwischen Sanitätern, Rettungsdienstleitstelle und dem diensthabenden Notarzt, der immer noch kein Interesse daran zeigte, uns zu besuchen. Als wir nach dem Anlass dieser Debatte fragten, wurde uns erklärt, dass ein Sanitäter weder Schmerz- noch sonstige Mittel verabreichen dürfe.
Eine Sanitäterin, der ich nach Aufforderung Peters Versichertenkarte in die Hand drückte, entgegnete:
»Warum sagen Sie nicht gleich, dass Ihr Mann privat versichert ist? Dann geht das alles viel schneller.«
Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Sie blieb dabei.
»Ja ehrlich. Das ist so.«
Parallel zu diesem kurzen Statement hatten die anderen Sanitäter besagten diensthabenden Notarzt doch noch überzeugen können, sich in Bewegung zu setzen. Der traf ohne Eile um dreiundzwanzig Uhr ein, also eine Stunde später. Er wusste noch nicht, dass Peter privat versichert war. Mit bleiernem Schritt verteilte er den Schlamm seiner Schuhe auf den Teppichen, bemühte sich, eitel und cool zu wirken, betrachtete unbeeindruckt das Häufchen Elend auf dem Boden und fragte:
»Na, wo tut´s denn weh?«
Diese Worte ließen meine Gehirnwindungen gefrieren.
Der Notarzt tastete den Bauch ab.
»Verhärtet. Gar nicht gut.«
Peter, der zu diesem Zeitpunkt seit drei Stunden auf dem Boden kauerte, antwortete wütend:
»Es ist nichts am Bauch! Ich bin nur verkrampft! Und das ist kein Wunder!«
Peter wurde unleidlich.
Nach mehreren kläglich scheiternden Versuchen mit schlichten Schmerzmitteln griff der Notarzt, der meiner Meinung nach diese Bezeichnung nicht verdiente, dann doch zu Morphium, natürlich nicht, ohne vorher die Versichertenkarte zu verlangen und durch seinen portablen Kartenautomaten zu ziehen, der den meisten Platz in seinem Koffer einnahm.
Einer der Sanitäter warf schüchtern die Frage in den Raum, wie man denn gedenke, den zu transportierenden Patienten aus dem Haus mit der schönen Hanglage die sechzig Stufen hinunter zum Wagen zu bringen. Es war niemandem entgangen, dass der zu Befördernde mindestens hundert Kilogramm an Körpergewicht mitbrachte und eben seiner letzten motorischen Fähigkeiten beraubt worden war. Der Notarzt fühlte sich nicht betroffen und kommentierte trocken:
»Einem guten Sani fällt immer was ein.«
Es folgten ratlose Blicke.
»Wie wär´s mit einer Trage?«, fragte ich, erntete aber nur mitleidige Blicke.
Peter nahm die Sache nun selbst in die Hand.
»Fahrt den Wagen oben an den Zaun. Ich gehe.«
Er nickte mir zu und ich beschrieb den Weg.
Die Sanitäter betrachteten Peter und äußerten Einwände:
»Sie können nicht mehr gehen.«
Der Notarzt saß teilnahmslos in Peters Lieblingssessel, die Beine lässig übereinandergeschlagen und pulte an seinen Fingernägeln herum.
»Und? Habt ihr euch schon entschieden, was ihr macht?«
Peter wurde es zu viel. Er richtete sich zu seiner ganzen Größe auf, das ging ja dank des Morphiums wieder ganz gut und fing an zu schreien:
»Ihr habt doch alle keine Ahnung! Wenn ich sage, ich gehe, dann gehe ich! Und jetzt macht endlich! Ich habe keine Lust mehr!«
Es war weit nach Mitternacht, als die fluchenden Sanitäter Peter aus der für Behinderte definitiv nicht geeigneten Wohnung schleiften, den Berg hinauf über die matschige Wiese zerrten, in den Krankenwagen hievten und große Mühe hatten, ihn dort zu verstauen. Diese Tortur sah aus, als wäre sie für einen Kranken nicht zu überstehen, zumindest nicht für einen mit einer gerissenen Aorta, aber ein Bayer würde sagen:
»A Guada hoits aus.«
Der Notarzt hielt währenddessen einen kleinen Plausch mit den Nachbarn, die, durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen, sich nach unserem Befinden erkundigten. Abschließend wandte er sich an mich und sprach die verblüffenden Worte:
»Ich fahre noch mit bis zum Krankenhaus.«
Warum sollte er das tun? Vielleicht wohnte er dort? Oder er wollte die Karte nochmal durchziehen für den Totenschein? Nein. Er war dazu verpflichtet, nachdem er Morphium gespritzt hatte, das wusste ich nur damals noch nicht.
Weitere wirre Gedanken überfielen mich: Wenn ein Patient noch vor Erreichen eines Krankenhauses vom Tode ereilt würde, wäre das eine Kostenersparnis. Noch vorteilhafter wäre es, er würde gleich zu Hause sterben, dann könnte auch noch der Krankentransport eingespart werden. – Ich war eben wütend. Eines aber, so fand ich, war ganz klar: Das ärztliche Notfallsystem hatte sich in eine starre, unmenschliche Bürokratie verwandelt.