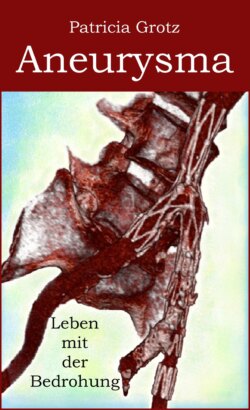Читать книгу Aneurysma - Patricia Grotz - Страница 17
12. Cor City
ОглавлениеGegen zehn Uhr erreichte ich Cor City. Peter war noch da! Heute freute ich mich ganz besonders, ihn zu sehen. An diesem Tag wurde mir klar, dass es nicht selbstverständlich war, seinen Partner jeden Morgen wieder gesund anzutreffen.
Peter berichtete, dass es nicht viel zu berichten gäbe. Die Diagnostik würde fortgeführt. Ein neues CT, ein MRT, Röntgenbilder, Laborwerte und alles, was es so gäbe. Peter hatte den Eindruck, dass sie sich Zeit verschaffen wollten, da sie nicht direkt eine brauchbare Idee hätten, was sie mit ihm anstellen sollten. Nachdem die Diagnose bereits feststand und Behandlungsansätze fehlten, hatten wir den Verdacht, dass das Krankenhaus durch Nutzung all seiner Geräte dann wenigstens Geld verdienen wollte.
Peter war schon wieder ganz lustig drauf. Vielleicht wirkte ja auch das Morphium immer noch, das während des nächtlichen Transportes noch einmal aufgefrischt worden war. Peter erzählte auch von weiteren Mitteln, die ihm von dem vor Angst schwitzenden Notfallmediziner verabreicht worden waren. Peter lachte und äußerte sein Mitleid mit dem Arzt, den er, trotz oder wegen des Morphiums, vollquatschte und der offensichtlich panische Angst gehabt hatte, dass die Trage zur Bahre werden könnte.
Wir erörterten Geschichten aus der Vergangenheit und Möglichkeiten der Zukunft, bis ich gehen musste, um Jonas von der Schule abzuholen. Wir umarmten und küssten uns lange und trennten uns fröhlich. Wir telefonierten an diesem Tag noch mehrmals, aber es gab keine Neuigkeiten. So vergingen fünf weitere, völlig ereignislose Tage. Wir telefonierten oft, und einmal am Tag nahm ich die weite Strecke auf mich, um Peter zu sehen. Jeden zweiten Tag fand ich meinen Mann in einer anderen Abteilung. Den Grund dafür konnte mir niemand einleuchtend erklären.
Am sechsten Tag blieb Peters morgendlicher Anruf aus. In der Klinik angekommen, irrte ich lange durch das große Gebäude. Schließlich fand ich meinen Ehemann in einem abgelegenen Kellerraum, der nur mit dem Nötigsten ausgestattet war, genau genommen nur mit dem Bett, auf dem er lag und einer hässlichen Deckenleuchte, die ein kaltes Licht ausstrahlte. Der Raum hatte, außer dem Estrichboden, ein schmales, vergittertes Fenster.
Ich fragte Peter, warum er hier sei. Peter grinste und zeigte zum Fenster.
»Der Professor sieht oft nach mir und winkt.«
Peter winkte zum Fenster. Ich trat näher an Peter heran und fragte:
»Weißt du, was sie dir gegeben haben?«
Peters Blick wanderte zu der Deckenlampe.
»Kannst du draußen sagen, sie sollen die Skorpione wegnehmen? Schau! Da krabbelt schon wieder einer raus. Manchmal sind es auch andere Tiere, aber die kenne ich nicht.«
Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich küsste ihn auf die Wange.
»Entschuldige mich kurz. Ich bin gleich wieder da.«
Ich eilte zur Tür, aber Peter rief mich. Ich drehte mich um.
»Ja?«
Plötzlich sprach er in einem ganz anderen, ernsten Ton:
»Kannst du mich hier rausholen?«
Ich nickte.
»Ich suche jemanden, der mir sagen kann, was hier los ist. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Hab noch ein wenig Geduld.«
Während ich auf der Suche nach einem Arzt wieder durch die Gänge irrte, spürte ich, wie Wut in mir aufstieg. Ich griff mir die nächste Schwester und machte ihr unmissverständlich klar, dass ich sofort einen zuständigen Arzt sprechen wolle. Nachdem mir meine schlechte Stimmung deutlich anzumerken war, musste ich gar nicht so lange warten. Eine Frau in einem weißen Kittel stellte sich als Stationsärztin vor. Von welcher Station sie eigentlich war, interessierte mich schon gar nicht mehr. Ich bat sie, mir mitzuteilen, welche Medikamente meinem Mann verabreicht worden waren. Sie sagte, dass sie das nicht wissen könnte, dazu bräuchte sie die Akte. Dann, so forderte ich sie in einem nicht ganz freundlichen Ton auf, sollte sie diese unverzüglich holen. Sie drehte sich um und ging, wohl in der Hoffnung, mich abschütteln zu können. Aber ich folgte ihr.
Wir durchquerten mehrere Flure und Räume, bis sie aufgab und die Akte holte. Sie blätterte lustlos darin herum und schüttelte den Kopf.
»Ich finde hier nichts.«
»Medikamente.«, entgegnete ich. »Welche Medikamente bekommt mein Mann?«
Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Keine.«
»Das kann nicht sein. Er fantasiert.«
»Wieso? Er ist doch ganz normal.«
»Nein, ist er nicht! Was bekommt er?«
»Nichts.«
Ich spürte, wie die Wut sich weiter in mir ausbreitete, nahm mich zusammen und stellte eine andere Frage.
»Welche Therapie ist denn geplant bei meinem Mann?«
Wieder blätterte sie in der Akte.
»Er ist für eine Stent-Operation vorgesehen. Wir haben da so eine neue Studie mit Stents.«
Ich weigerte mich zu glauben, dass es sich bei diesem Vormittag um das richtige Leben handelte, ich musste in einem ausgesprochen schlechten Film sein.
»Hat mein Mann der Operation zugestimmt?«
Erneutes Blättern.
»Ich kann hier nichts finden.«
Ich vergaß alle Filme und auch das richtige Leben und schrie los:
»Er wird nicht zustimmen und ich auch nicht! Und ich sage Ihnen noch etwas! Mit meinem Mann wird hier gar nichts gemacht! Und er bekommt keine Medikamente mehr! Haben Sie mich verstanden!«
Ich drehte mich um und rannte los, die grauen Gänge entlang, zu meinem lieben Peter in den kahlen Kellerraum. Vor der Tür atmete ich tief ein und aus, um mich zu beruhigen. Als ich hineinging und Peter mich sah, versuchte er aufzustehen, doch er war viel zu benommen. Trotzdem versuchte er es immer wieder.
»Wir gehen jetzt. Wir können doch gehen, oder?«
Stunden benötigte ich, um ihn zu beruhigen und ihm klarzumachen, dass wir im Moment nirgendwo hingehen konnten. Ich war den Tränen nah, weil Peter so enttäuscht war, dass ich ihn nicht sofort mit nach Hause nehmen konnte. Und immer wieder wurden meine Erklärungen, dass ich alles erst organisieren müsste, von den aus der Deckenleuchte herauskrabbelnden Skorpionen unterbrochen.
Ich bat ihn um noch ein wenig Geduld und versprach, ihn am folgenden Tag vormittags um elf Uhr abzuholen. Ich bläute ihm ein, unter keinen Umständen etwas zu unterschreiben – und musste ihn enttäuscht zurücklassen.
Vor dem Krankenhaus setzte ich mich auf eine Bank und wartete das Ende des Weinkrampfes ab, bevor ich unsere Hausärztin anrief. Ich hatte schon einige Male mit ihr telefoniert und sie über alles informiert. Ich schilderte ihr die Situation und bat sie inständig, mir bei einer Lösung zu helfen. Nach Hause, so waren wir uns einig, konnte ich Peter nicht holen. Dazu waren sowohl sein körperlicher als auch sein seelischer Zustand viel zu instabil. Von einem Transport im privaten Fahrzeug riet sie ebenfalls ab. Doch das hatte ich Peter schon versprochen.
Sieben Stunden später hatten wir einen Plan. Unsere Hausärztin hatte mit dem Chefarzt der Gefäßchirurgie im Vessel-Center telefoniert, einer spezialisierten Abteilung für Gefäßerkrankungen, die einer großen Klinik angeschlossen war. Der sagte, ich solle Peter durch die allgemeine Notaufnahme schleusen, das wäre der schnellste Weg zu seiner Station. Er würde sich ihn dann nach einer erneuten CT-Aufnahme ansehen. Und ich solle einen Arztbrief mitbringen.
Anschließend tat ich das, was ich mir im Jahr 1996 vorgenommen hatte, ich beschäftigte mich mit dem Thema. Bis spät in die Nacht recherchierte ich im Internet über Stents. Stent heißt übersetzt, vom Gefäß ausgehende Prothese. Es handelt sich um einen filigranen Kunststoffschlauch mit einem selbstexpandierenden Drahtgeflecht. Der Schlauch wird, in einer Kunststoffhülse ganz klein zusammengefaltet, über die Leiste eingeführt, in der Aussackung platziert und entfaltet. Man braucht also nicht mehr den ganzen Menschen aufzuschneiden und den Blutfluss zu unterbinden, um eine Prothese anzunähen. Allerdings las ich auch, dass bei vielen Patienten, die an den Studien teilgenommen hatten, die Stents nicht hielten und im Gefäß wanderten. Zusammenfassend kam ich für mich zu dem Ergebnis, dass Stents zwar gewiss in naher Zukunft die Methode der Wahl sein würden, aber im Moment noch nicht ganz ausgereift waren, nicht im Januar des Jahres 2002.
Auch den Rest der Nacht verbrachte ich schlaflos. Ich grämte mich und machte mir Vorwürfe, dass ich Peter in dieser schrecklichen Lage alleingelassen hatte. Bestimmt hatte ich vernünftig gehandelt, aber mein Herz sagte mir etwas anderes.
Am nächsten Morgen überfiel mich eine unbeschreibliche Panik. Ich befürchtete, Peter nicht mehr vorzufinden. Ich hatte Angst, dass er verloren gegangen war und die Klinik bestreiten würde, ihn jemals aufgenommen zu haben. Vor allem aber schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Diese ganze Geschichte würde mir kein Mensch glauben! Sie würde als meine Neigung zu Übertreibungen abgetan werden oder man würde mich für eine Spinnerin halten! Und niemand würde mir helfen!
Im Cor City angekommen, ging ich immer schneller durch die Flure, schließlich rannte ich, bis ich vor dem Kellerraum angekommen war und riss sie auf. Da lag er, mein lieber Peter, genauso wie am Tag zuvor. Ich war derart erleichtert, dass ich anfing zu lachen, ihn umarmte und ganz fest drückte. Mir fiel auf, dass er schon fertig angezogen war. Der kleine Koffer war fast fertig gepackt.
»Kannst du dich erinnern, dass ich versprochen habe, dich heute um elf abzuholen?«
»Ja. Wann hab ich vergessen. Wo gehen wir hin?«
»Ins Vessel-Center.«
»Nein, ich will nach Hause.«
»Peter. Wir brauchen eine zweite Meinung. Und du hast einen Termin beim besten Gefäßchirurgen der Stadt.«
»Den kenn ich nicht.«
»Das macht doch nichts.«
Peter antwortete nicht, sah zu dem schmalen vergitterten Fenster und winkte. Das beunruhigte mich.
»Ist der Professor wieder da?«
Peter winkte weiter.
»Was soll die Frage, du siehst ihn doch.«
»Nicht so richtig. Wie sieht er denn aus?«
Peter zuckte nur mit den Schultern.
»Wie geht´s den Skorpionen?«
»Was für Skorpione? Insekten, riesige Insekten! Als es draußen dunkel wurde, sind sie aus dem Lüftungsschacht gekrochen und auf mich zugeflogen. Es war schrecklich. Die ganze Nacht musste ich sie abwehren.«
»Wo ist der Lüftungsschacht?«
Peter zeigte zur Deckenlampe.
»Warum hast du das Licht nicht ausgemacht?«
»Weil es keinen Schalter gibt.«
Ich sah mich um. Es gab tatsächlich keinen. Ich sah Peter an.
»Weißt du, wie ich heiße?«
»Was soll die Frage? Natürlich weiß ich das!«
»Na ja, wie denn?«
»Also das ist mir zu blöd.«
»Weißt du, dass ich deine Ehefrau bin?«
Wieder zuckte Peter mit den Schultern, diesmal fast beleidigt.
»Sag mir mein Geburtsdatum.«
Peter schüttelte den Kopf.
»Das krieg ich nicht hin.«
»Dein eigenes Geburtsdatum?«
Peter schüttelte den Kopf.
»Peter, ist dir klar, dass mit dir was nicht stimmt?«
»Allerdings!«
»Was könnte es sein?«
»Ich kann´s nicht sagen, es ist in meinem Kopf. Da passieren ganz schlimme Geschichten.«
»Ich nehme an, du hast Medikamente bekommen, die das auslösen. Aber ich kann es nicht beweisen und keiner hier spricht offen mit mir. Es wird dir besser gehen, wenn der Stoff aus deinem Körper raus ist, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert.«
Peter nickte.
»Hat dir jemand hier etwas von einer geplanten Operation gesagt?«
Peter nickte wieder und entgegnete:
»Aber sie waren sich nicht sicher, ob ich da reinkomme.«
Die Worte, die er eigentlich sagen wollte, fielen ihm nicht ein. Mit "reinkommen" meinte er die Studie, von der die Ärztin gesprochen hatte, in der ausgewählte Patienten mit neuen Stents operiert wurden.
»Hast du irgendwas unterschrieben?«
Peter schüttelt den Kopf.
»Peter. Vertraust du mir?«
»Natürlich. Wem sollte ich sonst vertrauen.«
»Gut. Also wenn wir jetzt gehen, musst du mir vertrauen und tun, was ich dir sage. Auch wenn es für dich nicht ganz schlüssig ist. Versprichst du mir das?«
Peter nickte und setzte sich auf, die Schuhe hatte er schon an. Mit dem Gehen hatte er Probleme, Koordination und Balance schienen nicht in Einklang zu sein.
Ich führte ihn in den Wartebereich im ersten Stockwerk und bat ihn, sich zu setzen.
»Nein, ich brauch keine Pause. Was soll ich hier? Ich will nach Hause!«
Ich beichtete ihm, dass wir unbedingt einen Arztbrief benötigten und dass ich nicht sagen könne, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde. Es kostete mich allerhand Mühe, um ihn zu überreden, noch an diesem Ort zu verweilen, und das, bevor die eigentliche Auseinandersetzung mit den Ärzten überhaupt erst begonnen hatte.
Die Information, dass mein Mann die Klink umgehend verlassen würde, kam erwartungsgemäß nicht gut an. Meine Forderung nach einem Arztbrief war sozusagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Unterhaltung artete ziemlich aus und es dauerte nicht lange, bis wir uns anschrien, der Stationsarzt und ich. Mir wurde an den Kopf geworfen, die Gesundheit meines Mannes auf unverantwortliche Weise zu gefährden, da er in keinem Fall transportfähig sei. Ich schrie zurück, dass das ja nur daran läge, dass er Medikamente bekommen hätte, deren Gabe bestritten werde und die diese Situation erst ausgelöst hätten. Ich solle nicht so laut schreien, das würde die anderen Patienten stören. Ich war außer mir und schrie weiter:
»Ich kann noch viel lauter werden! Es sollen ruhig alle hören, was hier los ist!«
Nach fünfundvierzig Minuten hatte ich den Arztbrief. Wir mussten beide unterschreiben, dass Peter das Krankenhaus auf eigene Verantwortung gegen ausdrücklichen ärztlichen Rat in Begleitung seiner Frau verlassen würde. Die Röntgenbilder und die CT-Aufnahmen sowie die Befunde nahm ich auch gleich mit.
Nun stand uns die nächste Hürde bevor. Ich bugsierte Peter in mein kleines Auto und bat das Schicksal erneut um Gnade. Mein Handeln war äußerst gewagt und ich hoffte, dass es mir vergönnt war, Peter lebend zum Vessel-Center zu befördern.