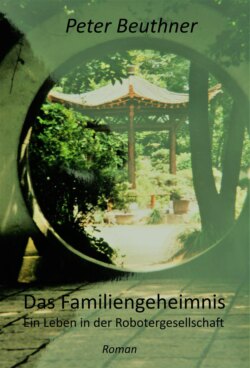Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kaffeekränzchen
ОглавлениеEs war Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr, als Ellen – wie anläßlich ihres letzten Treffens bei Eppelmanns verabredet – bei Wangs erschien. Chan öffnete ihr die Tür, begrüßte sie herzlich und führte sie ins Wohnzimmer, wo Frau Li bereits auf sie wartete. Chan machte die beiden Damen miteinander bekannt und bat sie dann, Platz zu nehmen. Noch während sich die Damen setzten, kündigte Frau Li an, daß sie leider nur begrenzte Zeit habe, weil ihr Mann sie bald abholen würde. Es hätte sich unerwarteter Weise so ergeben, daß sie noch eine andere Verabredung in der Stadt wahrnehmen müßten. Und sie bat die Damen um Entschuldigung für diese Unhöflichkeit.
„Aber selbstverständlich, das ist doch kein Problem“, beruhigte Chan sie und beauftragte Robby, den Kaffee für Ellen und den Tee für Frau Li und sich selbst sowie ein paar Plätzchen zu servieren, während sie sich noch mal für einen Moment entschuldigte und den Raum verließ.
„Sie leben in Beijing?“ fragte Ellen Frau Li, nachdem sie sich gesetzt hatte.
„Ja, richtig. In Beijing“, antwortete Frau Li. Es war eine zierliche kleine Frau. Sie mag vielleicht so Anfang bis Mitte 40 sein, vermutete Ellen nach den Erzählungen von Chan, obgleich sie eigentlich viel jünger aussah. Sie hatte eine wunderbar zarte und glatte Haut, einen porzellanfarbenen Teint und pechschwarzes, kurzgeschnittenes Haar, was sie sehr jugendlich wirken ließ. Und dieser Eindruck wurde durch ihren sehr modischen Damenanzug noch verstärkt.
„Ich bin selber leider noch nie in Beijing gewesen“, erzählte Ellen, „aber nach allem, was man so über die Medien hört und sieht, muß das ja eine tolle Stadt sein – und riesengroß. Wieviel Einwohner hat die Stadt eigentlich inzwischen?“
„Oh, wir haben zur Zeit etwa 30 Millionen Einwohner.“
„So viele?“ fragte Ellen ungläubig.
„Ja, und es werden praktisch täglich mehr. Es kommen immer noch viele Bauern vom Land und suchen Arbeit in der Stadt.“
„Unglaublich! Dagegen ist Ulm mit seinen rund eine Million Einwohnern ja ein richtig kleines Spatzennest!“
„Ja, das kann man wohl nicht miteinander vergleichen. Es fragt sich nur, ob es sich in einer kleineren Stadt nicht vielleicht viel angenehmer leben läßt? Wir Chinesen wachsen ja in großer Bevölkerungsdichte auf und sind gewohnt, darin zu leben. Aber einem Westeuropäer, der so große Menschenmassen nicht gewohnt ist, dem muß es darin ja vielleicht wie in einem Hexenkessel vorkommen.“
„Das mag sein. Ob ich dort leben wollte, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht recht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber zumindest besuchsweise würde – und werde – ich ganz bestimmt mal hinfahren.“
„Da kann ich Sie nur bestärken, Beijing ist auf jeden Fall eine Reise wert.“
Während sie sich so angeregt unterhielten, kam Chan herein.
„So, wie ich sehe, scheint Ihr Euch ja schon bestens zu unterhalten“, sagte Chan mit einem freundlichen Lächeln. Sie tranken ihren Tee beziehungsweise Kaffee, naschten von den köstlichen Plätzchen und plauderten noch ein Weilchen über dies und das, bis Chan schließlich das Gespräch auf das Thema Schulsystem lenkte, den eigentlichen Zweck der Zusammenkunft.
Ellen griff den Gedanken sogleich dankbar auf: „Das chinesische Bildungssystem kenne ich leider nicht so genau, Frau Li. Haben Sie dort eigentlich auch regulär zwölf Schuljahre?“
„Nicht generell“, begann Frau Li zu erklären. „Zunächst besuchen bei uns die Kinder vom dritten Lebensjahr bis zur Grundschule ganztägig und kostenlos einen Kindergarten mit Vorschulcharakter. Dann schließt sich ein zweigliedriges Schulsystem – sechs Jahre Grundschule, anschließend drei Jahre Unterstufe einer Mittelschule – an.“
„Ist das eine Ganztagsschule?“
„Ja, eine Ganztagsschule, regulär meist von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit einer Mittagspause von zwei Stunden. Diese neun Jahre unterliegen der Schulpflicht und sind im Prinzip schulgeldfrei. Es sind lediglich einige hundert Yuan Gebühren für Lehrbücher und Nebenausgaben jährlich zu bezahlen.“
Ellen hob ein wenig die Augenbrauen, sagte aber nichts. Und Frau Li fuhr ungerührt fort: „Nach den neun Pflichtschuljahren teilen sich die Wege: Gute Schüler besuchen drei Jahre die Oberstufe der Mittelschule, wo sie am Ende der zwölften Klasse eine dreitägige Abschlußprüfung in allen Fächern absolvieren müssen und sich dann je nach Ergebnis an einer guten oder einer der besten Universitäten bewerben dürfen. Weniger gute Schüler können nach der neunten Klasse an eine Berufsmittelschule wechseln und sich dort drei Jahre lang auf ihren späteren Beruf vorbereiten, und ein anderer Teil wechselt gleich von der Schulbank ins Berufsleben.“
„Die Oberstufe ist nicht schulgeldfrei?“
„Nein. Ab der zehnten Klasse sind grundsätzlich Schulgebühren zu entrichten – bei allen öffentlichen Schulen. Und bei den Privatschulen, die es bei uns bekanntlich auch gibt, sowieso. Dort müssen die Eltern sogar wesentlich tiefer in die Tasche greifen.“
„Eigentlich erstaunlich“, bemerkte Ellen nachdenklich. „Immerhin behauptet das offizielle China nach wie vor, ein sozialistischer Staat zu sein.“
„China hat 1,5 Milliarden Einwohner; die Konkurrenz ist groß! Wer etwas werden will, der muß schon selber etwas in seine Ausbildung investieren!“ entgegnete Frau Li mit dem Brustton der Überzeugung.
„Aha“, sagte Ellen daraufhin nur. Sie wollte sich dazu nicht weiter äußern und wechselte das Thema: „Und wie verhält es sich dort mit dem Benotungssystem?“
„Eine Benotung ist bei uns lediglich für die Entscheidung zum weiteren Werdegang eines Schülers relevant – also beim anstehenden Übertritt in eine weiterführende Schule, das heißt, nach der sechsten, neunten und zwölften Klasse.“
„In den anderen Jahren nicht?“
„Nein, immer nur zum Abschluß eines Schulabschnitts. Nach sechs Jahren Grundschule machen sie eine Aufnahmeprüfung für die Unterstufe der Mittelschule.“
„Warum schon nach der sechsten? Ich denke, Sie haben eine 9-jährige Schulpflicht.“
„Das ist richtig. Aber bei dieser Prüfung entscheidet sich, in welche Mittelschule man kommt – und die sind längst nicht alle gleich. Mittelschulen, die einen guten Ruf haben, sind selbstverständlich daran interessiert, diesen auch zu behalten. Deshalb nehmen die natürlich nur die besseren Schüler auf.“
„Aha, verstehe“, resümierte Ellen. „Das heißt, jede Schule hat ihren Ruf im Prinzip schon mal unwiderruflich weg. Und jeder weiß, gehst du in diese Schule, gehörst du zu den besseren Schülern. Gehst du hingegen in jene Schule, dann gehörst du zu den schlechteren Schülern. Ist das so? Und ist das beabsichtigt?“
„Ja, durchaus. Es sind nun mal nicht alle Schüler gleich gut. Und wir wollen nicht, daß die besseren durch die schlechteren Schüler in ihrem Lernen behindert oder aufgehalten werden. Jeder Schüler soll möglichst optimale Bedingungen unter seinesgleichen vorfinden. Also fassen wir die jeweils Guten, die Mittelmäßigen und die Schwächeren separat in unterschiedlichen Schulen zusammen.“
„Ist ja interessant“, staunte Ellen. „Aber ganz anders als bei uns. Gibt es da keine Probleme mit Klassenneid und Schüler-Frustration?“
„Vielleicht unterschwellig. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Aber auf die persönlichen Befindlichkeiten eines jeden einzelnen können wir angesichts der großen Zahl von Schülern leider keine Rücksicht nehmen. Und im übrigen hat sich noch niemand darüber aufgeregt. Es ist ein eingeführtes System, und es hat sich über viele Jahrzehnte bewährt. Gewiß, die Erwartungshaltung ist hoch, der Leistungsdruck für die Schüler entsprechend enorm. Manche erliegen dem Streß. Aber zum einen müssen wir der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Schüler Rechnung tragen – es ist eben nicht jeder zu Höchstleistungen fähig –, zum anderen müssen und können wir schon auf Grund der großen Menge Heranwachsender selektieren. Mit lauter durchschnittlich gebildeten Menschen ist unserem Staat nicht gedient. Immerhin bekommt bei uns jeder die gleichen Chancen, da kann sich keiner beklagen. Aber er muß sie auch nutzen. Wer sie nicht nutzt oder nicht nutzen kann, weil ihm die intellektuellen Voraussetzungen fehlen, der muß sich zwangsläufig mit einer anderen, gegebenenfalls bescheideneren Rolle zufrieden geben.“
„Sie haben natürlich recht, die Menschen sind in der Tat sehr unterschiedlich in ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Dem muß man selbstverständlich Rechnung tragen. Die Frage ist nur, in welcher Form das geschieht. Und hier vertrete ich die Auffassung, daß die weniger leistungsfähigen oder leistungswilligen Mitglieder der Gesellschaft nicht schon durch das System von vornherein bloßgestellt, ausgesondert und damit in ihrem Selbstbewußtsein beschädigt werden dürfen.“
„Wer tut das denn?“
„Nun, ich könnte mir vorstellen, daß für Schüler einer Mittelschule, die keinen guten Ruf hat, allein schon diese Tatsache ausreicht, um deprimiert oder gar frustriert zu sein, weil sie damit schlechtere Berufsaussichten haben, und weil sie wissen, daß auch alle anderen das wissen, wenn sie nur den Namen der Schule hören. Ich denke dabei so ein bißchen an unsere früheren Hauptschulen.“
„Ja, aber bei Ihnen wird doch auch differenziert. Es können schließlich nicht alle studieren und Gelehrte werden! Abgesehen davon, daß nicht alle gleiche intellektuelle Voraussetzungen mitbringen, brauchen wir ja auch die vielen unterschiedlichen Berufe. Und dabei sind sehr viele Berufe, für die gar kein Studium benötigt wird. Also, ich verstehe im Moment wirklich nicht Ihren Einwand.“
Ellen wurde etwas verlegen. Ihre Gesprächspartnerin fühlte sich augenscheinlich ein wenig provoziert, dachte sie. Und dabei lag das gar nicht in ihrer Absicht. Noch während sie angestrengt überlegte, wie sie diese Situation entkrampfen könnte, kam ihr Chan zu Hilfe, indem sie zu vermitteln versuchte: „Ich denke, die Tatsache, daß die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft sehr unterschiedlich ist und daß aber gerade diese unterschiedlichen Fähigkeiten in der Gesellschaft auch alle gebraucht werden, ist unstrittig. Und da habt Ihr, soweit ich das verstanden habe, auch gar keinen Dissens. Die Frage, die nun im Raum steht, ist, wie die jeweilige Gesellschaft dieses Faktum bestmöglich organisiert. Und da haben wir offenbar etwas unterschiedliche Systemansätze, was ja per se gar kein Fehler ist. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten zur Lösung eines Problems. Jede hat bestimmte Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Eine ideale Lösung wird sich selten finden; das Normale ist eine Kompromißlösung.“
„Das ist richtig“, beeilte sich Ellen zu sagen. „Ich wollte eigentlich auch nur verstehen, wie und wie gut Euer chinesisches Ausbildungssystem funktioniert. Ich erzähle nachher gern noch über unser europäisches System, wenn Sie das interessiert, Frau Li. Aber ich glaube, ich hatte Sie vorhin mit meinen Fragen unterbrochen, als Sie über die verschiedenen Abschlußprüfungen sprachen.“
„Ja, richtig“, nahm Frau Li ihren Faden wieder auf. „Bei der Abschlußprüfung nach der neunten Klasse waren wir wohl stehengeblieben, denke ich. Ja, da entscheidet sich, wie schon gesagt, wer die Zulassung für die Oberstufe erhält. Ungefähr ein Drittel der Schüler schaffen den Sprung in die Oberstufe.“
„Nur ein Drittel?“
„Ja, 30 bis 40 Prozent.“
„Und die anderen?“
„Wie schon gesagt, die können, wenn sie die Aufnahmeprüfung dazu schaffen, eine Fachoberschule oder eine Berufsfachschule für zwei bis vier Jahre besuchen. Andernfalls steigen sie direkt ins Berufsleben ein.“
„Hmm, erinnert mich so ‘n bißchen an unser früheres Schulsystem in Deutschland“, sinnierte Ellen vernehmlich. „Da ging die Mittelschule, die sogenannte Realschule, auch zunächst bis zur neunten, später bis zur zehnten Klasse. Und das Gymnasium wurde nach der zwölften Klasse mit dem Abitur abgeschlossen.“
„Ja, nach zwölf Jahren wird auch bei uns die Schule mit einer Abschlußprüfung – vergleichbar dem hiesigen Abitur – abgeschlossen. Danach müssen dann aber noch all diejenigen, die ein Studium beginnen wollen, eine landeseinheitliche Hochschulaufnahmeprüfung absolvieren. Das Ergebnis entscheidet darüber, wo und was man studieren darf. Ein Studium an der Universität dauert vier Jahre, an einer Fachhochschule zwei Jahre.“
„Heißt das, die Schüler können nicht selbst bestimmen, wo und was sie studieren wollen?“
„Nun, die Bewerber können schon Wünsche bezüglich Universität und Studiengang äußern. Ob diese allerdings erfüllt werden, das hängt ganz wesentlich vom Ergebnis ihrer Hochschulaufnahmeprüfung sowie von der Aufnahmekapazität der betreffenden Universität ab. Da kommt es schon häufiger mal vor, daß einer etwas ganz anderes studieren muß, als er gewünscht hatte. Soweit ich informiert bin, gibt es ja bei Ihnen in Europa auch immer noch den Numerus clausus in bestimmten Fachrichtungen. Das ist also gar nichts Besonderes, sondern weitverbreitete gängige Praxis. Außerdem müssen wir ja auch die Möglichkeit der Bedarfssteuerung haben, um Fehlentwicklungen – Überschuß in einer Berufsgruppe und Mangel in einer anderen – zu vermeiden. Das ganze Zulassungsverfahren wird bei uns für sämtliche Studienfächer zentral verwaltet. Anders wäre das auch gar nicht möglich.“
„Hmm. . . . Können wir noch mal auf das Benotungssystem zurückkommen? Gibt es bei Ihnen Zensuren? Eins bis Sechs?“ wollte Ellen wissen.
„Nein. Wir haben ein Punktesystem. Dabei können die Schüler pro Fach maximal 100 Punkte, sollten aber mindestens 60 Punkte erreichen. Denn wer weniger als 60 Punkte geschafft hat, muß im nächsten Schuljahr auf eine weniger gute Schule wechseln, und das trifft üblicherweise rund 50 Prozent der Schüler. Da trennt sich also die Spreu vom Weizen, wie ihr in Europa so schön zu sagen pflegt.“
„Das ist hart“, fand Ellen. „Daß da so stark ausgesiebt wird?!“
„Wir haben jährlich an die 400 Millionen Kinder in der Ausbildung! Nicht jeder ist dazu prädestiniert, zur Elite zu gehören!“ entgegnete Frau Li kühl. „Nur die sehr guten, außerordentlich fleißigen, extrem leistungsbereiten Schüler kommen in den Genuß einer Hochschulausbildung. Nicht umsonst nehmen so viele Chinesen heute einen Spitzenplatz in der wissenschaftlichen Weltelite ein. China hat sich enorm entwickelt, worauf wir alle sehr stolz sind.“
„Ja, darauf können Sie wirklich stolz sein“, stimmte Ellen spontan zu. „China hat in der Tat eine enorme Entwicklung in den letzten 100 Jahren vollzogen. Da hat Europa – trotz seines hohen Bildungsniveaus – inzwischen Mühe, auch nur einigermaßen Schritt zu halten.“
„Ein hohes Bildungsniveau haben wir in China inzwischen längst erreicht“, entgegnete Frau Li selbstbewußt. „Obwohl wir vor 100 Jahren eine wesentlich schlechtere Ausgangsbasis hatten als Sie in Europa! Man bedenke nur, woher wir kommen: Von einem Arbeiter- und Bauern-Staat mit einem riesigen Heer von Analphabeten. Wo während der Jahre der Kulturrevolution die meisten Schulen und Universitäten lange Zeit sogar gänzlich geschlossen waren. Wo Intellektuelle gedemütigt und in die Verbannung geschickt wurden. Wo Bildung schlichtweg verpönt war. Erst mit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik in China, die wir Deng Xiaoping verdanken, wurde endlich was für das Bildungswesen getan – dann aber umso mehr! Er hatte erkannt, wie wichtig die Bildung für die Entwicklung des Landes ist. Ich habe mir einen Satz aus einer seiner Reden 1985 gemerkt, der das klar belegt und mich sehr beeindruckt hat:
‚Die Stärke und das wirtschaftliche Wachstum unseres Landes sind zunehmend abhängig von der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Quantität und Qualität der Intellektuellen. Unter der Voraussetzung eines guten Bildungssystems kann China, ein Land mit einer Milliarde Menschen, enorme intellektuelle Ressourcen ausschöpfen, die kein anderes Land aufweisen kann’.
Er sollte recht behalten. Seit 1986 gibt es in China offiziell eine allgemeine Schulpflicht, wenn sich das in den ländlichen Provinzen auch nicht immer gleich flächendeckend durchsetzen ließ. Der Staat hat gewaltige Anstrengungen unternommen, um den Analphabetismus zu bekämpfen – nicht nur durch die reguläre Grundschulbildung der Kinder, sondern auch durch Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene, die ja einen riesigen Nachholbedarf hatten. Dafür wurden erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, die Lehrkräfte und die Ausbildungsprogramme gesteckt. Und es hat sich gelohnt, es hat sich ausgezahlt. Seitdem ist kolossal viel geschehen: China hat sich in diesen fast hundert Jahren vom armen, rückständigen Agrarland zur weltgrößten Wirtschaftsnation und zum führenden Technologietreiber entwickelt.“
Es trat ein Moment der Stille ein. Frau Li saß ganz aufrecht in ihrem Sessel und war sichtlich sehr stolz auf die Leistungen des chinesischen Volkes. Es klang nicht überheblich. Und es war mitnichten ihre Intention, ihr Gegenüber, Europa oder gar die ‚Westliche Welt’ insgesamt herabzusetzen. Nein, es war einfach nur der Stolz auf die eigene Leistung, chinesischer Nationalstolz. Es war Ausdruck des für China charakteristischen Patriotismus, der sich im Laufe dieser Jahrzehnte – gefördert von der chinesischen Regierung – immer stärker herausgebildet hatte.
Ellen spürte diesen Stolz, der aus jeder Äußerung, jeder Geste, jeder Mimik ihres Gegenübers unübersehbar herüberstrahlte. Der chinesische Patriotismus war ihr längst vertraut aus vielen anderen Begegnungen mit Chinesen und natürlich auch aus den Medien, und sie wußte ihn daher richtig einzuordnen. So registrierte sie ihn jetzt ohne irgendwelche Neidgefühle. Sie empfand auch keinerlei Abneigung. Warum auch? Warum sollten die Chinesen auf ihre enormen Leistungen nicht stolz sein? Und warum sollte man ihnen dafür nicht die gebührende Anerkennung zollen? Sie haben sie verdient, die Anerkennung! Es war eine ganz herausragende Leistung, dieses Milliardenvolk mit seinen verschiedenen, oft widerstrebenden Ethnien in so kurzem Zeitraum vom bettelarmen Habenichts zum Weltbesten zu entwickeln. Gewiß, sie haben immer noch keine wirklich demokratischen Verhältnisse. In einem totalitären Regime lassen sich die Dinge schneller bewegen, Entscheidungen schneller fällen und durchsetzen. Das geht häufig auf Kosten des Einzelnen, aber zum Nutzen des Ganzen. Soll man sie deshalb verdammen? Wäre China unter demokratischen Verhältnissen heute da, wo es jetzt steht? Existierte es überhaupt noch in dieser Form, oder wäre es nicht längst schon auseinandergefallen in verschiedene Teile – hätte es also nicht das gleiche Schicksal ereilt wie die ehemalige Sowjetunion?
Solcherlei Gedanken gingen Ellen durch den Kopf, während Frau Li sich im Gefühl des Stolzes sonnte. Aber es dauerte nicht lange, bis sich Ellen die Frage stellte: Wieso reden wir jetzt hier eigentlich über Stolz? Ich wollte doch lediglich etwas über das chinesische Schulsystem erfahren. Andererseits wollte sie aber auch nicht unhöflich erscheinen und abrupt das Thema wechseln. So suchte sie gerade noch nach einem geeigneten Übergang, als Chan sich wieder einschaltete.
„In diesem Kontext erinnere ich mich gerade an einen Satz, den ich damals, als ich ihn las, für merkenswert hielt, und den ich deshalb hier mal zum besten geben möchte. Er lautet:
‚Any country that wants to compete in the world economy needs a comprehensive education policy that includes spending on higher education, science and technology, and professional training’.
Dieser Satz steht im World Development Report 1992, herausgegeben von der Weltbank. So, wenn man diesen Satz zugrunde legt, dann kann man sagen: China hat seine Hausaufgaben gemacht.“
„Das will ich wohl meinen“, pflichtete Frau Li ihr sofort bei.
„Okay, that’s it!“ fuhr Chan fort. „Aber ich denke, Ihr wolltet Euch noch etwas über die unterschiedlichen Schulsysteme austauschen.“
Ellen ergriff sofort die sich bietende Gelegenheit: „Ja, richtig. Wenn Sie erlauben, Frau Li, ...“
Frau Li nickte.
„ . . . wie sieht es eigentlich mit Fremdsprachen in China aus?“
„Jeder Schüler lernt zwei Fremdsprachen. Die erste ist bei uns Englisch, das ist Pflichtfach für alle. Die zweite kann man wählen. Und da sieht es in der Praxis so aus, daß man etwa folgende Reihenfolge nach Häufigkeit aufstellen kann: Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch.“
„Interessant. Und wann fangen Sie mit den Fremdsprachen an?“
„Englisch bereits im Kindergarten; die zweite Fremdsprache im fünften Schuljahr.“
„Aha, das ist ja ähnlich wie bei uns. Und wie sieht so ein typischer Schultag aus? Sie fangen ja sehr früh morgens an; um 7.30 Uhr sagten Sie, glaube ich, vorhin?“
„Ja, das ist richtig. Aber der Unterricht beginnt erst um 8.00 Uhr. Wir nutzen die ersten 20 bis 30 Minuten für eine allmorgendliche Gymnastik mit anschließenden Konzentrationsübungen. So werden die Schüler optimal auf den Unterricht eingestimmt.“
„So etwas habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Da stehen alle Schüler in militärisch anmutender Ordnung aufgereiht auf dem Schulhof, abwechselnd eine Mädchen- und eine Jungenreihe in ihren verschiedenfarbigen Schuluniformen, und folgen den Anweisungen eines Lehrers.“
„Es mag etwas militärisch anmuten, ja. Aber ohne Ordnung und Disziplin geht es nicht. Wenn man da im Westen häufig von Drill spricht, dann verkennt man ganz einfach die Tatsache, daß ein zahlenmäßig so großes Volk wie das chinesische ohne Ordnung und Disziplin zwangsläufig im Chaos enden würde.“
„Das mag sein. Aber was ich da mal in einem Bericht gesehen habe, das sah schon sehr nach militärischem Zeremoniell aus.“
„Dann haben Sie vermutlich den Appell am Wochenbeginn gesehen. Wir pflegen in der Tat eine bestimmte Zeremonie, den Montagmorgenappell, bei dem alle Schüler auf dem Hof in Reih’ und Glied zum Hissen der Nationalflagge antreten müssen. Anschließend singen alle die chinesische Nationalhymne und der Schulleiter hält noch eine Ansprache. Auf diese Weise pflegen wir von klein auf unseren gesunden Nationalstolz, der unser Zusammengehörigkeitsgefühl als Nation stärkt und in uns neue Kräfte für neue Taten mobilisiert. Das ist eine sehr richtige und wichtige Einrichtung, die für die Entwicklung unserer Jugend zu verantwortungsvollen, gemeinschaftsdienlichen und heimatverbundenen Staatsbürgern in hohem Maße förderlich ist. Aber nochmal: Ja, es mutet in gewisser Weise militärisch an, wenn sie da in Reih’ und Glied antreten und strammstehen, die Fahne hissen und die Nationalhymne singen. Andernfalls jedoch, wenn sie wie ein Hühnerhaufen auf dem Schulhof ´rumständen, ginge die ganze Symbolik verloren und die beabsichtigte Wirkung der Handlung verpuffte total. ‚Militärisch’ bedeutet Ordnung und Disziplin zu halten, und genau das ist es, was wir in unserem großen Volk unbedingt brauchen, um nicht ins Chaos abzurutschen, wie ich vorhin schon erklärte. Deshalb ist es nicht verwerflich, wie man aus manchem westlichen Kommentar heraushören könnte, sondern absolut notwendig und richtig, die Einheit der Nation und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen mit geeigneten Maßnahmen zu fördern.“
Wieder trat ein Moment betretenen Schweigens ein. Ellen hatte offensichtlich noch mal in dieselbe Wunde getroffen, wenn auch unbeabsichtigt. Das mußte sie aus der etwas unwirschen Reaktion von Frau Li klar entnehmen. Nationalstolz und militärischer Drill waren offenbar Reizwörter für die Chinesen, die vielleicht ein bißchen zu häufig aus westlichem Munde strapaziert wurden. Sie fühlen sich anscheinend immer gleich in die Rolle eines Angeklagten gedrängt und glauben sich verteidigen zu müssen, wenn sie darauf angesprochen werden. Dabei sind ihre Beweggründe sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. So ein großes multi-ethnisches Staatsgebilde ist ein sehr fragiles Konstrukt, das leicht in sich zusammenfallen kann. Das hat schon die Sowjetunion erfahren müssen. Und selbst das sehr viel kleinere Jugoslawien brach unter Ausübung furchtbarer Grausamkeiten und Massenmorde sehr schnell zusammen, als die klammerbildende Staatsgewalt zu schwach wurde, um den Zusammenhalt zu gewährleisten. Man kann es den Chinesen gar nicht verdenken, wenn sie alles daran setzen, ihre staatliche Einheit unter allen Umständen zu erhalten und zu fördern, dachte sich Ellen. So gesehen haben sie bisher eigentlich alles richtig gemacht. Die Nation, der Staat, das Land und seine Bürger haben mehrheitlich davon profitiert. Die durch schnelle Entscheidungsprozesse forcierte dynamische Entwicklung hat das Land binnen kurzer Zeit an die Weltspitze katapultiert und seinen Bürgern Wohlstand gebracht. Eigentlich beneidenswert, diese Chinesen, dachte Ellen jetzt. Auch Europa würde es ganz guttun, wenn sich ein größeres Gemeinschaftsgefühl, so eine Art Europa-Patriotismus, herausbildete und die Gemeinsamkeiten stärker betont würden, anstatt immer noch mit 550 Millionen unterschiedlichen Zungen zu sprechen und sich über jeden Kleinkram end- und fruchtlose Debatten zu liefern.
„Ja, ich glaube auch, daß das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen für die Einheit einer Nation beziehungsweise einer Gesellschaft generell entscheidend ist und deshalb unbedingt gefördert und gepflegt werden sollte! . . . Was heißt sollte? Gepflegt werden muß!“, durchbrach Ellen, noch ganz in Gedanken versunken, unvermittelt die Stille. Und obwohl ihr dieser Gedanke nicht grundsätzlich neu war, kam es ihr in diesem Moment doch so vor, als hätte sie gerade eine ganz neue Erkenntnis gewonnen. Und – dachte sie sich – ich sollte mich dringend bemühen, solche Fragen oder Aussagen zu vermeiden, die auf diese Frau Li irgendwie provokativ wirken können.
Frau Li lächelte freundlich. Und auch Chan sah sie lächelnd an, während sie zu ihr sagte: „Vielleicht erzählst du jetzt mal etwas über euer Ausbildungssystem, Ellen?“
„Selbstverständlich, ja gern“, stimmte Ellen spontan zu. „Ich habe Sie ja wirklich lange genug gepeinigt mit meinen Fragen“, sagte sie Frau Li zugewandt.
„Ja, unser Schulsystem – und ich beschränke mich jetzt mal auf das staatliche System; die unterschiedlichen Privatschulen, die es auch noch gibt, lasse ich zunächst mal außer acht – ist im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr verbessert worden“, begann Ellen zu erzählen. „Wir hatten in Deutschland ja mal ein dreigliedriges Schulsystem, wie Sie wahrscheinlich wissen. Das ist Vergangenheit. Statt dessen gibt es – inzwischen europaweit! – nur noch ein einheitliches Ausbildungssystem mit gleichen Lehrplänen und Prüfungsverfahren – allerdings mit verschiedenen Leistungsstufen. Irgendwie müssen wir ja auch differenzieren, aber darauf komme ich später noch zurück. Die herkömmlichen Lehrpläne und -methoden wurden gründlich überarbeitet und an die heutigen Erfordernisse angepaßt. Der früher übliche Frontalunterricht ist weitgehend ersetzt durch interaktives Erarbeiten von Lösungen für interessante, lebensnahe Aufgabenstellungen. Die Lehrer können sich jedem einzelnen Schüler sehr viel intensiver widmen als früher, weil auch die Klassen sehr viel kleiner sind, und nicht zuletzt dadurch haben die Schüler jetzt eine hohe Motivation zum Lernen.
Sehr positiv wurde auch der bi-linguale Unterricht angenommen, das heißt, alle Fächer werden von der ersten bis zur letzten Klasse simultan in Englisch und der jeweiligen Landessprache unterrichtet, so daß man ohne Probleme von Polen nach Spanien oder von Finnland nach Griechenland ziehen kann. Denn Englisch versteht ja jeder, und als Ausländer kriegt man von der jeweiligen Landessprache auch gleich noch etwas mit. Daneben kann man selbstverständlich noch jede andere Sprache auf freiwilliger Basis in separatem Unterricht erlernen.“
Das europäische Schulsystem war in der Tat zu einem der besten der Welt geworden. Man konnte das schon rein äußerlich an der vorbildlichen Ausstattung der verschiedenen Ausbildungsanstalten, an dem breiten Spektrum des angebotenen Lernstoffs wie auch an der Zahl der Lehrkräfte erkennen. Aber das eigentlich Entscheidende war die Qualität der Ausbildung; die hatte sich gegenüber früheren Jahren dramatisch verbessert. Erziehung und Ausbildung waren endlich konsequent als allgemeine gesellschaftliche Verpflichtung und Aufgabe im Sinne der Zukunftssicherung dieser Gesellschaft wahrgenommen, und dieser hatten sich alle Mitglieder der Gesellschaft unterzuordnen. Und sie taten es gern, denn es brachte für alle nur Vorteile – für die Kinder, für die Eltern, für die Ausbilder, für die Arbeitgeber und für die Gesellschaft insgesamt.
Obwohl das neue Ausbildungssystem vom Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluß der Schule für jedes Kind kostenfrei war, hatte es bei dessen Einführung zunächst nicht unerhebliche Bedenken gegeben, die von verschiedenen Seiten geäußert worden waren. Deshalb hatte man sich darauf verständigt, vor einer flächendeckenden Einführung erst einmal einige, in verschiedenen Städten parallellaufende Pilotprojekte auf freiwilliger Basis zu starten, um damit Erfahrungen zu sammeln. Die Resonanz bei den Eltern war – für die Kritiker sehr überraschend – erstaunlich groß, denn es wurden viel mehr Kinder angemeldet als die Pilotprojekte aufnehmen konnten. Und das Vertrauen dieser Eltern in das neue System hat sich für sie ausgezahlt, denn es zeichnete sich schon nach der halben Durchlaufzeit des ersten Jahrganges ab, daß dieses Modell sehr erfolgversprechend war.
Dieses neue Modell berücksichtigte nun endlich, was man schon lange wußte, aber bis dato nicht umgesetzt hatte: Je früher die Kinder mit dem Lernen beginnen, desto besser, denn in den ersten Jahren haben sie die größte Aufnahmekapazität, lernen am schnellsten, und um so größer ist bei ihnen noch die synaptische Plastizität, das heißt, die Fähigkeit ihrer Nervenzellen, untereinander neue Verknüpfungen zu bilden. Folgerichtig ‚greift‘ dieses System bereits sehr früh: Mit Beginn des dritten Lebensjahres kommen alle Kinder in den Kindergarten. Dort wird nicht nur gespielt, sondern auch schon – spielerisch – gelernt und die Kreativität angeregt. Es ist eigentlich – in der Begriffswelt früherer Generationen – eine Kombination aus Kindergarten und Vorschule, und es soll durch eine kontinuierliche Schwerpunktverlagerung von spielerischen Anteilen zu Lerneinheiten einen möglichst fließenden Übergang zur Schule schaffen. In dieser Zeit sollen die Kinder bereits gelernt haben, sich muttersprachlich schon recht gut auszudrücken, einigermaßen zu lesen, zu schreiben und einfache Aufgaben zu lösen. Außerdem haben sie bereits Grundkenntnisse in der englischen Sprache erworben. Unabhängig davon entwickeln sie hier ganz beiläufig ein Gemeinschaftsgefühl und legen den Grundstock für ihre soziale Kompetenz.
„Ich weiß ja nicht, wie bei Euch in China die Kindergärten sind“, begann Ellen Eppelmann sich in fast schwärmerischer Weise über die hiesigen Kindergärten auszulassen, „aber bei uns hier sind diese Einrichtungen einfach phantastisch! Leider gab´s das in meiner Kindheit noch nicht in der Weise. Deshalb könnte ich richtig neidisch werden, wenn ich sehe, was die heutzutage dort schon mit den Kindern alles machen!“
„Erzähl’ doch mal!“ bat Chan. „Wir haben ja hier diese Erfahrung gar nicht machen können, weil unsere Kinder bereits aus dem Kindergartenalter raus waren, als wir hierher übersiedelten. Und Frau Li wird es sicher auch sehr interessieren.“
„Ja, natürlich! Das interessiert mich sehr“, pflichtete Frau Li ihr bei und sah Ellen erwartungsvoll an.
„Naja. Also, zunächst mal sind die Kinder dort den ganzen Tag über, genau gesagt von acht bis 16 Uhr, bestens aufgehoben, behütet und versorgt. Sie sind in kleine Gruppen von maximal zehn Kindern eingeteilt, so daß sich deren Betreuerinnen sehr viel intensiver als in früheren Zeiten um jedes einzelne Kind kümmern können, denn damals waren die Gruppen häufig dreimal so groß. Und diese Betreuerinnen sind alle bestens ausgebildet in Pädagogik, in Kinderpsychologie und weiß der Teufel, was noch alles. Jedenfalls haben die alle einen Hochschulabschluß. Da gibt´s ´ne eigene Fachrichtung für. Naja, was mich aber vor allem begeistert, ist die Tatsache, wie die mit den Kindern umgehen und wie die denen schon unglaublich vieles beibringen.“
„Ja, jetzt erzähl’ schon! Du machst einen ja wirklich ganz neugierig“, fuhr Chan ungeduldig dazwischen.
„Ja, ja! Ich bin ja schon dabei“, besänftigte Ellen sie. „Also, die arbeiten zum Beispiel sehr viel mit gelernten Komikern und Zauberern zusammen. Das hat mich regelrecht begeistert, wie ich das gesehen habe.“
„Haben Sie das denn selbst sehen können?“ wollte Frau Li wissen.
„Ja, natürlich. Die Eltern können zum einen im Kindergarten zuschauen, wie das da läuft – allerdings bei diesen Lernstunden, über die ich gleich rede, versteckt hinter einer Spiegelwand.“
„Wieso hinter einer Spiegelwand?“ wollte Frau Li wissen.
„Das macht man ganz bewußt, damit die Kinder sich nicht durch ihre Eltern beobachtet oder beeinflußt fühlen. Man hat die Erfahrung gemacht, daß sie dadurch abgelenkt sind und anders reagieren, als wenn die Eltern nicht anwesend sind. Die Eltern sind also in dem Moment gewissermaßen ein Störfaktor. Und so etwas möchte man möglichst vermeiden. . . . Ja, und die andere Möglichkeit ist, sich das zu Hause am Bildschirm anzuschauen, denn die machen ja Videoaufnahmen und stellen die ins WorldNet ein.“
„Ach, das ist ja interessant!“ zeigte sich Chan begeistert. „Dann könnte ich mir das also auch mal anschauen?“
„Hm, . . . ja und nein! Du könntest es dir bei den Eltern der Kindergartenkinder anschauen, wenn die dich lassen, selbstverständlich. Aber generell haben nur die sogenannten closed user groups Zugang zu diesen verschlüsselten Videos, also beispielsweise die Angehörigen, das Kindergartenpersonal und deren Vorgesetzte. Man will ganz einfach von vornherein vermeiden, daß irgend jemand auf die Idee kommen könnte, die damit übertragenen Informationen für kriminelle Zwecke zu mißbrauchen, verstehst du?“
„Ja, verstehe!“
„So, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist folgendes: Also, die Kindergruppe sitzt da im Raum und wartet schon ganz gespannt auf den ‚Engländer‘. Gespannt sind sie, weil ihre Betreuerin ihnen angekündigt hat, daß da ein Besucher aus England kommt, der überhaupt kein Deutsch versteht, der aber eigentlich ganz gern hier in Deutschland für eine Zeit leben möchte. Also, was ist zu tun? Die Kinder mußten nicht lange überlegen: Der muß halt Deutsch lernen! Ja, sagte die Betreuerin, aber wie soll er das machen? Er kennt doch hier niemanden, der ihm dabei helfen könnte. Sollen wir ihm dabei helfen? ‚Ja’, schrien alle Kinder. Also so ungefähr mußt du dir das vorstellen. Die Kinder werden vorgespannt, ihre Hilfsbereitschaft wird motiviert und sie werden in eine Rolle versetzt, in der nicht sie die Lernenden sind, sondern die ‚Besserwissenden‘. Deshalb sind sie schon ganz begierig, den Besuch endlich zu empfangen. Und dann kommt er – ein ausgebildeter Komiker, der es versteht, binnen kürzester Zeit die Herzen der Kinder zu erobern. Ich sage dir, selbst wir Eltern haben uns schlapp gelacht hinter dem Spiegel! Er spielt so ‘n bißchen den Tolpatschigen, weißt du, den Unbeholfenen. Und er spricht nur Englisch, natürlich ganz einfache Sachen, am Anfang vor allem solche Worte, die im Deutschen sehr ähnlich klingen, also zum Beispiel bei der Begrüßung: ‚Good morning‘! Ein Mädchen lacht und ruft: ‚Guten Morgen‘, heißt das! Der Engländer guckt erstaunt und versucht, es auf deutsch nachzusprechen. Natürlich verspricht er sich dabei gelegentlich und macht allerlei Späße, so daß die Kleinen immer was zu lachen haben. Die Betreuerin vermittelt immer dann, wenn die Kinder nicht selber drauf kommen, was es bedeuten soll. So spielen sich die beiden immer gegenseitig die Bälle zu und binden dabei die Kinder ein. ‚My name is Peter‘. Die Kinder verstanden sofort und riefen: ‚Der heißt Peter‘. ‚Ich heiße Bernd‘; ‚Ich heiße Julia‘; . . . riefen die Kinder durcheinander. Der Engländer tat so, als verstünde er gar nichts; spielte den Hilflosen. ‚Isch haiße . . . ???‘ stammelte er fragend in die Kinderrunde. ‚Er weiß nicht, was das bedeutet: Ich heiße . . .‘, hilft die Betreuerin nach. ‚Wißt ihr noch, wie er sich vorgestellt hat‘? fragt sie die Kinder. ‚Ja, er hat gesagt: My name is Peter‘, ruft wieder ein Mädel. ‚Ja genau! Und so müßt ihr ihm auch euren Namen sagen, dann versteht er euch‘, erklärt die Betreuerin, während der Engländer seine hilflose Rolle sehr amüsant weiterspielt. ‚My name is Julia‘, begann die erste. Und alle riefen ihre Namen durcheinander. Der Engländer machte durch unbeholfen wirkende Gesten deutlich, daß er vor lauter Lärm nichts verstand. Als es dann endlich etwas ruhiger geworden war, ging er nacheinander zu jedem Kind, gab ihm die Hand und sagte: ‚My name is Peter. What is your name‘? ‚Peter‘, antwortete der erste, der zufällig auch so hieß. ‚No, no‘! sagte der Engländer und schüttelte den Kopf: ‚My name is Peter‘! während er mit dem Finger auf sich zeigte. ‚What is your name‘? fragte er wieder und zeigte mit dem Finger auf Peter. ‚Peter‘, antwortete dieser noch einmal, und der Engländer schüttelte wieder den Kopf. ‚Your name‘! forderte er energischer und tippte mit dem Finger auf Peters Brust. Die Betreuerin half etwas nach: ‚Er denkt, du sprichst seinen Namen nach. Er weiß ja nicht, daß du auch Peter heißt. Sprich den ganzen Satz – so, wie sich der Engländer vorgestellt hat, dann versteht er dich besser‘. ‚My name is Peter‘, kam endlich die erlösende Antwort. Na ja, der Engländer trieb dann noch ein paar Späßchen des Erstaunens und der Verwechslungen, womit er alle Kinder immer wieder zum Lachen brachte, und machte dann seine Vorstellungsrunde. Die Kinder hatten kapiert und antworteten alle im Satz. . . . Es war wirklich lustig. . . . Oder ein anderes Beispiel: ‚I like dancing‘! Die Kinder überlegen, was er wohl meinen könnte. Wenn sie nicht drauf kommen, nimmt der Engländer plötzlich die Betreuerin bei der Hand, zieht sie nach vorn und tanzt ein bißchen mit ihr. Sofort haben die Kinder kapiert. Der meint Tanzen! Der Engländer sagt: ‚Yes, I like it‘! Die Betreuerin hilft: ‚Yes gleich ja; I like it – ich liebe es, ich mache es gern‘. Und so geht das immer weiter: ‚I like coffee‘; ‚I like tea‘. ‚I am happy‘; ‚I am hungry‘; und so weiter, und so weiter. Du glaubst nicht, wie begeistert die Kinder bei der Sache sind! Vor allem auch, weil alles so lustig ist, und weil der Engländer so viele Komik-Einlagen gibt. Sie merken gar nicht, daß sie selbst dabei lernen. Gegen Ende der Übung wiederholen sie alle zusammen noch einmal, was sie dem Engländer alles für deutsche Worte und Sätze beigebracht haben. Der spricht alles geduldig nach, und anschließend fragt er die Kinder: ‚Did you learn English a bit‘? Die Betreuerin hilft wieder ein bißchen, aber die Kinder haben schnell kapiert. Zu Hause erzählen sie ganz stolz: ‚Wir haben heute einem Engländer Deutsch beigebracht. Und ich habe dabei Englisch gelernt‘! Sie wollen jeden Tag mehr lernen und warten schon immer ganz ungeduldig auf den lustigen Engländer.“
„Das hört sich wirklich sehr interessant an“, bestätigte Chan.
„Oder ein anderes Beispiel“, fuhr Ellen fort, die jetzt erst richtig in Fahrt kam. „Wir haben dort einen Zauberer, der jede Menge kleine physikalische oder chemische Experimente macht, die die Kinder mit Verblüffung und großem Erstaunen verfolgen. Der Zauberer ist natürlich auch ein Komiker, der es versteht, die Kinder immer bei Laune zu halten. Auch hier sind er und die Betreuerin wieder ein eingespieltes Team. Häufig geht natürlich so ein Versuch erst mal daneben. Dann wird gerätselt, was da wohl passiert sein könnte – und was eigentlich hätte passieren sollen. Warum manche Körper schwimmen und andere untergehen und warum das so ist. Warum manche Luftballons aufsteigen und andere nicht. Warum Flugzeuge fliegen und Autos nicht. Und so weiter und so weiter. Und immer wird sehr anschaulich erklärt. Die Kinder verfolgen das mit Leidenschaft!“
„Das glaube ich sofort! Denn Emotionen sind sehr wichtig fürs Lernen. Sie beeinflussen unser Unterbewußtsein, und dies wiederum beeinflußt den Lernprozeß. Fühlen wir uns wohl, sind wir positiv gestimmt, dann können wir etwas Neues viel besser aufnehmen und das Gelernte auch viel besser behalten als wenn wir schlechtgelaunt oder sogar im Streß wären. Deshalb ist auch die Lernumgebung, die Atmosphäre, in der wir uns befinden, so wichtig für die Motivation, die Lernbereitschaft und die Leistungsfähigkeit. Wenn man also das Interesse der Kinder auf so eine nette, lustige Art wecken kann, wie du das gerade beschrieben hast, dann ist der Erfolg ja schon vorprogrammiert!“ pflichtete Chan spontan bei.
„Ja, und auch das Schreiben und Rechnen wird ihnen auf ähnlich lustige und spielerische Weise beigebracht. Natürlich alles immer nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten beziehungsweise Fähigkeiten, und schon gar nicht unter Ausübung eines Leistungsdrucks, denn man darf sie ja auch nicht überfordern. Aber ihr natürlicher Wissensdrang soll jedenfalls gestillt werden. Und der ist ja bekanntlich groß. Wenn man sich nur vergegenwärtigt, wie sie einen in dem Alter mit Tausenden von Fragen manchmal richtig löchern können! Da soll keine Frage unbeantwortet bleiben. Das ist natürlich eine ziemlich große Herausforderung für die Ausbilder. Deshalb ist es so wichtig, daß diese Ausbilder selber über eine sehr gute Ausbildung verfügen – in fachlicher Hinsicht wie selbstverständlich auch in Kinderpsychologie und Pädagogik. Sie müssen im Grunde alle Fragen des Lebens, die Kinder in diesem Alter stellen, beantworten können – und zwar in der Weise, daß die Kinder es verstehen können, in der Sprache der Kinder. Das ist wirklich nicht einfach. Deshalb gibt es hier inzwischen auch schon seit ein paar Jahren Spezialisierungen im Ausbildungsgang, weil einer allein gar nicht alle fachlichen Bereiche mehr abdecken kann. So ist zum Beispiel ein Studiengang mehr naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtet, ein anderer mehr biologisch-ökologisch. Die Kinder haben ja auch Fragen zu ihrer Umwelt und zu Naturphänomenen. Warum ist der Himmel heute blau und morgen grau? Warum scheint heute die Sonne und morgen regnets? Was ist eigentlich Schnee? Warum ist es nachts dunkel? Wo versteckt sich die Sonne? Was sind Mond und Sterne? Warum verlieren die Bäume im Winter ihre Blätter? Nicht jedes Kind stellt all diese Fragen von sich aus, hört aber trotzdem aufmerksam zu, wenn sie erklärt werden. So kann man Interesse durch einen äußeren Anstoß auch erst wecken. Wichtig ist die Anschauung; rein theoretische Erklärungen sind in diesem Alter nicht angebracht. Deshalb werden zum Beispiel Naturphänomene dann erklärt, wenn sie gerade zu sehen sind. Außerdem machen sie Exkursionen in den botanischen Garten, wo sie sehr viel über die unterschiedlichen Pflanzen, Sträucher und Bäume, über ihre Blatt- und Wuchsformen, über ihre Blüten und Samen und so weiter per eigene Anschauung erfahren. Am Teich erfahren sie etwas über Wasserpflanzen, Fische und Frösche. Die unterschiedlichen Tiere und deren Eigenheiten lernen sie beim Besuch auf dem Bauernhof oder im Zoo kennen.“
„Ihr habt doch gar keinen Zoo in Ulm!“
„Nein, jedenfalls keinen richtig großen, aber die machen dann einen Tagesausflug mit dem Bus oder der Bahn nach Stuttgart oder München.“
„Ist ja wirklich toll, was ihr für eure Kleinen alles tut!“ staunte Chan. „Ein richtig interessantes und abwechslungsreiches Programm – und alles kostenfrei. Wirklich toll!“
„Ja, das leisten wir uns für unseren Nachwuchs! Nicht umsonst haben wir seit geraumer Zeit ein so hohes Bildungsniveau!“
„Ein hohes Bildungsniveau haben wir in China auch, wie ich vorhin schon sagte“, entgegnete Frau Li.
„Allerdings“, wandte Chan ein, „ist das ganze System bei uns doch stärker ‚verschult‘, denke ich. Nicht so spielerisch, locker, lustig, was ich sehr schade finde. Aber die Kinder spüren bei uns von klein auf, daß sie selbst im eigenen Land eine riesige Konkurrenz haben und daß sie sich schon deshalb unheimlich ins Zeug legen müssen, um sich später behaupten zu können. Deshalb büffeln sie gnadenlos! Das ist natürlich sehr viel stressiger als du es gerade geschildert hast, aber im Endeffekt erreichen sie auch alle ein sehr hohes Bildungsniveau.“
„Das glaube ich, ja. Eine starke Konkurrenz ist natürlich auch eine sehr starke Motivation!“ bestätigte Ellen. „Aber ich bin sehr froh, daß man bei uns inzwischen einen sehr viel angenehmeren Weg zum Erfolg gefunden hat. Denn der ist erstens wirklich aus eigenem Antrieb motiviert, aber streßfrei für die Kinder, und zweitens sicher auch dauerhafter. Das glaube ich jedenfalls. Und das hast du ja im Grunde gerade selber bestätigt. Ob das mit dem Konkurrenzgedanken auf längere Sicht auch immer so funktioniert, da habe ich gewisse Bedenken.“
Frau Li zog die Stirn kraus, äußerte sich aber nicht dazu.
Mit Beginn des fünften Lebensjahres wechseln die Kinder in die Schule über, die in Halb-Jahrgangsstufen gegliedert ist. Man hatte nämlich früh der Tatsache Rechnung getragen, daß ein Altersunterschied von einem Jahr innerhalb einer Jahrgangsstufe gerade in der kindlichen Entwicklungszeit eigentlich zu groß ist, und deshalb eine halbjährliche Staffelung eingeführt. Feste Klassenverbände im herkömmlichen Sinne gibt es nicht mehr. Statt dessen wird in kleinen Gruppen von maximal 15 Schülern unterrichtet, die nach Leistung zusammengestellt werden. Dabei sind für jedes Unterrichtsfach üblicherweise drei Leistungsklassen abgestuften Schwierigkeitsgrades und unterschiedlich schnellen Vorgehens im Lernstoff definiert. Die Schüler werden je nach Leistung in dem betreffenden Fach in eine dieser Gruppen eingeteilt. Sie können demnach – und das ist sogar der Normalfall – in den verschiedenen Fächern jeweils in ganz unterschiedlichen Leistungsgruppen sein. Diese Zuordnung unterliegt der ständigen Kontrolle der jeweiligen Ausbilder und wird entsprechend dynamisch gehandhabt. So kann ein Schüler im Laufe seiner Schulzeit – je nach Leistung in dem jeweiligen Unterrichtsfach – mehrfach in höhere oder in niedrigere Leistungsklassen je Unterrichtsfach umgesetzt werden – auch unterjährig. Weil diese Umsetzungen zur alltäglichen, gewohnten Praxis gehören, werden sie von den Schülern auch nicht als besondere ‚Herausstellung‘ in der einen oder anderen Weise empfunden, also auch die ‚Rückstufung‘ in eine leistungsschwächere Gruppe wird nicht als Makel empfunden. Aber – und das ist der eigentliche Vorteil dieser Methode – der betreffende, ‚zurückgestufte‘ Schüler selbst bekommt die große Chance, in dieser Gruppe mit etwas geringeren Anforderungen und etwas langsamerem Vorgehen im Stoff besser mitzukommen, das heißt, besser zu lernen und wieder Erfolg zu haben. Umgekehrt profitiert die andere Gruppe davon, daß er sie beim zügigeren Vorgehen nicht mehr aufhält, dort also auch nicht mehr stört. Beide Seiten profitieren davon – eine klassische win-win-situation. Jeder wird seiner Leistungsfähigkeit entsprechend gefordert und gefördert, keiner fühlt sich über- oder unterfordert. Die persönlichen Stärken eines jeden Einzelnen kommen frühzeitig zur Geltung und können weiter gefördert werden, ohne daß dadurch die anderen Themen völlig vernachlässigt würden. Im Gegenteil, auch dort kann jeder seine Erfolge haben – eben auf niedrigerem Niveau. Und das ist ja völlig normal, niemand kann auf allen Gebieten gleich gut sein. Der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Schüler wird man durch die große Zahl gut aufeinander abgestimmter Kurse, die die erforderliche Leistungsbandbreite ganz abdecken, gerecht. Ein ‚Sitzenbleiben‘ gibt es jedenfalls nicht mehr, aber auch keine ‚Überflieger‘. Jeder Schüler macht nach zwölf Schuljahren ausnahmslos seinen Abschluß. Schüler, die auch im leistungsschwächsten Kurs noch Probleme haben, bekommen ‚Privatstunden‘, in denen ein Lehrer sich ihrer ganz persönlich annimmt, um intensiver auf ihre individuellen Schwierigkeiten eingehen und diese überwinden zu können. Es gibt aber auch eine Reihe von Fächern, die man abwählen kann. Denn warum sollte man die Schüler zu etwas zwingen, an dem sie partout kein Interesse und damit auch keine Lernbereitschaft zeigen? In ähnlicher Weise werden solche Schüler, die selbst im leistungsstärksten Kurs noch unterfordert scheinen, durch zusätzliche Aufgabenstellungen im Einzelunterricht individuell gefördert.
Fördern und fordern im richtig verstandenen Sinne – das ist das A und O für optimales und lebenslanges Lernen. Diese Erkenntnis ist endlich erfolgreich umgesetzt worden, fand Eingang in die moderne Lehrmethodik. Und deshalb ist Lernen heute kein passiver Vorgang in Form von ‚Einpauken‘ mehr, sondern das aktive und zum Teil interaktive Lösen von immer neuen Aufgabenstellungen mit Praxisbezug. Jeder Mensch braucht Leistungsanreize, braucht immer wieder neue Herausforderungen, an denen er sich messen kann. Denn mit jeder Aufgabe, die er erfolgreich bewältigt hat, wächst seine Persönlichkeit; läßt ihn sein Belohnungssystem im Gehirn Stolz empfinden. Es stärkt sein Selbstbewußtsein, weckt seine Neugier auf neue Aufgaben und regt seine Kreativität an.
Das ‚Benotungssystem‘ hat sich zwangsläufig auch geändert, weil zwar alle Schüler gleichermaßen für zwölf Jahre in der Schulausbildung sind, aber nicht alle die gleiche Stoffmenge in dieser Zeit bewältigt haben. Sechs Noten reichen da zur Differenzierung überhaupt nicht mehr aus, sind auch nicht aussagekräftig genug bezüglich der Stärken und Schwächen eines Schülers im einzelnen. Daher sind für jeden Kurs entsprechende Lernziele und die Erfüllungskriterien für das Erreichen dieser Ziele – mit bestimmten Abstufungen – genau definiert. Diesen Abstufungen entsprechend sind dann auch die Beurteilungsformulierungen verbal festgelegt. Ungeachtet dessen werden aber zusätzlich noch die herkömmlichen Noten in Klammern angegeben, weil sie gleich auf den ersten, flüchtigen Blick eine grobe, aber gewohnte Einordnung der Schülerleistung sowie deren Vergleich mit denen der Klassenkameraden ermöglichen. Die Schüler selbst vergleichen sich gern und permanent mit anderen, nicht nur ihre Leistungen, sondern auch ihre Vorstellungen und Ansichten, ihre Geschmäcker und Wünsche. Vergleich ist ein unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens, also auch des Schülerlebens. Insofern war es richtig, nicht der verschiedentlich unter der Parole ‚Ermutigung statt Notenschock!‘ geäußerten Forderung nach Abschaffung der Ziffernnoten nachzukommen. Man hat einen guten Kompromiß gefunden.
So ein adaptives Ausbildungssystem ist schon deshalb notwendig, weil die Leistungsfähigkeit nun mal generell, selbst bei Chancengleichheit, individuell verschieden ist, und weil zum anderen auch die Entwicklung der Heranwachsenden sowohl im Vergleich zueinander als auch bei jedem Einzelnen über die Zeit betrachtet sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Dieses System funktioniert aber erst, seit es die kleinen Lerngruppen und entsprechend viele Ausbilder gibt, seine immensen Erfolge haben sich allerdings schon nach sehr kurzer Zeit klar herausgestellt.
Es gibt nicht nur mehr Kurse und Ausbilder, auch die Ausbildung der Ausbilder selber ist wesentlich verbessert worden. Sie müssen grundsätzlich ein Hochschulstudium absolvieren, das neben der gewählten fachlichen Ausrichtung insbesondere auch Seminare in Pädagogik, in Psychologie, in der Vermittlung von Sozialkompetenz, in der Behandlung von beziehungsweise im Umgang mit Konfliktfällen, in der Motivation von Schülern, in der Erziehungsmethodik und in der Didaktik umfaßt.
Die Ausbilder sind keine Beamten, und sie sind auch nicht auf Lebenszeit angestellt. Für sie gilt das Leistungsprinzip wie für alle anderen, denn auch Lehrer brauchen Leistungsanreize, damit sie nicht mit der Zeit abstumpfen und gleichgültig werden. Ihre Dienstverträge gelten immer nur für ein Schuljahr, werden aber bei Bewährung um jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Es gibt auch kein Einheitsgehalt für sie. Vielmehr sind ihre Befähigung und ihr Engagement ausschlaggebend für die Bezahlung. Je besser die Unterrichtsgestaltung, je mehr Stunden und je größer der Einsatz in zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise Individualbetreuung, Pausenaufsicht, Hobbystunden, Diskussionszirkel, Sport- und Spielstunden, Exkursionen, et cetera, desto mehr zahlt sich dies für den Betreffenden aus. Art und Umfang ihres Engagements können die Ausbilder für jedes Jahr von neuem selber bestimmen; es wird dann vertraglich für das jeweilige Jahr festgeschrieben.
Da alle Unterrichtsräume video-überwacht sind und alles fortlaufend aufgezeichnet wird, besteht die Möglichkeit, einzelne Szenen, Unterrichtsstunden oder auch bestimmte Entwicklungen einen Lehrer oder Schüler betreffend über einen bestimmten Zeitraum gezielt zur nachträglichen Beobachtung auszuwählen und für Beurteilungen heranzuziehen. Diese Maßnahme dient somit auch als zusätzlicher Leistungsanreiz für Schüler und Lehrer: Die Schüler benehmen sich anständig, weil ihnen im Bedarfsfall jede ‚Sünde‘ nachgewiesen werden kann, und die Lehrer haben den Ansporn, guten Unterricht zu machen, weil sie andernfalls Gefahr liefen, ihren Vertrag nicht verlängert zu bekommen.
Das war nicht einfach durchzusetzen, die Lehrer haben sich lange vehement dagegen gesträubt, Einblicke von außen in die gewohnte Autonomie ihres Unterrichts zulassen und sich gegebenenfalls der Kritik anderer aussetzen zu müssen. Während sie ihr Berufsleben lang Urteile über andere fällten, also routiniert mit der Kritik an der Arbeit anderer umzugehen gewohnt waren, hatten sie nie gelernt, mit Kritik an der eigenen Person oder an ihrem Unterricht umzugehen – weder in der Ausbildung noch im Beruf. Und da es – anders als in anderen Berufen – keine einheitlichen Standards für den Lehrerberuf gab, fehlten ihnen schlicht und einfach auch die Maßstäbe für ihre Leistung, was sie zusätzlich verunsicherte. Kritik empfanden sie als etwas Negatives, selbst wenn diese eigentlich konstruktiv gemeint war. So wuchs über die Jahre das Unbehagen der Schüler darüber, täglich von Menschen bewertet zu werden, deren eigene Leistung sich jeglicher Kontrolle entzog, während sie selbst sich in ihrer Meinungsäußerung unterdrückt sahen. Auf der anderen Seite war mit der Einführung des Leistungsprinzips im Ausbildungsbetrieb Transparenz eine unabdingbare Voraussetzung geworden, der sich auch die Ausbilder nicht entziehen konnten. An den Schulen wurde eine offene Feedback-Kultur eingeführt, die den Schülern seither die Möglichkeit gibt, ihre Lehrer zu beurteilen. Und auf der anderen Seite gibt es die erwähnte Videoaufzeichnung des Unterrichts für Kontrollzwecke in bestimmten Fällen.
Die staatliche Schulaufsicht gibt keine detaillierten Lehrpläne vor, sondern lediglich Lernziele, die von den Lehrern erreicht werden müssen – wie, das bleibt im wesentlichen ihrem Gestaltungsspielraum überlassen.
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt nicht mehr in der reinen Wissensvermittlung, und schon gar nicht in Form von überwiegend frontaler Ansprache, sondern vielmehr in der praktischen Anleitung zum richtigen Lernen und dem Finden bestimmter Informationen durch gemeinsames, interaktives ‚Erarbeiten‘ von Wissen in der Gruppe, im Wecken von vielseitigen Interessen und dem Schaffen entsprechender Anreize, in der Förderung der Kreativität und der analytischen Denkweise, in der Förderung selbständigen Denkens und Handelns sowie in der Prägung von sozialem und verantwortungsbewußtem Verhalten in der Gemeinschaft, von Teamfähigkeit. Die Schüler bekommen natürlich in jedem Fach ein gewisses ‚Grundgerüst‘ an Wissen, das nötig ist, um eigene Interessensgebiete zu entdecken und zu erschließen, so daß es ihnen möglich ist, sich weiteres Wissen dazu eigenständig zu erarbeiten. Aber gerade dieses selbständige Erarbeiten und die dazu geeigneten Vorgehensweisen bilden den eigentlichen Schwerpunkt der Ausbildung. Reines Auswendiglernen von Fakten, insbesondere vor Prüfungen, das ist Vergangenheit.
Besonderer Wert wird auch auf die Fähigkeit zur Konzentration gelegt, die effizientes Lernen und Arbeiten überhaupt erst ermöglicht. Folgerichtig gehören tägliche Konzentrationsübungen zum festen Trainingsprogramm. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, daß sich die meisten Menschen frühestens nach 15 Minuten so konzentrieren können, wie es viele Aufgaben verlangen. Diese Viertelstunde braucht das Gehirn, um alle Informationen zu ordnen. Mit jeder neuen Unterbrechung gehen alle Daten wieder verloren. Ablenkungen während des Lernprozesses schränken zudem die Merkfähigkeit ein.
Das in der schnellebigen Zeit weitverbreitete Bestreben, möglichst viele Dinge gleichzeitig machen zu wollen, hat sich daher in der Praxis nicht bewährt. Dieses sogenannte Multitasking bedeutet häufiges Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Informationen, Aufgaben, Themen, Problemen in kurzen Abständen, und dies erfordert die Teilung der Aufmerksamkeit beziehungsweise eine Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne. Da aber niemandem mehr als 100 Prozent Aufmerksamkeit zur Verfügung stehen, werden die einzelnen Aufgaben zwangsläufig weniger effizient ausgeführt, das heißt langsamer, weniger gut und fehlerbehaftet: Der ständige Wechsel zwischen mehreren Aufgaben impliziert für das Gehirn nämlich Streß, und der beeinträchtigt gerade die Hirnareale, die zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden und unsere Leistungen auf die einzelnen Aufgaben sinnvoll verteilen können – was dazu führt, daß man nur noch impulsiv und aktionistisch reagiert, anstatt zu überlegen und bewußt zu agieren. Die Folge sind Fehler und falsche Entscheidungen. Außerdem kostet es zusätzliche Energie und macht daher schneller müde.
„Wie schon gesagt“, fuhr Ellen fort, „die früher üblichen unterschiedlichen Schulsysteme und Schultypen gibt es längst nicht mehr. Es gibt nur noch einen – wohlgemerkt: staatlichen! – Schultyp, die Ganztagsschule von 8.00 bis 16.00 Uhr für ausnahmslos alle Schüler vom fünften bis zum 17. Lebensjahr – also für alle, die nicht eine private Schuleinrichtung besuchen. Jeder Bürger hat bei uns ein Recht auf Bildung, einen Anspruch auf Ausbildung. Und dabei hat er die freie Auswahl zwischen dem staatlichen System und den diversen privaten Einrichtungen. Bei dem staatlichen System, über das wir hier sprechen, findet keine Selektion der Schüler nach Leistung mehr statt im Sinne von Sitzenbleiben oder Aussortieren auf eine andere Schule, wie das früher besonders in Deutschland der Fall war. Die Schüler bleiben in ihrer Jahrgangsgemeinschaft über die zwölf Jahre integriert, aber sie können unterschiedliche Fächer wählen und unterschiedlich starken und schnellen Leistungsgruppen angehören. Das klassische Spektrum an Unterrichtsfächern ist erheblich ausgedehnt worden. Es erstreckt sich so ziemlich über alle Lebensbereiche, so daß viele Schüler hier bereits den Einstieg in ihre spätere berufliche Ausrichtung finden.
Neben den lernbetonten Leistungsgruppen gibt es zahlreiche Sport-, Spiel-, musische, künstlerische und handwerkliche Gruppen, häufig als ‚Hobbygruppen’ bezeichnet, die – wie der Name schon sagt – der gemeinschaftlichen Pflege bestimmter Hobbys unter Anleitung eines Ausbilders und gleichzeitig aber auch der notwendigen Entspannung zwischen den Lerneinheiten dienen. Wie überhaupt das Tagespensum sehr abwechslungsreich gestaltet ist. Das fängt schon damit an, daß die erste Stunde am Morgen grundsätzlich eine Hobby- oder Spielstunde ist, die jeder Schüler selbst auswählen kann. Damit kommt man ganz bewußt den sogenannten Morgenmuffeln entgegen, die sich um acht Uhr noch nicht ausgeschlafen genug fühlen, um sich schon auf Lernstoffe konzentrieren zu können. Es hat sich gezeigt, daß die Schüler diesen lockeren Einstieg in das neue Tageslernprogramm, diese interessanten, geselligen und oft genug auch amüsanten Stunden ungern verpassen wollen. Ab neun Uhr geht das Lernprogramm dann aber für alle verbindlich los. Von zwölf bis ein Uhr ist Mittagspause, da nehmen Schüler und Lehrer gemeinsam und kostenfrei ihr Mittagessen in der Schulkantine ein.“
„Mit Ihrer Hobbystunde verfolgen Sie offenbar das gleiche Ziel wie wir mit unserer gemeinsamen Morgengymnastik“, vermutete Frau Li.
„Im Prinzip, ja, sieht so aus“, erwiderte Ellen. „Aber so eine gemeinsame Morgengymnastik ließe sich bei uns hier in Europa nicht durchsetzen.“
„Bei uns ist es Tradition seit Urzeiten. Wenn Sie frühmorgens durch einen Park gehen, können Sie überall tanzende Menschen sehen oder solche, die ihre TaiChi- oder QiGong-Übungen machen. Das ist unter anderem auch ein Teil ihrer Gesundheitsvorsorge. Insofern ist das auch für die Kinder nichts Ungewöhnliches oder Neues; sie sind es schlichtweg gewöhnt von klein auf.“
„Schön für Sie, wirklich. Da haben Sie uns gegenüber schon einen Vorteil.“
„Und die Mittagspause ist bei uns zwei Stunden, damit die Kinder in Ruhe essen und sich anschließend noch etwas ausruhen können“, sagte Frau Li.
„Bei uns, wie gesagt, nur eine. Aber dafür ist die erste Stunde nach der Mittagspause wieder eine ‚Hobbystunde’ ohne Anspruch auf hochgeistige Konzentration“, antwortete Ellen und fuhr dann mit ihrer Erzählung fort:
„Die Vielfalt sowohl an Leistungs- als auch an Hobbykursen ist sehr groß, so daß die Orientierung für die Schüler zunächst nicht einfach ist, insbesondere bei denen – und das sind mit Abstand die meisten –, die noch gar keine Präferenzen haben. Deshalb beginnen alle Schulanfänger grundsätzlich erst einmal mit den sogenannten Pflichtkursen, zu denen neben der Muttersprache und Mathematik auch die erste Fremdsprache Englisch vom ersten Jahr an gehört. Sie haben aber von Anfang an die Möglichkeit, darüber hinaus weitere, frei gewählte Kurse zu besuchen. Außerdem sind alle Ausbilder gehalten, den Schülern möglichst viele Anregungen zu geben, deren Resonanz – sprich: Interessen – zu erforschen und ihnen dann konkrete Empfehlungen für weitere Fächerbelegungen zu geben. Auf diese Weise werden vielerlei Interessen geweckt; die Schule ist spannend und wird nicht als lästiges Übel empfunden. Die Bereitwilligkeit zum Lernen ist einfach da, und so gibt es auch für die Ausbilder eine größere Befriedigung und weiteren Ansporn, den Unterricht interessant zu gestalten.“
Frau Li schaute ein wenig nachdenklich drein. Vermutlich vollzog sie gedanklich Vergleiche zwischen dem gerade von Ellen Gehörten und den entsprechenden chinesischen Verhältnissen. Ellen machte deshalb eine kurze Pause bis sie feststellte, daß Frau Li wieder ihren Blick auf sie gerichtet hatte. Dann fuhr sie fort:
„Ein nicht unerheblicher Teil der Ausbildung findet am Computer statt. Das hat sehr große Vorteile: Der Lehrer muß nicht mehr mühsam alles an die Tafel schreiben, und die Schüler müssen nicht mehr dessen ‚Gekritzel’ zu entziffern versuchen. Sie müssen auch nicht mehr mit- beziehungsweise von der Tafel abschreiben, sie können sich voll und ganz auf das Gesprochene und die dazu mitgelieferte, anschauliche Bildschirmpräsentation konzentrieren. Sie können diese auch zu jedem späteren Zeitpunkt wieder aus dem Speicher abrufen und erneut durcharbeiten. Insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern ist der Computer eine sehr große Hilfe. So sind zum Beispiel chemische oder physikalische Versuche hervorragend nach didaktischen Gesichtspunkten aufbereitet und dargestellt. Aber auch im Bereich der Biologie, der Erdkunde, der Mathematik, der Geschichte und in anderen Fächern ist der Lehrstoff sehr anschaulich aufbereitet.
Jeder Schüler verfügt über einen tragbaren persönlichen Computer mit Sprach-Ein-/Ausgabe und integrierter Kamera und ist via Funkverbindung und WorldNet mit dem Schul-Computer vernetzt. Auch der Lehrer hat damit die Möglichkeit, Einzelverbindungen zu einem bestimmten Schüler oder sogenannte Konferenzverbindungen zu mehreren oder zu allen Schülern der Gruppe zu schalten. Diese Fähigkeit wird systematisch von Zeit zu Zeit zum interaktiven Fernunterricht genutzt, um auch mit dieser, im späteren Berufsleben sehr häufig angewendeten Arbeitsmethode Erfahrung zu sammeln. Und im Falle einer Erkrankung hat der Schüler damit die Möglichkeit, dem Unterricht trotzdem – vom Krankenbett aus – zu folgen.“
„Ist das auch in closed user groups bezüglich der Zugriffsrechte organisiert?“ wollte Frau Li wissen.
„Ja, natürlich“, antwortete Ellen. „Das ist eigentlich heutzutage generell der Fall, es sei denn, es handelt sich um Informationen von allgemeinem Interesse. Also, mit der heutigen Organisation und Funktion des WorldNet können wir wirklich alle sehr zufrieden sein. Das hat sich sehr gut entwickelt.“
„Das finde ich auch“, bestätigte Chan.
„Um noch mal auf die Unterrichtsstunden in der Schule zurückzukommen“, erzählte Ellen weiter, „so dienen die aber vor allem auch dem persönlichen Kennenlernen und der Kontaktpflege, dem Erwerben der sogenannten Sozialkompetenz, dem Training von Teamwork und der Bedeutung von Gruppendynamik, dem Erlernen von Vortragstechniken sowie der intensiven Diskussion bestimmter Fachthemen. Dieser Thematik wird – seiner herausragenden Bedeutung entsprechend – ein vergleichsweise großer Teil der Ausbildungszeit gewidmet. Die Welt ist so komplex geworden, die Informationsflut dermaßen groß und die Veränderungsgeschwindigkeit so rasant, daß ein Einzelner hier schnell auf sehr verlorenem Posten steht. Die Gesamtheit als Gemeinschaft ist gefordert.“
„Sehr richtig“, kommentierte Frau Li.
„Das ‚Pauken‘ früherer Jahre gibt’s nicht mehr“, erzählte Ellen weiter. „Die ganze Lehrmethodik ist darauf abgestellt, den Schülern selbständiges, logisches Denken und Handeln beizubringen, Zusammenhänge aufzuzeigen, Informationsquellen zu finden und richtig zu nutzen. Faktenwissen wird nicht mehr abgefragt. Man hat erkannt, daß es keinen Sinn macht, die Schüler mit Fakten ‚vollzustopfen‘, die sie nach der Prüfung meist doch nicht mehr brauchen und deshalb sehr schnell wieder vergessen. Viel wichtiger ist, zu wissen, wo man die Informationen findet, die man gerade braucht, und entsprechend schnell – zum Beispiel über das WorldNet – auf diese zugreifen zu können. Des weiteren ist wichtig, diese Informationen richtig zu verstehen, sie zu plausibilisieren und in den Gesamtkontext einordnen zu können. Genau das ist es, was die Schüler heute in jedem Fach lernen. Auch das Abfragen von Vokabeln in den Fremdsprachen gibt’s nicht mehr. Der Lehrer führt Gespräche – auch über den Computer – mit dem Schüler in der betreffenden Fremdsprache und erkennt so am besten die jeweiligen Stärken und Schwächen. Das Ziel ist das Verstehen der Fremdsprache und deren Beherrschung in Wort und Schrift. Dabei ist es irrelevant, ob der Schüler die eine oder andere Vokabel auswendig kennt. Das hört sich jetzt banal an, aber es hat unendlich lange gedauert, bis sich das in allen Köpfen durchgesetzt hat.“
„Hmm, glaube ich“, bemerkte Chan lakonisch.
„Und nur dadurch, daß die sture Paukerei abgeschafft ist, haben die Schüler ja überhaupt erst den Kopf frei für die heutzutage wesentlich umfangreicheren Wissensgebiete, können den größeren Anforderungen unserer Wissensgesellschaft eher gerecht werden und ihre Interessen viel besser entfalten.“
„Das sehe ich auch so“, stimmte Chan zu. „Man muß mit seinen begrenzten kognitiven Fähigkeiten sehr rationell umgehen, wenn man in der heutigen Leistungsgesellschaft bestehen will.“
„Genau. Man darf sich keinen unnützen Ballast aufladen. Aber, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen: Wir haben weitere Schwerpunkte in der Ausbildung. Da sind beispielsweise Exkursionen und andere Gemeinschaftsunternehmungen zur Vertiefung der Sozialkontakte, Besichtigungsprogramme mit – dem ‚Intellekt’ der jeweiligen Gruppe entsprechend angepaßten – ausführlichen und anschaulichen Erläuterungen zum Erschließen neuer Wissensfelder sowie zum frühzeitigen Kennenlernen ‚der Praxis’, das heißt, bestimmter Berufsbilder, Firmen, Behörden, sozialer Einrichtungen, Vereine, et cetera, aber auch – in etwas fortgeschrittenerem Alter – mehrwöchige Praktika zum intensiveren Kennenlernen. Sie dienen vor allem auch der Orientierung und möglichen beruflichen Ausrichtung. Ein besonderes Anliegen der Ausbildungsinstitution ist in diesem Zusammenhang, daß die Schüler bereits frühzeitig mit den wesentlichen Voraussetzungen, Regeln und Methoden einer späteren Existenzgründung vertraut gemacht werden. Und das ist gerade deshalb so wichtig, weil ein großer Teil von ihnen später tatsächlich selbständige Unternehmer werden, nur vergleichsweise wenige sind in einer festen Anstellung beschäftigt.“
„Ja, das ist mir auch schon aufgefallen“, bestätigte Chan, „daß es hier sehr viele Selbständige, Klein- und Mittelstandsunternehmen gibt.“
„Ich denke, das war eine zwangsläufige Entwicklung“, erklärte Ellen. „Seit die Automatisierung und Roboterisierung in der Industrie und vielen anderen Bereichen soweit fortgeschritten ist, sind immer mehr Arbeitsplätze für Menschen verlorengegangen, weil diese Tätigkeiten durch die leistungsfähigen Maschinen immer effektiver und effizienter, das heißt, immer schneller, präziser und kostengünstiger ausgeführt wurden, wo der Mensch einfach nicht mehr mithalten konnte. Daher mußten sich die Menschen notgedrungen umorientieren und sich auf Tätigkeitsfelder konzentrieren, die sich einer Automatisierung weitgehend entziehen. So sind beispielsweise in Produktionsbetrieben nur noch wenige Menschen beschäftigt, nämlich vorwiegend im Entwicklungsbereich, wo Kreativität gefragt ist. In der Produktion selbst sind nur noch sehr wenige Leute mit Kontroll- und Überwachungsfunktionen beschäftigt, das heißt, sie beaufsichtigen lediglich die Automaten und Roboter und greifen ein, wenn es Probleme gibt. Daneben gibt es natürlich, wie früher auch schon, freischaffende Handwerker, Ingenieure, Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Händler, Logistiker, Landschaftsgärtner und weiß der Teufel, was noch alles. Und vor allem gibt es jetzt in viel stärkerem Maße als früher Arbeitsplätze in Forschung und Lehre, in jeglicher Art von Service, Beratung, Unterhaltung, Physio- und Psychotherapie, Wellness, sowie jede Menge freischaffender Künstler und Kunsthandwerker.“
„Ja, du sagst es, Ellen! Das ist das eigentlich Schöne an unserer Zeit, daß wir uns heute nicht mehr wie Hamster im Laufrad tagein, tagaus abstrampeln müssen, um unser täglich Brot zu verdienen, wie unsere Vorfahren im Industriezeitalter, sondern daß wir einer selbstbestimmten Tätigkeit nachgehen können, die uns weniger Streß, dafür aber sehr viel mehr Motivation, Freiraum und Selbstzufriedenheit verschafft – und trotzdem unser Auskommen sicherstellt.“
„Richtig! Und abgesehen davon ist unser Lebensunterhalt ja heutzutage auch noch mit der ‚Allgemeinen Grundversorgung‘ (AGV) staatlicherseits einigermaßen abgesichert. Wenn es mit einem zusätzlichen Einkommen durch Arbeit mal nicht so klappt, dann müssen wir uns nicht gleich Sorgen machen. Genau das haben wir letztlich der Automatisierung und Roboterisierung zu verdanken – also auch deinem Mann mit seiner Roboterfirma“, sagte Ellen zu Chan. „Denn dadurch wird schließlich zu einem wesentlichen Anteil unser Bruttosozialprodukt erwirtschaftet.“
„Ja, schon. Aber was für mich von größerer Bedeutung ist, ist die Tatsache, daß heutzutage die ganzen stupiden Arbeiten von Automaten ausgeführt werden, daß die Menschen sich heute Aufgaben widmen können, zu denen sie früher gar keine Zeit oder Möglichkeit oder Muße hatten. Der Gewinn an Lebensqualität ist doch kolossal!“
Dem stimmte auch Frau Li ohne Zögern zu. Da waren sich alle einig.
„Um noch mal auf unsere Ausbildung zurückzukommen“, erklärte Ellen, „woran die Schüler ganz besonders interessiert sind, das ist die ‚Projektarbeit‘, wo sich jeweils mehrere Schüler in einer Gruppe zur Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung zusammenfinden. Dafür sind regelmäßig feste Zeiten im Stundenplan vorgesehen, meistens nachmittags. Die Aufgabenstellung kann von einem Lehrer oder von den Schülern selbst vorgeschlagen werden, sie kann sich aber auch unmittelbar aus dem Unterrichtsstoff ergeben; sie kann fachspezifisch oder fächerübergreifend, theoretisch oder praktisch sein – da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn so ein Thema ansteht, dann bilden die daran interessierten Schüler auf freiwilliger Basis eine Projektgruppe, die je nach Größe und Umfang der Aufgabenstellung mehr oder weniger Beteiligte umfaßt. Es kommt auch schon mal vor, daß sich zu viele für ein Thema interessieren, so daß die Projektgruppe für eine sinnvolle Bearbeitung zu groß würde. In so einem Fall lassen wir dann auch ruhig mal zwei Gruppen das gleiche Thema – gewissermaßen in Konkurrenz – erarbeiten, denn Konkurrenz gehört nun mal zu unserem Leben; und auch damit müssen die Schüler umzugehen lernen. Wir bringen ihnen dann richtig bei, so einen ‚Chinese Wall‘ – wie in der Industrie üblich – zu bilden, also keine projektspezifischen Informationen auszutauschen, solange das Projekt läuft. Und am Ende vergleichen und bewerten wir dann die unterschiedlichen Vorgehensweisen und Ergebnisse. Das ist auch für die Schüler immer wieder sehr interessant zu sehen, daß man so ein Thema in verschiedener Weise angehen, und daß man auch zu ganz unterschiedlichen Lösungen kommen kann. Ja, wie gesagt, das Themenspektrum ist sehr breitgefächert und vielfältig: Da werden physikalische und chemische, biologische, mikrobiologische und sogar gentechnische Experimente gemacht, mathematische Untersuchungen durchgeführt, gesellschaftliche, soziale, philosophische, ethische Fragestellungen erörtert, da wird gebastelt und gewerkelt, da werden sogar Erfindungen gemacht. Bei vielen Projekten, insbesondere bei den älteren Jahrgängen, arbeiten die Schüler auch mit Firmen und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. So bekommen sie frühzeitig Einblicke in solche Institutionen, erleben hautnah deren Aufgaben und Arbeitsweisen, erhalten jede Menge zusätzliche Anregungen und können durch Nutzung der dort gegebenen Möglichkeiten Experimente durchführen, die ihnen auf dem Schulgelände gar nicht eingeräumt werden könnten. Wir haben inzwischen Verbindungen zu sehr vielen Firmen und wissenschaftlichen Institutionen in der Umgebung, die sich sogar als Sponsoren betätigen, die uns Aufgabenstellungen und Projektbetreuer aus ihrem Bereich vermitteln und bei der Finanzierung unterstützen, denn nicht selten erarbeiten unsere Schüler auf diese Weise sehr nützliche Lösungen für deren Probleme. Etliche solcher Projektarbeiten bieten den Schülern sogar die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten, wo sie weitere, sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können.“
„Ja, das ist sehr gut. Das halte ich für sehr wichtig, daß die frühzeitig mal rauskommen und was von der Welt sehen – das erweitert ihren Horizont kolossal“, bescheinigte Chan. „Aber auch mal abgesehen vom Auslandsaufenthalt – allein schon die Tatsache, daß die Jugendlichen nicht nur abgeschirmt in der Schule lernen, sondern mit den unterschiedlichsten Berufs- und Lebensbereichen der realen Welt außerhalb der Schule konfrontiert werden, dort Eigenverantwortung übernehmen müssen und dabei frühzeitig ihre Erfahrungen sammeln können, das wird ihr Selbstbewußtsein und ihre Leistungsfähigkeit stärken.“
„Genau!“ fuhr Ellen fort: „Das zählt für mich zu einem der wichtigsten Vorteile der Projektarbeit überhaupt, daß hier die Eigeninitiative und Eigenverantwortung der Schüler gefordert und gefördert wird. Es gibt zwar für jedes Projekt einen Mentor, den sich die Gruppe aus dem Kreise der Lehrer oder auch Außenstehender selbst auswählen kann, aber der hat immer nur unterstützende, beratende Funktion. Die Projektgruppe muß sich völlig selbständig organisieren, muß die Aufgaben strukturieren und verteilen, die Lösung im Team erarbeiten, die Ergebnisse präsentieren. Sie muß sich aber auch selbst um die für die Durchführung notwendige Finanzierung kümmern, falls für die Aufgabenbearbeitung Geld benötigt wird. Auch wenn es sich dabei im allgemeinen um sehr begrenzte Mittel handelt, das Budget muß erst einmal akquiriert werden. Und es bleibt ihrem Einfallsreichtum und ihrer Überzeugungskraft überlassen, wo sie einen Sponsor finden. Und natürlich müssen sie auch lernen, mit dem gegebenen Budget auszukommen und entsprechend haushalterisch umzugehen. So lernen sie neben der fachlichen Thematik auch immer gleich die Planung von Projekten, die Zeit- und Kostenschätzung für die Durchführung sowie das Management und Controlling von Projekten, was sie später im Beruf notwendigerweise beherrschen sollten.“
„Das ist sehr wichtig, ja“, bestätigte Chan. „Aber auch die in der Teamarbeit erworbene Sozialkompetenz, die Motivation zum Lernen, das Interesse an geistig anspruchsvollen und fachübergreifenden Themen, das Entwickeln von Problemlösungsstrategien, der Wille zum Erfolg und die Überwindung von ‚Krisen’ oder Streitigkeiten – das sind ja alles äußerst wertvolle Erfahrungen, die ihnen in ihrem Leben noch sehr nützlich sein werden. Übrigens auch die Methodenkompetenz, die sie durch die Unterstützung ihres Mentors erfahren! Und, last but not least, werden sie auf diese Weise ja auch sehr frühzeitig auf ihren späteren Beruf hingeführt, denn durch die Erfahrungen hinsichtlich fachlicher Ausrichtung wie auch der unterschiedlichen Rollen in der Projektabwicklung, die sie in den unterschiedlichen Projekten sammeln können, entwickeln sie ja üblicherweise schon lange vor dem Schulabschluß relativ klare Vorstellungen über ihre Fähigkeiten, Ambitionen und Möglichkeiten.“
„Ja, das ist richtig. Da das ganze Schulsystem darauf ausgerichtet ist, die Schüler mit einem breiten Spektrum an Themen – Wissens-, Forschungs- und Arbeitsgebieten sowie Prozessen, Methoden und Tools – bekanntzumachen, Vielfalt zu zeigen, Interessen zu wecken, aber auch die Gelegenheit der Vertiefung potentieller Interessensgebiete zu ermöglichen und zu unterstützen, haben die Schüler nach dem Schulabschluß bereits eine relativ gute Vorstellung hinsichtlich ihrer beruflichen Ausrichtung und Perspektiven, so daß sie die berufsorientierte Ausbildung nahtlos anschließen können.“
„Und alles kostenlos! Das finde ich phänomenal! Bei uns in China müssen die Eltern noch selbst für die Kosten der Ausbildung aufkommen“, sagte Chan.
„Erst ab der Oberstufe!“ korrigierte Frau Li.
„Ja, richtig, erst ab der Oberstufe“, gab Chan zu. „Aber immerhin! Und das Mittagessen müssen sie bei uns auch selber zahlen.“
Frau Li warf ihr einen strengen Blick zu, äußerte sich aber nicht weiter dazu.
„Ja, das war auch hier ein langes, zähes Ringen“, sagte Ellen. „Aber letztlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß diese europäische Gemeinschaft ihren Bestand im harten Wettbewerb mit den bevölkerungs- und/oder rohstoffreichen Ländern nur behaupten kann, wenn sie zur geistigen Elite gehört, wenn sie bei Wissenschaften, Forschung und Technologien in der Champions League mitspielen kann. Und wenn du das erreichen willst, dann mußt du konsequenterweise die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen. Und eine gute Schulbildung ist nun mal die wichtigste Voraussetzung für jeden einzelnen, um den Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft gerecht zu werden und in diesem Wettbewerb zu bestehen. Deshalb wird die ganze Ausbildung bis zum Abitur aus Steuergeldern finanziert, also von allen Bürgern der Gemeinschaft, nicht nur von denjenigen, die noch bereit sind, für den Nachwuchs und damit für den Fortbestand der Gemeinschaft zu sorgen. Und deshalb haben wir auch hervorragend ausgestattete Kindergärten und Schulen, ein hervorragendes Bildungssystem und hervorragende Lehrkräfte. Alles hervorragend – anders könnten wir gar nicht bestehen.“
„Vernünftige Einstellung!“
„Und es gibt einen weiteren wichtigen Beweggrund dafür: Chancengleichheit! Denn nicht alle Eltern sind in der wirtschaftlich guten Lage, die Kosten für eine so umfassende Ausbildung ihrer Kinder zu bezahlen. Diese Kinder – und das sind gar nicht so wenige – würden klar benachteiligt. Das wollen wir nicht!“
„Sehr fürsorglich!“
„Ja, aber es ist nicht nur altruistisch gedacht, sondern auch ein wenig egoistisch – aus Sicht der Gesellschaft. Denn andernfalls ginge unserer Gesellschaft ein nicht unerhebliches Potential an Leistungsträgern verloren! Diese Situation hatten wir ja lange genug: nämlich massenweise schlecht bis gar nicht ausgebildete Jugendliche, die nichts leisteten, sondern im Gegenteil die Gesellschaft erheblich viel Geld kosteten. Das war eine lost-lost-situation: Diese Jugendlichen waren frustriert, denn sie empfanden sich als Loser ohne jede Zukunftsperspektive, und für die Gesellschaft waren sie nur eine Belastung, denn sie mußte beträchtliche Sozialhilfeleistungen für sie aufbringen und obendrein eine gesteigerte Kriminalitätsrate bekämpfen. Da ist das Geld doch besser so angelegt, wie wir das jetzt machen. Darauf hätte man übrigens schon viel früher kommen können!“
„Ja, natürlich, da hast du völlig recht! Die Kriminalitätsrate unter Jugendlichen steigt zwangsläufig, wenn diese keine Perspektive für sich sehen, sich als Loser empfinden und deshalb frustriert sind. Dann machen sie die Gesellschaft für ihr Schicksal verantwortlich und reagieren ihre Wut an den gesellschaftlichen Institutionen, Einrichtungen und an ihren Bürgern ab.“
„Zweifellos! Deshalb ist es umso wichtiger, alle Mitglieder der Gesellschaft ‚mitzunehmen’ und gleichermaßen zu fördern. Aber wie gesagt: Irgendwann ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Für die Finanzierung der berufsbezogenen Ausbildung, also für die Zeit nach dem Abi, muß jeder selber aufkommen. Sie sind dann erwachsen, haben eine tadellose Ausbildung und damit ein solides Fundament, um für sich selber zu sorgen.“
„Aber sie haben doch dann noch kein eigenes Einkommen und sind immer noch in der Ausbildung.“
„Doch, ja! Sie erhalten ja, wie schon erwähnt, von der AGV ein monatliches Grundeinkommen. Und wenn ihnen das tatsächlich nicht reichen sollte, dann darf man doch schließlich auch ein bißchen Unterstützung durch das Elternhaus erwarten, wenn die Gesellschaft schon für die Kosten der ersten 18 Jahre aufgekommen ist, oder? Bei Euch in China müssen sie ja sogar schon ab der zehnten Klasse Schulgeld zahlen, wie ich vorhin gehört habe.“
„Das habe ich gesagt, ja“, bestätigte Frau Li. „So ist es bei uns auch. Trotzdem würde mich interessieren, wie es hier diejenigen machen, die vom Elternhaus her nicht so gut ausgestattet sind?“ wollte Frau Li wissen.
„Normalerweise hat jeder Jugendliche eine Ausbildungsversicherung, die staatlicherseits bei der Geburt mit einem Startgeld initiiert und dann von den Eltern üblicherweise mit monatlichen Raten fortgeführt wird“, erwiderte Ellen. „Die angesparten Beträge können nach dem Abi abgerufen werden. Damit kann jeder Jugendliche seine Grundversorgung aufbessern und hat dann eine ziemlich üppige finanzielle Grundausstattung – je nachdem, ob und wieviel die Eltern über die Jahre angelegt haben. Wenn die Jugendlichen gut sind, oder wenn sie es geschickt anstellen, dann werden sie gesponsert, erhalten zum Beispiel ein Stipendium von einem Unternehmen, einer Institution, einem Förderverein oder einem wissenschaftlichen Institut. Und unabhängig davon kann man aber auch bei jeder Bank ein sehr günstiges Studiendarlehen erhalten. Das vergeben die Banken schon aus ganz eigennützigem Interesse, denn sie verbinden natürlich mit jedem dieser Darlehen die Hoffnung, diesen Darlehensnehmer auch später als Kunden zu behalten. Aber wie gesagt: Wenn sie nicht auf allzu großem Fuße leben, dann kommen sie allein mit der Grundversorgung, der AGV, ganz gut über die Runden.“
„Verstehe!“
„Naja, und außerdem haben viele Studenten nebenher irgendeinen Job, um sich noch etwas dazu zu verdienen. Und die Studentenbuden in den Uni-Camps sind ja auch sehr preiswert – wie übrigens auch die Mensa. Also, da hat bisher noch jeder sein Auskommen gefunden.“
„Das ist bei uns in China bis auf die Grundversorgung ganz ähnlich“, bestätigte Frau Li. Und noch ehe sie weitersprach, vernahm sie einen Klingelton. „Oh! Das könnte mein Mann sein“, sagte sie. „Dann muß ich mich jetzt leider verabschieden.“
Und da kam auch schon Robby ins Zimmer und führte Herrn Li herein. Frau Li machte ihn mit Ellen bekannt; Chan und er kannten sich ja bereits. Chan lud ihn ein, Platz zu nehmen. Aber er war in Eile, wollte nur seine Frau abholen. Sie hatten jetzt noch eine Verabredung in der Stadt. Frau Li bedankte sich bei der Verabschiedung für die freundliche Einladung und das sehr interessante Gespräch. Sie habe eine Reihe von Gemeinsamkeiten in den beiden Schulsystemen erkannt, aber auch einige Unterschiede. Und so nehme sie gerne einige wertvolle und interessante Anregungen mit nach Hause. Ja, und wenn Ellen tatsächlich mal nach Beijing kommen sollte, dann müsse sie sie unbedingt dort besuchen, sagte sie noch, bevor sie ging. Chan geleitete ihren Besuch noch bis zur Haustür, wo auch schon ein Taxi wartete. Als sie Herrn Li die Hand zum Abschied reichte, fragte sie ihn, ob es denn morgen bei der Verabredung bleibe.
„Ja, ja, selbstverständlich. Um 17.00 Uhr werde ich hier sein“, hatte er geantwortet, und Chan erwiderte: „Fein, mein Mann wird sich freuen.“ Dann winkte sie beiden nach, bis sie im Taxi verschwanden.
Nachdem sie abgefahren waren, kam Chan zurück ins Wohnzimmer zu Ellen.
„Du hast doch schon noch ein bißchen Zeit, Ellen?“ fragte Chan. „Wir müssen ja unser Gespräch, nur weil sie weg ist, nicht so abrupt abbrechen, oder?“
„Nein, nein! Kein Problem, es pressiert mir nicht.“
„Und? Was sagst du?“
„Ja, was soll ich sagen? Es war nicht uninteressant, aber manchmal wohl ein wenig heikel. Sie reagiert bei bestimmten Themen ziemlich empfindlich, war mein Eindruck.“
„Naja, das mußt du verstehen, sie ist Pädagogin. Das ist einer der Jobs, bei denen unsere Regierung absolute Loyalität und Linientreue verlangt. Sie bildet schließlich die Jugendlichen aus. Wenn bekannt würde, daß sie sich anderen gegenüber, vor allem Westlern gegenüber, in irgendeiner Weise despektierlich über Staat und Gesellschaft Chinas äußert, dann ist sie ihren Job los, verstehst du?“
„Wird das tatsächlich immer noch so rigoros gehandhabt bei euch? Ich hatte eigentlich gedacht, daß ihr dort inzwischen mehr Freiheiten in der Meinungsäußerung habt.“
„Haben wir ja auch schon – im Prinzip. Aber gerade Pädagogen haben eine sehr wichtige Vorbildfunktion. Sie müssen unsere Ideale und Prinzipien überzeugend vertreten. Wenn sie auch nur einmal illoyal auf die Jugendlichen wirken, sind sie für die nicht mehr glaubwürdig.“
„Du meinst, die tut nur so linientreu, weil sie es muß?“
„Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. Dazu kenne ich sie zu wenig. Aber wie auch immer. Sie hat diesen Beruf, und sie muß so agieren. Und – weißt du – auf Dauer wird es für jeden mal zu anstrengend, immer hin und her zu switchen, hier so und dort anders zu reden. Das machst du nicht lange, ohne dich irgendwann mal zu verplappern. Also bleibst du lieber gleich konsequent. So ist das nun mal.“
„So ist das nun mal, ja. Also lassen wir sie machen. Ich will ihr ja auch nicht unrecht tun. Es ist eben leider nur so, daß man sich selbst dann aus lauter Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten des anderen sehr bald nicht mehr traut, bestimmte Äußerungen zu machen oder Themen anzusprechen. Das ist schade. Es schränkt so schnell die Diskussion ein, wenn du deine eigenen Überzeugungen nicht darlegen darfst. An solchen Diskussionen verliere ich ziemlich schnell die Lust.“
„Das verstehe ich gut; geht mir genauso.“
„Wir sind ja nun – glücklicherweise, muß ich schon fast sagen – durch Herrn Li in unserer Unterhaltung unterbrochen worden. Vermutlich hätte ich mir andernfalls wieder ihren Zorn zugezogen, denn es lag mir schon wieder die ketzerische Frage auf der Zunge, wieso man in eurem vorgeblich kommunistischen Paradies eigentlich Schulgeld bezahlen muß, während wir uns in unserem ‚bösen’ kapitalistischen System den Luxus leisten können, die gesamte Kindergarten- und Schulausbildung für die Familien kostenfrei zu ermöglichen.“
„Oh, damit wärst du sicher in ein Fettnäpfchen getreten, Ellen.“
„Das fürchte ich auch. Dabei will ich gar nicht provozieren. Man muß doch einfach mal ganz wertfrei seine Meinungen und Ansichten austauschen können.“
„Sollte man meinen, ja. Aber wenn du meine Meinung dazu hören willst, dann frage ich zurück: Was heißt da schon kommunistisch? Die kommunistische Ideologie wird doch schon lange nur noch als ‚Deckmäntelchen‘ zur Schau getragen. In Wirklichkeit haben wir doch in China längst Kapitalismus pur!“ ereiferte sich Chan. „Glaubst du im Ernst, es würde uns heute in China so gut gehen, wenn wir die kommunistische Idee – ich könnte auch sagen: die kommunistische Utopie – weiterverfolgt hätten? . . . Nein, nein! Das hat Deng Xiaoping damals schon sehr richtig erkannt. Und alle nachfolgenden Regierungs- und Parteichefs haben seine Lehre befolgt. Damit ist China über die Jahre sehr gut gefahren.“
„Ja, offenbar! Nicht umsonst ist China heute die führende Weltmacht schlechthin!“ stellte Ellen fest. „Früher haben sie im Westen immer von China als dem ‚Schlafenden Riesen‘ gesprochen, aber dieser Riese ist inzwischen schon lange aufgewacht – und putzmunter! . . . Ach, und übrigens, weißt du, daß Napoleon Bonaparte angeblich schon gesagt haben soll: ‚Laßt China schlafen. Denn wenn der Drache erwacht, dann wird die Welt erzittern.’ Glaubst du, daß der das damals wirklich schon erkannt haben konnte?“
„Hm, ja. . . . Oder viel mehr nein, das war mir jetzt eigentlich nicht bekannt. China ist natürlich ein sehr großes, starkes Land – und das bevölkerungsreichste – neben Indien – dazu! Vielleicht begründete sich sein Ausspruch darauf?! Außerdem sind die Menschen sehr fleißig und sehr diszipliniert. Da mußte sich dieser Erfolg einfach einstellen!“
„Liegt es wirklich daran? Oder ist es nicht vielmehr das autoritäre Regime, das die schnelleren Fortschritte schafft, weil da einfach beschlossen und gehandelt wird . . . während bei uns, in der Demokratie, ja immer erst mühsam Kompromisse gefunden werden müssen, um einen möglichst großen Konsens herzustellen. Dabei wird dann regelmäßig sehr viel Zeit nutzlos vertan und leider auch immer vieles zerredet. Wie viele gute Ideen sind da schon verlorengegangen, nur weil sie zu diesem Zeitpunkt gerade nicht opportun erschienen.“
„Das spielt sicher auch eine maßgebliche Rolle. Die Entscheidungsprozesse sind bei uns vermutlich schneller als in einer Demokratie. Aber dies allein ist es eben auch nicht. Es gab zu allen Zeiten und gibt immer noch genügend diktatorische Systeme, in denen nichts voran geht, in denen teilweise sogar das blanke Elend herrscht, während eine vergleichsweise kleine Führungsclique in Saus und Braus lebt. Unsere politische Führung herrscht zwar autoritär, aber wirtschaftlich läßt sie uns sehr große Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten. Jeder hat die Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu erfahren und eine eigene Existenz aufzubauen; jeder partizipiert am wirtschaftlichen Erfolg.“
„Hm . . . . Sozialistischer Kapitalismus! . . . oder Kapitalistischer Sozialismus?“
Chan lachte, ging aber nicht weiter auf das Wortspiel ein, denn sie wußte natürlich, daß dies nur eine scherzhafte Äußerung war. So fuhr sie fort: „Und nicht zu vergessen, daß wir ja einen in jeder Hinsicht riesigen Nachholbedarf gegenüber der westlichen Welt hatten! Mit der wirtschaftlichen Öffnung durch Deng erwachten die Menschen bei uns aus einem Zustand der Lethargie und entwickelten einen unbändigen Willen zum Wohlstand. Das ist vielleicht ein bißchen vergleichbar mit euren Aufbaujahren hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur daß dieser Boom bei uns viel länger anhält – eben weil das Land so groß, der Rückstand so gewaltig, die Zahl der Menschen so immens ist. Bis da ein gewisser Sättigungszustand landesweit erreicht ist, dauert es natürlich viel länger, als es bei euch damals der Fall war, zumal ihr ja seinerzeit sogar noch von einem viel höheren Ausgangsniveau aus gestartet seid!“
„Ja, ja. Das ist sicher richtig. Aber mal angenommen, ihr hättet zu Zeiten Dengs oder bald darauf eine Demokratie eingeführt – glaubst du wirklich, daß China in seiner Entwicklung schon genausoweit wäre wie es jetzt ist?“
„Nein, das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht.“
„Na siehst du! Das glaube ich nämlich auch nicht. Und das ist es, was ich vorhin mit den schnelleren Entscheidungsprozessen meinte. Für mich ist das das Ausschlaggebende für die Entwicklung. Ein philosophischer Redezirkel oder ein politischer Debattierklub kann wunderbare Ideen hervorbringen. Aber was nutzen sie, wenn man nichts damit anfängt? Wenn man nichts daraus macht, sie nicht umsetzt? Über jede Idee läßt sich trefflich streiten. Es wird immer irgendwelche Gegenargumente geben. Das ist völlig normal; dazu sind einfach die Ansichten der Menschen viel zu unterschiedlich, als daß überall ‚Friede, Freude, Eierkuchen’ herrschen könnte. Aber darf das dazu führen, daß überhaupt nichts mehr richtig vorangeht? Daß alles blockiert wird?“
„Nun, ganz so schlimm ist es bei euch ja auch wieder nicht. Eure Europäische Union hat sich – nach zugegebenermaßen teils schwierigen Geburtswehen und Krisen – ja schließlich doch sehr vorteilhaft entwickelt.“
„Schließlich! Ja. Aber wie lange hat das gedauert?“
„Sicher, so etwas braucht einen langen Atem – viel Geduld! Keine Nation will ihre Eigenständigkeit, ihre Souveränität verlieren. Es muß ein gewaltiges Umdenken stattfinden – das geht nur über mehrere Generationen! Aber dafür ist es freiwillig passiert! Und das hält allemal besser und länger als jede erzwungene Vereinigung!“
„Zweifellos, ja! . . . Und bei so gravierenden Veränderungsprozessen mag es ja auch noch angehen. Aber es ist ja auch im ganz alltäglichen Leben so – alles so zäh! Unsere Politiker streiten sich doch selbst im ganz normalen Tagesgeschäft meistens um nichts und wieder nichts – das sind reine Schaukämpfe! . . . Bei euch in China sieht man davon nichts dergleichen.“
„Man bekommt es nicht mit, das ist richtig. Aber ich bin davon überzeugt, daß selbst im engsten Führungszirkel heftig gestritten wird.“
„Naja, das sind nur ein paar Mann! Die werden sich schneller einigen und Beschlüsse fassen.“
„Aber ob der Mehrheit des Volkes diese Beschlüsse passen, das fragen sie nicht! Sie ordnen einfach an und setzen durch! Und sie scheuen sich nicht, ihre Drei-Millionen-Armee notfalls auch gegen das eigene Volk einzusetzen – wie sie es schon 1989 in Beijing auf dem Platz des himmlischen Friedens gemacht haben! Möchtest du solche Verhältnisse in Europa?“
„Nein, natürlich nicht! . . . Schade, daß es nicht irgendwas dazwischen gibt“, sinnierte Ellen. „Eine Staatsform, die auf Freiheit ihrer Bürger fußt, aber dennoch entschlußfreudiger agieren kann.“
„Ja, das muß aber erst noch erfunden werden.“
Beide lachten.
„Wie wirkt sich das jetzt eigentlich im täglichen Leben bei euch aus?“ wollte Ellen wissen.
„Was meinst du?“
„Naja, das autoritäre System, . . . wie macht sich das bemerkbar?“
„Solange du dich politisch konform verhältst, Partei und Regierung nicht kritisierst, den obligaten ‚politischen Unterricht‘ regelmäßig besuchst und gelegentlich an einer ‚freiwilligen Gemeinschaftsaufgabe‘ teilnimmst, solange kannst du eigentlich ziemlich ungestört dein Leben leben. Aber wehe, du wagst es zu opponieren! Dann spürst du die Härte des Systems in seiner ganzen Bandbreite – von Schikane bis zur Todesstrafe.“
„Da fällt man besser nicht auf, was?“
„Es ist nicht ratsam.“
„Schrecklich!“
„Ja, das ist schrecklich. Aber wenigstens haben wir ziemlich weitgehende persönliche Freiheiten inzwischen. Das war ja lange Zeit nicht der Fall. . . . Naja, und davon mal abgesehen – wer weiß, wie vorhin schon mal angesprochen, ob es China in der Form überhaupt noch gäbe, wenn es nicht ‚mit harter Hand‘ regiert worden wäre. Vielleicht wäre das Reich schon längst zerfallen, hätte ein ähnliches Schicksal erlitten wie die ehemalige Sowjetunion. Das war und ist bis heute ein abschreckendes Beispiel für unsere Staats- und Parteiführung.“
„Das kann ich mir vorstellen.“
„China ist ja auch kein ‚homogenes’ Land, auch wenn es von Europa aus vielleicht den Anschein haben mag. Es gibt ganz viele Ethnien bei uns. Und viele von ihnen wären lieber autonom. Denk nur an die Aufstände der Tibeter und der Uiguren beispielsweise, die blutig niedergeschlagen wurden. Wenn das chinesische Regime hier Schwäche zeigt, dann bricht das Land ganz schnell auseinander, fürchte ich.“
„Das könnte sein, ja.“
„Und das ist auch der Grund, weshalb sie die Zügel nach wie vor so fest in der Hand halten und jede Opposition gleich im Keim ersticken. Deshalb werden auch die Kinder schon von klein auf im Sinne der kommunistischen Idee erzogen und zu allerlei ‚freiwilligen’ Gemeinschaftsaufgaben verpflichtet. So etwas gibt es hier bei euch nicht, da könnt ihr wirklich froh sein.“
„Da hast du allerdings völlig recht. Da kann ich ohne Wenn und Aber zustimmen“, pflichtete Ellen ihr bei. „Weißt du, man hatte ja auch in Deutschland lange Zeit kontrovers diskutiert, ob man nicht für alle Jugendlichen, Jungen und Mädchen ohne Ausnahme, einen sechsmonatigen Arbeitseinsatz in einem bestimmten, von jedem Jugendlichen frei wählbaren Einsatzbereich, beispielsweise beim Militär, beim Rettungsdienst, bei der Kranken- oder Altenpflege, bei der Behindertenbetreuung, bei der Pflege und Reinigung öffentlicher Anlagen, in der Entwicklungshilfe und ähnliches, nach Absolvierung der Schule als Dienst für die Gesellschaft verpflichtend vorschreiben sollte. Die Verfechter dieser Forderung argumentierten: Jeder soll sich in die Gemeinschaft einbringen und frühzeitig lernen, daß man als Teil dieser Gemeinschaft nicht nur deren Vorteile in Anspruch nehmen könne, sondern daß man selber auch etwas für die Erhaltung und Weiterentwicklung dieser Gemeinschaft tun müsse – so etwa in dem Sinne, wie Kennedy es mal ausdrückte: ‚Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst’. Schließlich wurde aber doch wieder Abstand davon genommen, und zwar aus einem ganz pragmatischen Grund: Es gab nicht genug Arbeitsplätze. Der Konkurrenzkampf um Arbeit hatte sich im Laufe der Zeit so drastisch verschärft, daß man – allein aus dieser Not heraus – von jedweder ehrenamtlichen oder sonstigen freiwillig und unentgeltlich erbrachten Tätigkeit völlig abgekommen war. Einfache Tätigkeiten überläßt man gern solchen Leuten, die andere, schwierigere Aufgaben nicht oder nicht mehr ausführen können, oder deren sonstiges Einkommen noch dringend einer Aufbesserung bedarf. Schwierigere Aufgaben hingegen werden ausschließlich an dafür ausgebildete Fachkräfte vergeben. Jede Leistung hat ihren Preis und muß entsprechend vergütet werden. Und je besser die Ausbildung, desto vielseitiger die Einsatzmöglichkeiten und umso größer die Chancen auf eine interessante, anspruchsvolle Tätigkeit. Das bekommen alle Schüler während ihrer Ausbildung eindringlich vermittelt. Aber genauso deutlich wird ihnen vermittelt, daß eine gute Ausbildung zwar eine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben darstellt, daß sie aber noch keine Gewähr für eine längerfristige berufliche Karriere ist. Denn in Anbetracht der sehr dynamischen Entwicklung und Fortschritte in allen Bereichen kann man sich nicht auf seinen anfänglichen Lorbeeren ausruhen, sondern muß fortwährend versuchen, mit dem sich immer schneller vermehrenden Wissen schrittzuhalten.“
„Richtig! Und eingedenk dieser Tatsache ist die Devise ‚Ein Leben lang lernen’ inzwischen ja auch nicht mehr nur eine Floskel, sie ist tatsächlich Realität geworden. Der Mensch ist zwar in seinem späteren Leben nicht mehr so aufnahmefähig wie während seiner Kindheit, aber das Gehirn lernt immer – und zwar um so besser, je mehr man es trainiert. Wer diese Erkenntnis erst einmal verinnerlicht hat, der wird selbst im altersbedingten, gemeinhin ‚wohlverdienten’ Ende seiner Berufszeit nicht das Ende geistiger und schöpferischer Tätigkeit sehen. Im Gegenteil, die Alten werden immer älter, und sie halten sich im eigenen wie auch im Interesse der Gesellschaft so lange wie möglich fit – körperlich und geistig.“
„Klar, körperlich und geistig fit halten, ist unheimlich wichtig“, sagte Ellen, „aber man muß ja auch finanziell über die Runden kommen. Wenn man da allein auf die AGV angewiesen ist und sonst nichts hinzuverdient, dann ist man schon ganz schön bescheiden dran.“
„Ja, du hast die AGV schon mehrfach erwähnt. Aber kannst du mir das nochmal etwas genauer erklären?“ fragte Chan.
„Ja, das ist die Allgemeine Grundversorgung“, erklärte Ellen, während sie auf die Uhr schaute. „Oh, mein Gott, es ist ja schon so spät, Chan! Ich muß ja meine Männer versorgen. Die sitzen bestimmt schon mit knurrenden Mägen zu Hause und warten auf mich, während ich hier sitze und schwätze und schwätze. Sei mir nicht böse, aber ich muß jetzt wirklich gehen. Ich erkläre dir das mit der AGV beim nächsten Mal, ganz bestimmt.“
Chan lächelte nur und winkte ab: „Nur keine Hektik, deine Männer sind doch schon groß, die können sich doch sicher mal selbst versorgen.“
Beide lachten, und Ellen sagte schließlich: „Ja, natürlich. Und sie könnten sich ja auch von Robby etwas zubereiten lassen. Aber trotzdem, es wird wirklich Zeit für mich, mal wieder nach dem Rechten zu sehen. Die Zeit ist leider wahnsinnig schnell vergangen.“
Sie packte ihre Utensilien zusammen. Chan begleitete sie zur Garderobe, wobei sie sich immer noch angeregt über allerlei mehr oder weniger Belangloses unterhielten. So dauerte es noch fast zehn Minuten, bis sie sich endlich verabschiedeten.