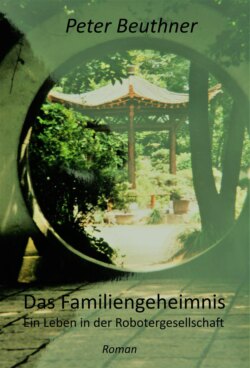Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Besuch von Freunden
ОглавлениеSamstagabend. Eppelmanns waren zu Besuch bei Wangs. Herr Eppelmann sah müde aus. Er hatte den ganzen Tag über ein ziemlich anstrengendes Besuchsprogramm zu absolvieren, um seine potentiellen Kunden, eine Delegation von Regierungsangehörigen der Südamerikanischen Union, die schon seit Anfang der Woche zu Verhandlungen über den Erwerb breitbandiger, multifunktionaler Sensorsysteme im Hause waren, für einen Vertragsabschluß zu gewinnen. Von der Leistungsfähigkeit und Qualität der Produkte hatten sie während der Präsentationen und Demonstrationen auf dem Versuchsgelände schon bald überzeugt werden können, trotzdem zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Dabei ging es letztlich immer wieder um den Preis und – wie sich im Laufe der Verhandlungen immer deutlicher herausstellte – vor allem um das Know-how. Sie wollten eigentlich nur die Technologie, um solche Systeme dann selber herstellen zu können. Aber das wollte Eppelmann natürlich nicht, seine Firma lebte ja schließlich davon, solche Systeme zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen. Wenn er das dafür notwendige Know-how verkaufte, dann würde er sich ja selbst die Geschäftsgrundlage entziehen. Nur nicht zweimal denselben Fehler machen, hieß seine Devise. Das erste Mal hatte seine Firma genau diesen Fehler – zwar schon vor Jahrzehnten – in China gemacht, als sich das Land politisch öffnete, wirtschaftlich liberalisierte und jede Menge ausländische Investoren mit großen Geschäftsversprechungen ins Land lockte. Aber kaum hatten diese ihre Investitionen dort getätigt, ihre Firmen dort aufgebaut, da verlangten die cleveren Chinesen den Know-how-Transfer. Ob der schon getätigten Investitionen ließen sich die meisten Firmen erpressen und gaben ihr Wissen preis. Zu ihrem großen Leidwesen dankten ihnen die Chinesen jedoch nicht mit lukrativen Geschäften, sondern nutzten dieses Wissen zu ihrem eigenen Vorteil und machten fortan selbst die Geschäfte, während die Investoren nicht nur mit leeren Händen dastanden. Schlimmer noch: Sie hatten sich ihre eigene Konkurrenz großgezogen! Viele Unternehmen hatten sich auf diese Weise förmlich ihr eigenes Grab geschaufelt. Das wußte Klaus Eppelmann aus entsprechenden Berichten noch zu gut, als daß er sich jetzt selbst auf einen solchen Kuh-Handel einlassen wollte. Der Schock saß immer noch tief.
So gab es zähe, langwierige, ermüdende Verhandlungen – leider ohne den erhofften Erfolg. Verschiedene Optionen und Geschäftsmodelle waren diskutiert worden, von Lizenzrechten bis Joint Ventures, aber eine Einigung kam nicht mehr zustande. Immerhin waren die Verhandlungen nicht abgebrochen, sondern nur vertagt worden. Aber ein Erfolg war eben auch noch nicht in Sicht.
„Ja, ich bin etwas abgespannt heute“, räumte Klaus Eppelmann denn auch bereitwillig ein, nachdem ihn Chan schon gleich bei der Begrüßung besorgt gefragt hatte, ob er sich nicht wohl fühle.
„Er hatte eine ganz anstrengende Woche“, bestätigte Ellen Eppelmann sogleich.
„Aber Klaus, wenn du dich nicht wohl fühlst, dann können wir unser Treffen doch auf ein andermal verschieben“, schlug Chan vor, die sichtlich besorgt schien. „Warum habt ihr nicht einfach angerufen? Wir haben doch Verständnis dafür, wenn es dir heute nicht gut geht.“
„Nein, nein! So schlimm ist es nun auch wieder nicht“, wiegelte Klaus Eppelmann ab. „Außerdem, du weißt doch: Ein Guter hält‘s aus!“
Alle lachten.
„Also, wenn du schon wieder Witze machen kannst, dann ist es wohl doch nicht so schlimm“, entgegnete Qiang. „Dann kommt mal rein!“ Und mit einer einladenden Geste zeigte er in Richtung Wohnzimmer. „Du mußt mir aber versprechen, daß du ehrlich sagst, wenn es dir zuviel wird, wenn du lieber heimgehen möchtest. Versprichst du mir das?“
„Ja, okay! Jetzt macht euch aber um mich keine Sorgen“, versuchte Klaus Eppelmann seine Gastgeber zu beruhigen. „Hier erwartet mich ja schließlich keine Arbeit mehr, im Gegenteil, es ist das reine Vergnügen, bei euch zu Gast zu sein.“
„Also gut, dann kommt endlich rein“, forderte Qiang nochmals seine Gäste auf.
Die Kinder hatten sich schon lange in den Hobbyraum verzogen. Klaus und Ellen Eppelmann gingen ins Wohnzimmer, die Gastgeber folgten ihnen.
„Was darf ich euch als Aperitif anbieten?“ fragte Qiang seine Gäste. In seiner Heimat, China, war es nicht üblich, einen Aperitif vor dem Essen zu nehmen, aber Qiang war inzwischen sehr gut vertraut mit den europäischen Sitten und Gebräuchen, und als guter Gastgeber wußte er, was seine Gäste von ihm erwarteten.
„Du kennst uns doch“, antwortete Ellen Eppelmann, noch bevor Qiang so richtig zu Ende gesprochen hatte. „Wir nehmen sehr gerne einen Prosecco.“
„Ich habe es mir schon gedacht! Aber es hätte ja auch sein können, daß ihr ausgerechnet heute vielleicht mal den Gustus auf etwas anderes gehabt hättet. Deshalb frage ich lieber immer nochmal nach“, scherzte Qiang und gab Robby Anweisung, den kaltgelegten Prosecco zu servieren.
Während sie sich zuprosteten, gab Klaus Eppelmann schmunzelnd die Devise aus: „Heute abend wird nicht mehr über Geschäftliches gesprochen! Ich will den ganzen Abend nichts mehr davon hören, okay?“
„Damit sind wir sehr einverstanden, nicht wahr Chan?“ pflichtete Ellen Eppelmann ihrem Mann spontan bei.
„Ja, natürlich!“ beeilte sich Chan zu bestätigen. „Es ist mir sehr recht, wenn wir mal nicht übers Geschäftliche reden müssen! Es gibt ja wirklich genügend andere interessante Themen.“
„Zum Beispiel?“ fragte Klaus Eppelmann.
„Nun, zum Beispiel Politik oder Kultur oder Gesellschaftsthemen . . .?“
„Hm, . . .“, stöhnte Klaus Eppelmann, „bloß nichts Anstrengendes heute abend.“ Dabei schaute er Robby zu, wie dieser das Licht im Raume etwas dimmte. „Ich glaube, ich habe erstmal ein paar Fragen technischer Art an Qiang. Ihr wißt ja, ich bin gelernter Kaufmann. Von der Technik habe ich keine Ahnung. Da nutze ich gerne mal die Gelegenheit für ein paar Fragen an unseren Chefingenieur hier.“ Und dabei klopfte er Qiang anerkennend auf die Schulter.
Die Frauen schauten sich wortlos an und rollten vielsagend mit den Augen, bevor sie die Köpfe zum angeregten Plausch zusammensteckten.
„Also gut“, räumte Qiang bereitwillig ein, denn die Wünsche seiner Gäste waren ihm stets eine Verpflichtung. „Ziehen wir beide uns ins Eck zurück. Die Damen interessiert das bestimmt nicht, die wollen sich in der Zeit sicher über wichtigere Themen unterhalten“, bemerkte er leicht ironisch.
Sie machten es sich gemütlich in der einen Ecke des Wohnzimmers, während die Damen in einer anderen Ecke Platz bezogen.
Während Robby noch einen Prosecco nachschenkte, fragte Qiang: „Also, was willst du wissen?“
„Hm . . .“, begann er zögernd, „vielleicht ist die Frage in deinen Augen ja töricht . . .“
„Nur zu!“ ermutigte Qiang ihn.
„Ich habe da gerade beobachtet, wie dein Roboter die Lichteinstellung verändert hat, ohne daß er irgendwo dran gedreht hat." Kurze Pause. „Und überhaupt, diese Lichtvariationen?“
„Ja, das ist im Grunde ganz einfach“, begann Qiang zu erklären. „Sieh mal, wir beherrschen heute die Technik dieser hohen Frequenzen im sichtbaren Bereich, das ist einfach ‚state of the art’, wie wir sagen. Der für den Menschen sichtbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums deckt ein bestimmtes Frequenzband von etwa 430 bis 750 Terahertz ab entsprechend den Wellenlängen von etwa 400 bis 780 Nanometern. Die Einzelfrequenzen dieses Bandes, die zwischen dem infraroten und dem ultravioletten Bereich liegen, würden wir mit unseren Augen als ganz bestimmte Farben in der Farbfolge, die du vom Regenbogen her kennst, wahrnehmen. Alle Frequenzen zusammen ergeben weißes Licht. Wenn wir also weißes Licht, das unserem Tageslicht entspricht, künstlich herstellen wollen, dann müssen wir konsequenterweise elektromagnetische Wellen genau diesen Frequenzbandes generieren und abstrahlen.“
„Klingt selbst für einen Kaufmann plausibel“, bemerkte Klaus Eppelmann.
„Okay! Wie machen wir das?“ fuhr Qiang mit seiner Erklärung fort: „Wir bauen einen Oszillator, also einen Schwingungsgenerator, der auf einer ganz bestimmten Frequenz oszilliert. Und die legen wir vorzugsweise genau in die Mitte dieses Frequenzbandes, deshalb nenne ich die jetzt mal Mittenfrequenz. Verstehst du?“
„Hm, ja. Ich glaube schon. Aber mach es nicht zu kompliziert.“
„Ja, verstehe. Du bist heute sicher zu müde.“
„Nein, nein! Mach nur weiter, es interessiert mich ja wirklich. Ich melde mich schon, wenn ich nicht mehr folgen kann.“
„Ja, okay. Aber ich will es trotzdem ein wenig abkürzen, um dich nicht über Gebühr zu beanspruchen. Also, wir waren bei der Mittenfrequenz. Ich sagte ja schon: Jeder einzelnen Frequenz entspricht eine bestimmte Farbe für unsere Wahrnehmung. Das heißt: Um weißes Licht zu erzeugen, reicht es nicht, nur eine bestimmte Frequenz abzustrahlen. Also, wie kriegen wir das gewünschte Frequenzband? Wir könnten zum Beispiel für jede einzelne Frequenz dieses Bandes einen eigenen Oszillator bauen, aber das macht man natürlich nicht, denn das wäre total unwirtschaftlich.“
„Das glaube ich auch“, pflichtete Klaus Eppelmann ihm bei.
„Deshalb haben sich die Ingenieure eine bessere Lösung einfallen lassen: Sie sorgen dafür, daß dieser eine Oszillator simultan auf allen gewünschten Frequenzen dieses Bandes schwingt.“
„Hm . . .?“
„Ja, du mußt dir das so vorstellen, daß er jede einzelne Frequenz kurz nacheinander erzeugt und abstrahlt – so schnell, daß es quasi gleichzeitig erscheint. Wir nennen das Wobbeln.“
„Ach komm, laß mich mit deinen Fachausdrücken in Ruhe. Die vergesse ich sowieso gleich wieder.“
„Na gut. Aber hast du das Prinzip verstanden?“
„Ich glaube schon, ja.“
„Prima. Wir haben also ein Ausgangssignal mit einer ganz bestimmten Mittenfrequenz und einer definierten Signalbandbreite generiert. Und mit diesen beiden Größen lassen sich jetzt allerlei Effekte erzeugen, einfach durch Variation einer der beiden oder beider Größen. So kannst du zum Beispiel je nach Wunsch entweder ein relativ breites, dem Tageslicht ähnliches Frequenzspektrum abstrahlen oder ein schmaleres, dessen Mittenfrequenz du wahlweise näher zu den infraroten oder zu den ultravioletten Frequenzen verschieben kannst.“
„Hm . . . Und die Farbspiele in eurem Partykeller?“
„Das ist auch ganz simpel. Wenn du die Signalbandbreite sehr schmal machst, dann hast du eine bestimmte Farbe, je nachdem, wo die Mittenfrequenz liegt. Und wenn du die veränderst, kontinuierlich oder sprunghaft, dann ändert sich in diesem Rhythmus auch die Lichtfarbe.“
„Hm, hört sich wirklich alles ganz einfach an“, sagte Klaus Eppelmann beeindruckt.
Sie sahen sich einen Moment lang schweigend an. Dann fragte Qiang: „Was willst du noch wissen?“
Klaus Eppelmann zögerte mit der Antwort. „Ich möchte dir wirklich nicht zur Last fallen mit meinen törichten Fragen“, sagte er schließlich, während er beobachtete, wie Robby mit dem Prosecco auf ihn zukam und fragte, ob er nochmal nachschenken dürfe.
„Aber, ich bitte dich. Die Fragen sind doch nicht töricht, und du fällst mir auch nicht zur Last damit“, beruhigte Qiang ihn. „Also, was willst du wissen?“
Klaus Eppelmann nickte zustimmend und sah Robby dabei mit einem Ausdruck großer Bewunderung zu, wie dieser erneut sein Glas füllte. „Wir nehmen das alles schon so selbstverständlich hin“, sagte er gedankenversunken, „aber eigentlich ist es phänomenal, mit welcher Leichtigkeit und Eleganz zugleich deine Roboter ihre Bewegungen ausführen. Ich habe ja keine Ahnung, welcher technische Aufwand dahintersteckt, wirklich nicht! Aber ich bin ausgesprochen begeistert von dem Resultat.“
„Ja, es sieht alles sehr leicht aus, wenn es mal richtig funktioniert“, bestätigte Qiang. „Aber, wie du schon sehr richtig vermutest, war es ein weiter Weg bis dahin und entsprechend groß der Aufwand. Wobei die Realisierung an sich nicht mal das eigentliche Problem ist. Eine technische Lösung läßt sich früher oder später eigentlich immer finden. Nein, das eigentliche Problem liegt schon davor, wenn es nämlich darum geht, die zugrundeliegenden Wirkmechanismen überhaupt erst mal zu verstehen.“
Klaus Eppelmann schaute ihn mit erwartungsvollen Augen an.
„Schau mal“, fuhr Qiang fort, „du kannst, zum Beispiel mit den Mitteln der Heuristik, für deine jeweilige Aufgabenstellung verschiedene Lösungen finden. Wenn wir mal bei den Armbewegungen von Robby bleiben, die ja sehr vielfältig sein können, so müßte man – einem herkömmlichen Ansatz der ‚Künstlichen Intelligenz‘ folgend – allein dafür schon eine ganze Reihe von Programmen zur Ablaufsteuerung der verschiedenen Bewegungen generieren, genau genommen für jede mögliche Bewegung jeweils ein eigenes Programm. Jetzt überleg mal, wie viele unterschiedliche Bewegungen du mit deinen Armen machen kannst! Dann erkennst du, daß du sehr schnell an die Grenze des Machbaren stößt, denn du kannst praktisch nicht alle in jeder Situation möglicherweise vorkommenden Bewegungsabläufe vorhersehen und programmieren. Es wird immer wieder die eine oder andere Situation geben, die du nicht genau bedacht hast, und dieser Situation würde Robby dann zwangsläufig nicht mehr gerecht werden können. Also, langer Rede kurzer Sinn: Die Handlungsmöglichkeiten von Robby blieben in jedem Fall eingeschränkt.“
„Ja, und . . .“, Klaus Eppelmann schaute ihn mit großen Augen fragend an: „Und wie hast du das Problem gelöst?“
„Unsere Roboter sind befähigt, die Strategien der Bewegungsabläufe biologischer Organismen – in diesem Fall der Menschen – nachzuvollziehen. Voraussetzung dafür war logischerweise die Kenntnis der Struktur und Wirkungsweise biologischer Nervensysteme. Das ist schnell gesagt – jetzt, seitdem wir diese Thematik beherrschen. Aber bis es soweit war, hat es sehr viel Schweiß der Tüchtigen gekostet. Es sind ja sehr komplexe Vorgänge, die sich selbst bei kleinsten Bewegungen abspielen. Dabei steht die Steuerung der Bewegungsmotorik schon eher am Ende der Verarbeitungskette, obgleich es eigentlich ein rückgekoppelter Prozeß ist. Am Anfang steht ein Wunsch oder Wille, etwas zu tun: Robby will dir Prosecco eingießen. Dann geht es darum, die Informationen unserer Sinne, also beispielsweise Sehen, Hören oder Tasten, richtig zu verarbeiten, um daraus schließlich die notwendigen Bewegungen abzuleiten: Robby sieht dein Glas an einer bestimmten Stelle des Raumes stehen und muß jetzt die Flasche mit seinem Arm in eine Position führen, die es ihm ermöglicht, den Inhalt in dein Glas einzugießen ohne dabei etwas zu verschütten. Aber damit nicht genug: Er muß den Vorgang des Eingießens visuell verfolgen, damit er nicht zu viel eingießt. Er muß also fortlaufend sein motorisches Handeln mit seiner sensorischen Wahrnehmung im dreidimensionalen Raum korrelieren und koordinieren.“
Qiang blickte Klaus Eppelmann in die Augen, die etwas müde in den Raum zu starren schienen, und machte eine Pause, weil er den Eindruck hatte, diesen mit seinen Ausführungen in Anbetracht dessen momentaner Verfassung vielleicht etwas zu überfordern. Aber der nickte nur kurz mit dem Kopf, als hätte er alles verstanden, und sagte: „Interessant! Wirklich interessant!“
„Ich habe jetzt sehr stark vereinfacht“, fuhr Qiang fort. „In Wirklichkeit ist das natürlich alles wesentlich komplizierter. Wenn du bedenkst, daß du 656 verschiedene Muskeln hast, die alle jederzeit richtig koordiniert werden wollen und von denen meistens mehrere gleichzeitig bei jeder deiner Bewegungen beteiligt sind! Oder wenn du auch nur den Arm mit seinen 52 Muskelpaaren betrachtest, die alle deine mehr oder weniger komplizierten Armbewegungen und Handgriffe ermöglichen, ohne daß du dir dieser schwierigen Aufgabe überhaupt bewußt wirst! . . . Ja? Es ist doch so, daß du keinen einzigen Gedanken daran verschwendest, wie du nach dem Glas greifen mußt, um es sicher zu halten und nichts zu verschütten. Das machst du quasi automatisch, mit schlafwandlerischer Sicherheit! Selbst wenn du dabei an ganz andere Dinge denkst oder dich mit jemandem unterhältst. Die Komplexität, die sich hinter diesem scheinbar so einfachen Vorgang verbirgt, nimmt man normalerweise überhaupt nicht zur Kenntnis! Das wird dir alles erst richtig klar, wenn du versuchst, diese evolutionär über Jahrmillionen entwickelte Leistungsfähigkeit eines biologischen auf ein technisches System zu übertragen. Dann merkst du, wie komplex die Dinge tatsächlich sind. . . . Aber das näher auszuführen würde heute abend viel zu weit führen. Ich denke, wir belassen es dabei. Das eigentlich Entscheidende jedoch, was ich in diesem Zusammenhang noch gern hervorheben möchte, ist die Tatsache, daß die sensorisch-motorische Koordination unserer Roboter nicht nach vorgegebenen starren Regeln abläuft, sondern – einem adaptiven Lernprozeß folgend – völlig autonom gesteuert wird.“
„Hm . . . ?“
„Ja, unser Robby stellt insoweit ein selbstlernendes System dar – nach dem Prinzip: ‚learning by doing‘. Über seine Sensorik beschafft er sich alle für die Bewegungssteuerung notwendigen Informationen selbst. Er kontrolliert seine Bewegungen und korrigiert sie, wenn nötig. Nach wenigen Übungen hat er sie soweit verinnerlicht, oder besser: gelernt und gespeichert, daß er sie danach fehlerfrei wiederholen kann. Es ist wie bei einem Kind, das bestimmte Dinge lernt, indem es sie wieder und wieder probiert. Nur, daß dieser Lernprozeß bei Robby wesentlich schneller abläuft.“
„Phantastisch!“ äußerte Klaus Eppelmann begeistert. „Und . . . , sag mal, wie koordinierst du eigentlich das perfekte Zusammenspiel deiner fünf Roboter?“
„Ach, weißt du“, antwortete Qiang, „die koordinieren ihre Aktionen untereinander völlig selbständig, indem sie alle notwendigen Informationen via Funkkommunikation austauschen. Damit ist das ‚System‘ technisch voll redundant ausgelegt und dem früher häufig angewandten sogenannten Master-Slave-Prinzip weit überlegen. Wenn beispielsweise ein Roboter von einem Familienmitglied einen Auftrag erhält, kommuniziert er diesen sofort an alle anderen vier Roboter, und derjenige, der für diese Aufgabe gerade besonders günstig positioniert ist, ‚übernimmt‘ den Auftrag, das heißt, er führt ihn aus und teilt dies allen anderen gleichzeitig mit. Bleibt eine solche Mitteilung, aus welchen Gründen auch immer, einmal aus, so wird der gleiche Kommunikationsprozeß vom ursprünglichen Initiator erneut angestoßen. Jeder Roboter kennt somit jederzeit den jeweiligen Aufenthaltsort und die gesamte ‚Auftragslage‘ aller Roboter“.
„Phantastisch!“ sagte Klaus Eppelmann bewundernd.
„Naja, das ist eigentlich nichts Neues“, wiegelte Qiang etwas ab. „Es gab ja früher auch schon diese dezentrale Organisationsform für technische Systeme. Wir haben sie allerdings in der Zwischenzeit verfeinert, weißt du. Indem wir die Untersuchungsergebnisse der wissenschaftlichen Studien zu Ameisen- und Bienenvölkern sehr genau analysiert und ihre Übertragbarkeit auf unsere Anwendungen geprüft haben, sind wir auf sehr interessante Erkenntnisse gestoßen, deren praktische Umsetzung du hier vor dir siehst.“
„Bewundernswert“, staunte Klaus Eppelmann, „wie du es schaffst, trotz deiner zeitraubenden unternehmerischen Aktivitäten immer noch so fit in den technischen Details zu bleiben, zumal die technologische Entwicklung so rasant verläuft, daß einem schon fast schwindelig werden könnte.“
„Ach, weißt du“, bemühte sich Qiang schnell in typisch chinesischem Understatement, seinem Freund ‚Gesicht‘ zu geben, „das ist nichts Besonderes. Ich bin Ingenieur, mich hat schon immer alles Technische interessiert. Und es macht mir einfach Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Außerdem, schau mal, meine kleine Firma ist doch leicht überschaubar im Vergleich zu deinem großen Laden. Angesichts der Verantwortung, die du hast, ist doch klar, daß dir da viel weniger Zeit für deine Hobbys bleibt.“
Natürlich war sich Qiang bewußt, daß sein Job beziehungsweise seine Leistung auf gar keinen Fall geringer zu bewerten war als jene von Klaus Eppelmann, und er war selbstbewußt genug, sich das auch selber zuzugestehen. Aber ebenso selbstverständlich würde er ihm gegenüber so etwas niemals äußern. Viele dieser Manager in den Großkonzernen waren nach seiner Erfahrung in erster Linie an ihrem eigenen Fortkommen interessiert. Die Firma war nicht das Ziel ihrer Überlegungen, sondern lediglich das Mittel zum Zweck. Alle drei bis fünf Jahre wechselten sie auf einen anderen Posten oder in eine andere Firma, Hauptsache es ging aufwärts. Verständlich, daß sie angesichts solcher Motivation wenig Interesse an den Produkten ihrer jeweiligen Firma und an der Entwicklung längerfristiger Geschäftsstrategien hatten, denn sie würden die Zielerreichung ohnehin nicht mehr in dieser Position erleben. Nur kurzfristige Erfolge waren für sie wichtig, selbst wenn es vielleicht nur Scheinerfolge waren. Ihr ganzes Bemühen war konsequenterweise darauf ausgerichtet, bei ihren jeweiligen Vorgesetzten ein möglichst gutes Bild abzugeben, selbst wenn die Ergebnisse negativ waren. Auf die richtige Darstellung kam es an. Bilanzen konnten ‚frisiert‘ werden. Irgendwie ließ sich fast immer zumindest eine ‚schwarze Null‘ hintrimmen. Und wenn doch nicht, dann fand man mit Sicherheit gute Gründe, warum das eben diesmal nicht gelingen konnte: Dann war eben die Politik Schuld, weil sie nicht die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen hatte, oder das Wirtschaftswachstum war generell einfach zu gering, oder die Konkurrenz war zu aggressiv, oder, oder, oder. Gründe dafür ließen sich immer finden. Wichtig war allein, seine ‚Leistung‘ nach oben richtig darzustellen, dann erreichte man bald die nächste Hierarchiestufe und mußte nicht mehr selbst ausbaden, was man vorher möglicherweise ‚angerichtet‘ hatte. Das mußte dann allenfalls der Nachfolger büßen. Auf diese Weise wurden ganze Generationen von ‚Springern‘ in den Konzernen herangezogen, die durch die Hierarchien wirbelten, viel Unruhe unter den Mitarbeitern verursachten, und letztlich – langfristig gesehen – zum Nachteil der Unternehmen wirkten.
Ganz anders verhielt es sich bei ihm – er war selbständiger Unternehmer. Sein Hauptinteresse galt dem Unternehmen und dessen erfolgreiche Entwicklung. Er verband sein ganzes Leben mit dieser Firma, und er war auf Gedeih und Verderb mit dieser Firma verbunden. Er mußte sich langfristige Strategien für den Aufbau und das weitere Wachstum überlegen. Er konnte nicht – und wollte auch nicht – mal eben die Firma wechseln, um dort einen gutdotierten Posten zu ergattern. Er wollte nur seine eigene Firma voranbringen. Es war gewissermaßen sein ‚Lebenswerk‘.
Klaus Eppelmann saß in seinem Sessel, die Schultern schlapp herunterhängend, den Kopf nach vorn geneigt, das Gesicht grau und von Falten gezeichnet, die Augenlieder schwer.
„Du bist müde, Klaus. Man sieht es dir an“, sagte Qiang. „Womit kann ich dich ein wenig aufmuntern?“
„Ach, ja“, antwortete Klaus nachdenklich. „Ich bin für jede Aufmunterung dankbar. Aber letztlich hilft sie mir auch nicht wirklich weiter.“
„Wieso? Was heißt das?“ wollte Qiang wissen.
„Ach, naja . . .“, sagte Klaus etwas unwirsch, denn eigentlich hatte er gar nicht darüber sprechen wollen. Aber nun hatte er mal damit angefangen und wollte die Frage nicht einfach so abweisen. „Es ist einfach so, daß ich seit einiger Zeit eigentlich immer müde bin. Es ist wohl der dauernde Streß, dem ich allmählich nicht mehr gewachsen zu sein scheine.“
„Na, na! Das glaubst du ja wohl selber nicht!“ entgegnete Qiang spontan. „Das hätte ich mit Sicherheit bemerkt.“
„Hast du nicht?“
„Hab ich nicht.“
„Siehst du, das ist perfektes Tarnen und Täuschen. Das mußt du beherrschen in unserem Job. Bloß keine Schwächen zeigen! Aber, wem erzähle ich das!“
„Sicher! Ich weiß Bescheid! Aber gerade weil es so wichtig ist, keine Schwächen zu zeigen, solltest du eine solche gar nicht erst aufkommen lassen. Schlaf dich doch einfach mal so richtig aus!“
„Erst mal können vor Lachen!“
„Hm? Was heißt das: Können vor Lachen?“
„Ach, das ist so eine Redewendung!“ entgegnete Klaus mit einer abwinkenden Handbewegung. „Was ich damit sagen will, ist, daß ich nicht schlafen kann!“
„Du meinst, du schläfst nicht gut.“
„Nein, ich schlafe überhaupt nicht! Jedenfalls fast gar nicht. Ich liege nachts im Bett, und meine Gedanken kreisen. Ich kann einfach nicht abschalten. Das Tagesgeschäft verfolgt mich unentwegt.“
„Hast du das schon lange?“
„So lange ich denken kann. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal so richtig gut und fest geschlafen habe.“
„Oh, dafür hast du dich aber erstaunlich gut gehalten!“
„Man tut, was man kann. Aber du hast natürlich recht: Im Grunde wundere ich mich auch immer wieder, mit wie wenig Schlaf ich offenbar doch auszukommen scheine. Mit zunehmendem Alter spüre ich zwar schon das ständige Schlafdefizit, aber trotzdem stehe ich täglich meinen Mann.“
„Hast du denn niemals versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Autogenes Training zum Beispiel? Oder Meditation?“
„Doch, ich habe es mal mit Autogenem Training probiert. Und ich habe dabei sogar gewisse Anfangserfolge gespürt. Aber dann fing irgendwann so ein fürchterliches Kribbeln in den Armgelenken und Kniekehlen an, so daß ich nicht mehr ruhig liegen konnte. Das hat mich fast verrückt gemacht. Da mußte ich schließlich damit aufhören.“
„Ein Kribbeln?“
„Ja! Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es war einfach nicht auszuhalten.“
„Hm! Und jetzt schläfst du schon seit vielen Jahren nicht mehr richtig? Wie hältst du das bloß durch?“
„Das frage ich mich auch des öfteren. Aber bitte: Das bleibt unter uns!“
„Selbstverständlich! Du kennst mich doch: Vertrauen ist Ehrensache!“
„Ja, ich weiß, auf dich kann man sich verlassen. Das schätze ich so an dir.“
„Was hältst du davon, mal in ein Schlaflabor zu gehen? Da könnte man vielleicht den Ursachen deiner Schlaflosigkeit auf den Grund gehen.“
„Ach, weißt du, das ist so ziemlich das Letzte, was ich probieren würde. Allein schon der Gedanke daran, daß ich die ganze Nacht unter Beobachtung schlafen soll, und daß ich dabei an allerlei Geräte angeschlossen bin, die meine Bewegungsfreiheit einschränken – und ich wälze mich sehr viel herum –, läßt mich schon gar nicht erst einschlafen. Na ja, und außerdem würde sich das wahrscheinlich wie ein Lauffeuer herumsprechen, wenn ich das täte. Nein, nein! Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.“
„Verstehe! Aber dann käme vielleicht ein Wellness-Urlaub in landschaftlich schöner Umgebung in Betracht. Das wäre doch eher unverfänglich. Und da läßt du dich dann mal so richtig verwöhnen, genießt die Ruhe und Entspannung, die Natur und die therapeutischen Anwendungen, läßt einfach die Seele baumeln und denkst mal ´ne Weile nicht ans Geschäft. Was hältst du davon?“
„Ja, natürlich! Gute Idee. Habe ich ja auch schon verschiedentlich gemacht. Und mache ich auch gerne immer wieder. Aber in punkto Schlaf hat es mir dennoch nie wirklich geholfen.“
„Nicht?“
„Nein. Es ist noch gar nicht so lange her, daß ich bei Oberstaufen in einem kleinen Ort war. Wie hieß der doch gleich noch? . . . Hmm . . . Ich komme im Moment nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. . . . Ach, ich bin aber auch so furchtbar vergeßlich geworden. Na ja, jedenfalls hat es uns dort sehr gut gefallen. Das Haus war sehr gepflegt, bot so ziemlich alle Annehmlichkeiten, die man sich nur wünschen kann. Es wird von den Besitzern persönlich geführt, und die sind sehr freundlich und aufmerksam. Wir waren dort zehn Tage und haben uns sehr gut erholt – bloß mit dem Schlafen hat es auch dort nicht geklappt. Im Gegenteil, da habe ich eher noch weniger geschlafen, denn da hat meine schnarchende Frau neben mir gelegen. Hier, zu Hause, haben wir ja getrennte Schlafzimmer. Das müssen wir für den nächsten Urlaub unbedingt auch buchen.“
„Ja, natürlich! Warum hast du es nicht schon dieses Mal getan? Es gibt doch sehr schöne Seniorensuiten mit getrennten Schlafkabinen.“
„Richtig! Die gibt es. Und die gibt es sogar in dem Haus, in dem wir waren. Nur hatten wir uns leider etwas zu kurzfristig dort angemeldet, und da waren die bereits alle ausgebucht. Es gibt halt einfach zu viele alte Leute; und im Verhältnis dazu immer noch zu wenig Seniorensuiten. So haben wir notgedrungen eine normale Suite mit Doppelbett genommen. Aber – wie gesagt – davon abgesehen hat es uns dort sehr gut gefallen.“
„Hattest du diese Adresse aus dem WorldNet?“
„Nein. Im WorldNet gibt es ja so viele Wellness-Angebote, daß man Tage brauchte, um sie alle zu studieren. Und dann weißt du im Grunde immer noch nicht, ob es wirklich das ist, was du suchst. Die lobpreisen sich doch alle, daß sich die Balken biegen.“
„Wie? Was für Balken?“
„Ach, das ist auch wieder so eine Redensart. Die heißt eigentlich: Die lügen, daß sich die Balken biegen.“
„Ich verstehe immer noch nicht: Was hat Lügen mit Balkenbiegen zu tun?“
„Ja, du mußt dir das jetzt nicht bildlich vorstellen. Nimm’s einfach als eine Redensart.“
„Okay! Wieder was dazu gelernt.“
„Hm . . . Wo war ich jetzt eigentlich stehengeblieben?“
„Beim Balkenbiegen.“
„Nee. . . . Ach so, beim Lobpreisen. Nee, also das tue ich mir nicht an, da ewig lange im WorldNet herumzusurfen. Da vertraue ich lieber auf eine Aussage von Freunden oder Bekannten. Und diese Adresse verdanke ich einem Tipp von . . . äh . . . einem Tipp von . . . äh . . . Ja Kruzifix nochemal! Ich sehe ihn genau vor mir und komme nicht auf seinen Namen! Dabei liegt er mir förmlich auf der Zunge, aber ich bring’ ihn nicht raus. Das kann mich fuchsteufelswild machen, so was.“
„Na, laß mal. Das wird dir schon wieder einfallen.“
„Ja, irgendwann vielleicht, später. Aber ich brauche es jetzt! . . . Weißt du, es passiert mir leider öfter, daß ich einen Bekannten treffe, und just in diesem Moment fällt mir dessen Name nicht ein. Dann kann ich ihn bei der Begrüßung nicht mal mit seinem Namen ansprechen, was ich eigentlich als unhöflich empfinde. Aber was soll ich machen. Früher war mir das regelrecht peinlich, und ich hab’ dann immer irgendwie rumgeeiert, um meine Vergeßlichkeit zu kaschieren. Heute ist es mir zwar immer noch unangenehm, aber inzwischen stehe ich dazu – jedenfalls immer häufiger. Tut mir leid, sage ich dann, aber ich komme im Moment nicht auf Ihren Namen. Kann ja schließlich jedem mal passieren, oder?“
„Ja, natürlich! Jeder vergißt mal was. Unser Gehirn ist ja schließlich kein Computer. Und wenn man mal was vergißt, dann ist das ja auch kein Beinbruch. Ein Problem wird es erst, wenn man dauernd etwas vergißt.“
„Du sagst es. Und unter uns: Ich fürchte, ich habe da ein Problem.“
„Meinst du?“
„Fürchte ich.“
„Also, wenn du den Eindruck hast, daß dein Erinnerungsvermögen gelitten hat, dann kann das in der Tat damit zusammenhängen, daß du zu wenig Schlaf hast.“
„Meinst du?“
„Ich denke, schon. Nicht umsonst verbringt der Mensch rund ein Drittel seines Lebens mit Schlaf. Denn das Gehirn braucht diese Zeit, um sämtliche über den Tag gesammelten und im Hippocampus zunächst zwischengespeicherten Informationen sowie Erlebnisse beziehungsweise Ereignisse in den Neokortex zu übertragen. Wir sprechen hier auch vom Kurzzeit- und vom Langzeitgedächtnis. Das ist in etwa vergleichbar mit dem aus der Computertechnologie bekannten Volatile Memory, früher Hauptspeicher genannt, der nur eine vergleichsweise kleine Speicherkapazität hat und seinen Inhalt bei Spannungsverlust verliert, und dem Non-volatile Memory, einem Permanentspeicher mit enorm großer Speicherkapazität. Beim Menschen speichert der Hippocampus alles persönlich erfahrene Geschehen des Tages. Damit ist seine Aufnahmekapazität erschöpft. Am nächsten Tag werden alle vorherigen Speicherinhalte durch die neuen Eindrücke überschrieben. Sie wären somit für immer verloren, wenn sie zwischenzeitlich nicht in das Langzeitgedächtnis transferiert würden. Und genau dazu dient die Schlafphase, in der alle Erinnerungen in das Langzeitgedächtnis übernommen und dort mit den schon vorher vorhandenen Inhalten assoziativ verknüpft werden. Man spricht hier auch vom Prozeß der Gedächtniskonsolidierung. Damit dieser Prozeß möglichst ungestört ablaufen kann, geht das Gehirn in einen scheinbar bewußtlosen Zustand über, den wir Schlaf nennen. Aber das Gehirn ist auch in dieser Phase nicht untätig, nur die Art der Gehirnaktivität verändert sich. In der Technik sprechen wir hier auch vom Offline-Betrieb, weil das Gehirn in dieser Phase von den Sinnessystemen, also von den Schnittstellen zur Außenwelt, praktisch entkoppelt ist und lediglich interne Prozesse abwickelt. Diese Prozesse sind anhand verschiedener Hirnstrommuster in der elektrischen Aktivität des Gehirns nachweisbar. Im Tiefschlaf sind besonders die für die Gedächtnisbildung wichtigen Deltawellen aktiviert. Sie werden im Neokortex generiert und stimulieren den Transferprozeß vom Hippocampus zum Neokortex.“
„Was du alles weißt?! Erstaunlich! All diese Details kann ich mir leider sowieso nicht merken. Aber ich merke mir: Ich muß mehr und besser schlafen. Bleibt die Frage: Wie?“
„Denk noch mal über das Schlaflabor nach.“
„Ach komm!“ Klaus wollte gerade noch etwas sagen, als er bemerkte, daß die Frauen aufgestanden waren und auf sie zukamen. „Themenwechsel! Okay?“ forderte er Qiang auf, der ihm kurz zunickte.
Inzwischen war das Essen fertig. Robby hatte gerade zu Tisch gebeten, während zwei seiner ‚Kollegen‘ noch mit dem Tischdecken beschäftigt waren und ein vierter die Kinder aus dem Hobbyraum holte.
„Also, auf geht’s!“ forderte Chan die Herren mit einer einladenden Geste auf. „In China haben wir ein Sprichwort, das lautet: ‚Es ist besser, der Gast wartet auf das Essen, als das Essen auf den Gast‘. Das hat seinen Grund darin, daß unsere Pfannengerichte unbedingt frisch und heiß serviert werden sollten, weil sie dann auch am besten schmecken. Langes Warmhalten schadet nur.“
Klaus Eppelmann nickte verständnisvoll und sprang mit einem Satz aus dem Sessel: „Ja, ja, ich weiß schon! . . . Und da bin ich auch schon!“
„Hmmm! Riecht das wieder gut bei euch!“ schwelgte Ellen Eppelmann bereits im Vorgeschmack auf das Essen, das Robby gerade auf den Drehtisch stellte.
Nachdem sie alle am Tisch Platz genommen hatten, erläuterte Robby das Menü: „Wir haben heute ‚Betrunkenes Huhn‘, . . .“
Die Kinder lachten laut auf, und auch Ellen und Klaus schauten schmunzelnd und erwartungsvoll abwechselnd auf das Essen und zu Robby.
„. . . ja, so heißt das: Betrunkenes Huhn“, wiederholte Robby. „Aber das Huhn wird nicht schon vor dem Schlachten betrunken gemacht, sondern erst danach ausgiebig in Wein gebadet. Das Gericht stammt aus Schanghai.“
Die Eppelmann-Kinder amüsierten sich immer noch über den Namen.
Nach kurzer Pause fuhr Robby fort: „Außerdem gibt es Schweinefleisch vom Rost, Rindfleisch Kanton, Ente mit Ananas, Fischklöße in Teigtaschen, Gemischtes Gemüse süß-sauer und eine Eierblumensuppe.“
„Oh, das hört sich ja ganz vorzüglich an!“ rief Ellen entzückt.
„Und sehr üppig!“ ergänzte Klaus.
„Ich wünsche allseits guten Appetit!“ sagte Robby lächelnd mit seiner typischen, kleinen Verbeugung.
„Ja, das wünsche ich euch auch allen“, wiederholte Chan. „Laßt es euch gut schmecken!“
„Danke, gleichfalls!“ antworteten die Eppelmanns fast gleichzeitig.
Die Erwachsenen tranken einen Reiswein dazu, die Kinder kalte Getränke.
„Ach, übrigens, ehe ich es vergesse“, sagte Ellen Eppelmann den Kindern zugewandt, „wir hatten ja eine Verabredung für nächsten Samstag.“
„Wir hatten?“ fragte Jiao.
„Ja, leider! Wir müssen nochmal umdisponieren. Es ist etwas dazwischen gekommen, dem wir uns nicht entziehen können.“
„Schade“, sagte Jiao etwas traurig. „Ich hatte mich schon so darauf gefreut.“
„Ich weiß“, bestätigte Ellen Eppelmann, „es tut mir ja auch leid, aber aufgeschoben ist doch nicht aufgehoben! Wir holen es auf jeden Fall nach! Wir können ja gleich nach dem Essen mal nach einem geeigneten Termin schauen.“ Und zu Chan gewandt fügte sie mit einem vielsagenden Lächeln hinzu: „Weißt du, wir haben einen Wochenend-Trip auf die Kanaren gewonnen.“
„Gewonnen?“ fragte Chan, weil sie mit diesem Ausdruck in dem Zusammenhang nicht viel anfangen konnte.
„Ja, weißt du, das sagen wir so scherzhaft hier. Klaus und seine Bereichskollegen haben eine Einladung von ihrem Chef. Sie wollen sich wohl über die Geschäftsstrategie unterhalten. Ja, und es gibt auch ein Damenprogramm, damit wir armen Ehefrauen nicht immer allein zu Hause rumsitzen müssen, während die Herren durch die Welt reisen. Ist doch nobel, nicht?“
„Das finde ich nur zu gerecht“, pflichtete Chan ihr bei, und sie tat dabei so, als hätte sie den etwas ironischen Unterton bei Ellen Eppelmann nicht bemerkt. „Wenn die Herren nicht mal am Wochenende mehr Zeit haben für ihre Familie, dann sollen sie wenigstens nicht auch noch ihre Frauen allein am Herd zurücklassen – jedenfalls nicht immer.“
„Du sagst es!“ bemerkte Ellen Eppelmann sehr bestimmt und schaute dann ihren Mann herausfordernd an. Als der aber keinerlei Anzeichen machte, ihre Bemerkung zu kommentieren, wandte sie sich wieder Jiao zu und sagte in versöhnlichem Ton: „Also, wie gesagt, wir holen das auf jeden Fall nach. Du mußt dich nur ein wenig gedulden.“
„Apropos Familie“, sagte Chan und schaute dabei die Söhne der Eppelmanns an, „was macht ihr dann an diesem Wochenende? Ihr fliegt doch nicht mit, oder?“
„Nein, die bleiben hier“, antwortete Ellen Eppelmann für ihre Söhne. „Die sind doch groß genug, um sich mal ein Wochenende selbst zu versorgen.“
„Dann kommt ihr selbstverständlich zu uns“, sagte Chan resolut. „Ihr dürft euch auch ein Essen wünschen.“
„Das ist doch nicht nötig, Chan“, intervenierte Ellen Eppelmann, während die Jungs ein freundlich zustimmendes Gesicht machten. „Die sind doch nun wirklich alt genug und müssen nicht mehr bemuttert werden!“
„Das hat doch gar nichts mit Bemuttern zu tun, Ellen“, insistierte Chan. „Wir sind doch zu Hause, müssen ja auch essen. Und das Essen macht uns ja schließlich überhaupt keine Arbeit, das macht Robby. Der kocht einfach für zwei Personen mehr. Also wo ist das Problem? Warum sollen deine Jungs alleine zu Hause rumsitzen und sich die Küchenarbeit machen, wenn sie alles viel einfacher, gemütlicher und geselliger haben können?“
„Ach, du mußt die nicht so verwöhnen. Die müssen langsam erwachsen und selbständig werden! Und das werden sie nicht, wenn sie ständig bemuttert werden!“
„Ach komm, jetzt sei nicht zu streng mit ihnen. Außerdem freuen sich unsere Kinder ja auch, wenn sie hier zusammen etwas unternehmen können. Also abgemacht, ihr kommt dann nächsten Samstag zu uns, ja?“ Damit war die Sache für Chan entschieden, und sie sah den Jungs an, daß sie sich darüber freuten.
Ellen Eppelmann holte tief Luft und schnaufte dann laut und deutlich durch, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß sie es eigentlich nicht für richtig hielt, sich aber nun doch in das offenbar Unvermeidliche fügte.
Mit dem Essen war man inzwischen fertig, und die Kinder rutschten immer unruhiger auf ihren Stühlen herum. Schließlich bat Jiao: „Dürfen wir schon mal aufstehen?“
Sie durften es, und flugs sprangen sie auf, um in den Hobbykeller zu rennen – so, als wollte jeder als erster dort ankommen.
„Aua!“ schrie Gerd Eppelmann plötzlich laut auf.
Ellen rannte sofort zur Treppe, um nachzusehen, was passiert war. Dort sah sie ihren Sohn mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Treppenabsatz liegen.
„Was ist passiert?“ fragte sie ihn besorgt und ging hinab zu ihm.
„Ach, mein Knöchel tut weh. Ich glaube, ich hab’ mir den Fuß verstaucht“, stöhnte Gerd.
„Das kommt davon, wenn man gleich drei oder vier Stufen auf einmal nehmen will. Das wär’ doch nun wirklich nicht nötig gewesen!“ entgegnete Ellen vorwurfsvoll, fügte aber besorgt hinzu: „Tut’s sehr weh?“
„Schon“, klang es kläglich.
„Sollen wir einen Arzt rufen?“
„Ich weiß nicht.“
„Meinst du, du kannst aufstehen?“
„Ich weiß nicht.“
„Komm, versuch es mal. Ich stütze dich“, sagte Ellen fordernd.
Gerd versuchte sich aufzurichten, Ellen half ihm dabei. Er stand auf einem Bein.
„Nun setz’ doch mal vorsichtig den anderen Fuß auf!“ kommandierte Ellen weiter.
Vorsichtig setzte er den Fuß auf den Boden und belastete ihn langsam, kontinuierlich zunehmend stärker. Dabei zuckte er noch zwei- bis dreimal zusammen und verzog das Gesicht, während Ellen ihm immer noch unterstützend zur Seite stand. Schließlich stand er wieder auf beiden Füßen, schüttelte die Hände seiner Mutter ab, die ihn immer noch gehalten hatte, und sagte: „Geht schon wieder.“ Dann ging er langsam und etwas hinkend die Treppe hinab zum Hobbyraum, wo die anderen Kinder, die das kleine Malheur anscheinend gar nicht mitbekommen hatten, bereits diskutierten, welches Spiel man denn jetzt spielen sollte.
Ellen schaute ihm so lange nach, bis er im Hobbyraum verschwunden war. Dann schaute sie nach oben, wo die anderen Erwachsenen standen und von wo aus sie den Vorgang beobachtet hatten, um bei Bedarf ebenfalls Hilfe leisten zu können. Aber nun war ihr Einsatz offenbar nicht nötig. Und davon abgesehen war der Treppenabsatz auch ein bißchen zu eng, um dort mit mehreren Personen adäquat Hilfestellung geben zu können. Ellen kam wieder die paar Stufen hinauf und sagte: „Jugendlicher Übermut! Nichts als Übermut!“
„Aber so schlimm war es wohl nicht“, erwiderte Klaus. „Es scheint doch alles schon wieder paletti zu sein.“
„Scheint so, aber wir sollten es beobachten“, gab Ellen zu bedenken. „Wenn das Gelenk anschwillt, dann müssen wir damit zum Arzt.“
„Hoffentlich ist es nicht gebrochen?“ sorgte sich Chan.
„Nein, das glaube ich nicht“, beschwichtigte Klaus. „Dann wäre er sicher nicht gleich wieder gelaufen. Das würde er nämlich bei jedem Auftreten ganz schön merken.“
„Vermutlich“, bestätigte Ellen. „Aber hoffentlich ist es auch kein Bänderriß.“
„Also, jetzt wollen wir hier mal nicht den Teufel an die Wand malen, Ellen“, wiegelte Klaus ab. „Wenn er weiterhin Schmerzen hat, dann wird er sich ganz von alleine melden.“
„Das denke ich auch, Ellen“, pflichtete Chan ihm bei. „Dann sagt er das ganz bestimmt.“
Ellen nickte zustimmend und sagte dann nach kurzer Pause: „Ich werde es mir nachher noch einmal genauer anschauen, und gegebenenfalls werden wir halt einen Notarzt aufsuchen. Denn wenn es wirklich etwas Ernstes sein sollte, dann möchte ich damit nicht bis Montag warten.“
„Müßt ihr eigentlich den Notdienst extra bezahlen?“ wollte Qiang wissen.
„Nein“, antwortete Ellen. „Das ist alles durch die AGV, also die ‚Allgemeine Grundversorgung’, abgedeckt, weißt du. Das ist eine staatliche Versicherung, die . . .“
„Nein, nein, das stimmt so nicht“, unterbrach Klaus seine Frau. „Die AGV ist eine privatwirtschaftlich geführte Non-Profit-Firma, die . . .“
„Wie bitte?“ fragte Qiang verwundert. „Eine privatwirtschaftlich geführte Non-Profit-Firma? Das ist ja ein Widerspruch in sich! So etwas gibt’s doch gar nicht! Jede Firma will und muß einen Gewinn erwirtschaften, um wieder investieren zu können.“
„Doch, so etwas gibt es“, widersprach Klaus. „Ich wollte es ja gerade erklären! Wir haben es hier zugegebenermaßen mit einer Sonderkonstruktion zu tun, das ist schon richtig. Es geht hier um die grundlegenden Ansprüche eines jeden Bürgers, die ihm nach unserer Verfassung zustehen und die daher vom Staat gewährleistet werden müssen. Deshalb ist der Staat bei dieser Versicherung Mehrheitsaktionär mit 51 Prozent und kann die Geschäftsziele und die Verwendung der steuerfinanzierten Mittel bestimmen. Aber das tägliche Geschäft wird wie in einem ganz normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen abgewickelt, und der Geschäftsführer muß, wie in der Privatwirtschaft üblich, den Eigentümervertretern Rechenschaft ablegen.“
„Und um welche Ansprüche geht es dabei?“
„Jeder Bürger der EU hat Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das gilt übrigens auch für Ausländer, die hier leben – deshalb auch für euch, wie ihr ja wißt. Dieser Anspruch umfaßt ein generelles monatliches Grundeinkommen unabhängig von der eigenen Arbeitsleistung, die Ausbildung und den freien Zugang zum Informationsnetz, gleiches Recht vor dem Gesetz, medizinische Grundversorgung und Sozialfürsorge, Wohnraum und freie Wahl der Erwerbsmöglichkeit. Mit anderen Worten: Bei uns muß niemand hungern und auf der Straße leben. Niemand muß auf Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen und ärztliche Behandlung im Krankheits- oder Pflegefall verzichten. Niemand muß ungebildet und unwissend bleiben. Niemand darf rechtlich benachteiligt werden. Niemand darf an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit seiner Wahl gehindert werden, solange sie nicht ungesetzlich ist.“
„Sehr sozial!“ lobte Qiang anerkennend.
„Ja, wir leben in einer wirklich sozialen Marktwirtschaft, und wir nehmen unsere Grundsätze sehr ernst“, sagte Klaus mit einer gewissen Genugtuung.
„Allerdings, der letzte Punkt ist mir nicht ganz klar. Ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, daß sich jeder eine Erwerbstätigkeit seiner Wahl suchen kann?“
„Eigentlich schon. Aber bei uns hat man in der Vergangenheit zugereisten Ausländern diese Möglichkeit häufig verwehrt, weil man der Meinung war, die nähmen unseren einheimischen Bürgern die Arbeitsplätze weg. Also, die wollten arbeiten, durften aber nicht. Dafür hat man ihnen Sozialhilfe gewährt, denn von irgend etwas mußten sie ja schließlich leben. Ein Schwachsinn! Das ist Gott sei Dank Vergangenheit.“
„Schön und gut, aber das muß ja alles irgendwie bezahlt werden.“
„Wird es! Das ist die Aufgabe der AGV. Sieh mal: Früher hatten wir allein in Deutschland über 200 Krankenkassen, von den anderen Versicherungen mal ganz abgesehen – was für ein Quatsch! Heute haben wir nur noch eine staatliche, das heißt nicht profit-orientierte, gesetzliche Pflicht-Versicherung, die sehr effizient wirtschaftende AGV. Allein schon dadurch ist der Kostenaufwand für Verwaltung, Personal und Infrastruktur drastisch gesenkt worden. Die AGV spart also gegenüber dem früher undurchsichtigen Versicherungsdschungel sehr, sehr viel Geld. Aber natürlich braucht sie auch Einnahmen, um die nicht unbeträchtlichen Leistungen im Umlageverfahren finanzieren zu können. Dazu zweigt der Staat bei jedem Kapitaltransfer automatisch – neben 20 Prozent für die Steuer – auch 10 Prozent für die AGV ab, so daß jedem Bürger lediglich 70 Prozent seines Nominaleinkommens verbleiben. Dem kann sich niemand entziehen, weil alle Transaktionen bei uns bargeldlos abgewickelt werden, denn es gibt ja kein Geld mehr. So werden zwangsläufig alle an der Finanzierung beteiligt. Du siehst es ja an deinen eigenen Abgaben. Und auf diese Weise kommt schon einiges bei der AGV zusammen, so daß sie ein ganz schön großes Kapitalpolster hat.“
„Ja, leider müssen wir uns auch an diesen Abgaben beteiligen, obwohl wir hier gar keine medizinischen, sozialen oder sonstigen Leistungen in Anspruch nehmen.“
„Doch, ihr habt zum Beispiel die Schulausbildung eurer Kinder frei.“
„Das stimmt, ja. Aber das ist auch schon alles. Ansonsten sind wir ja in China versichert.“
„Das ist eure persönliche Entscheidung. Ihr könntet ja auch hier zum Arzt gehen. Jedenfalls können wir nicht beliebig viele Ausnahmen machen, das würde das ganze System wieder so unübersichtlich machen, wie es früher war. Davon wollten wir ganz bewußt endlich wegkommen! Deshalb haben alle hier in Europa lebenden Bürger die gleichen Rechte und Pflichten. Gleichberechtigung – das wird doch auch sonst immer gewünscht! Also, wer hier leben will, muß sich den Gesetzmäßigkeiten und Gegebenheiten anpassen. Somit müßt ihr auch euer Scherflein dazu beitragen, wie jeder andere – ganz gleich, ob ihr die angebotenen Leistungen in Anspruch nehmt oder nicht.“
„Sicher, das ist schon einzusehen. Es war auch kein ernstgemeinter Einwand von mir.“ Qiang schmunzelte verschmitzt, und auch die anderen konnten sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Also, prinzipiell finde ich dieses System schon sehr gut. Aber sag mal, verleitet es nicht vielleicht auch den einen oder anderen dazu, sich in diese soziale Hängematte zu legen und gar nicht erst eine Arbeit aufzunehmen?“ vermutete Qiang.
„So etwas kannst du in keinem System völlig ausschließen, Qiang. Es wird sicher immer und überall einige geben, die sich auf Kosten des Gemeinwesens durchschlauchen. Aber ich schätze, das sind heutzutage nur wenige, viel weniger als früher. Denn zum einen ist diese Grundversorgung so üppig nicht, sie reicht gerade mal zum Überleben. Viel Freude kommt da nicht auf. Wir wollen schließlich kein Schlaraffenland für faule Säcke! Und wer möchte schon freiwillig auf ein bißchen Luxus verzichten. Zum anderen haben die Menschen ja heute ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten und ganz sicher viel weniger Streß als früher, weil sie einer Tätigkeit nachgehen können, die ihnen Spaß macht. Das war nicht immer so; denk’ nur an stupide Fließbandarbeiten oder sonstige Maloche. Sie werden also eher bemüht sein – ja, sogar das Verlangen haben, in ihrem Wissensgebiet auch tatsächlich eine Arbeit zu finden. Denn die Alternative Nichtstun ist langweilig und auf Dauer sehr öde. Und drittens schließlich haben alle unsere Bürger eine Ausbildung genossen, die auf ethischen und moralischen Grundsätzen fußt, so daß sie wohl eher ein sehr schlechtes Gewissen bekämen, wollten sie als Schmarotzer auf Kosten der Gesellschaft leben. Denn damit stellten sie sich ja selbst ins gesellschaftliche Abseits. Kurz und gut, es gibt sicher nur sehr wenige Schmarotzer, denke ich, und die paar kann unsere Gesellschaft durchaus verkraften.“
„Denkbar, ja. Aber die, die zum Beispiel krankheits- oder altershalber nicht arbeiten können, die müssen auch mit diesem geringen Grundeinkommen auskommen?“
„Nein. In diesen Fällen wirkt die AGV wie eine Erwerbslosen- beziehungsweise Rentenversicherung und überweist entsprechende Zusatzbeträge. Du mußt dir das so vorstellen: Immer wenn du erwerbslos bist, entweder weil du keine Arbeit aufnehmen kannst, oder weil du das Rentenalter erreicht hast, dann wird diese Versicherung wirksam und zahlt dir einen Zusatzversorgungsanteil entsprechend der Höhe deiner kumulierten Beitragsleistungen, mindestens aber einen jährlich neu festgelegten Mindestbetrag, der allerdings auch nicht gerade üppig ist. Damit allein könntest du keine großen Sprünge machen. Aber zusammen mit dem Grundversorgungsanteil, den du ja weiterhin erhältst, kommst du schon einigermaßen gut über die Runden. Also, es wird schon differenziert, ob jemand nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will!“
„Das muß auch so sein!“
„Selbstverständlich. Wir können ja die Leute, die vielleicht unverschuldet erwerbslos geworden und daher auf Hilfe angewiesen sind, nicht im Regen stehen lassen. Und die Rentner haben sich schließlich ihren Anspruch auf ein angemessenes Auskommen im Alter selbst erarbeitet.“
„Und Rentenanspruch habt ihr ab 70?“ glaubte Qiang schon mal gehört zu haben.
„Ja, richtig“, bestätigte Klaus. „Ab 70 erhältst du in jedem Fall deine Rente, egal wieviel du dann vielleicht noch nebenher verdienst.“
„Und wie ist das im Krankheitsfall?“
„Für Leute, die aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht mehr arbeiten können, was im übrigen durch zwei unabhängige ärztliche Gutachter bestätigt werden muß, gilt das gleiche wie für die erwähnten Erwerbslosen, das heißt, sie erhalten ebenfalls einen Zusatzversorgungsanteil entsprechend der Höhe ihrer kumulierten Beitragsleistungen und werden in jedem Fall mit allem Notwendigen versorgt. Bei zeitweiligen Erkrankungen kann unter bestimmten Voraussetzungen der Erwerbsausfall durch die AGV ersetzt werden.“
„Bestimmte Voraussetzungen?“
„Naja, du weißt schon. Natürlich nicht bei jedem kleinen Zipperlein. Aber bei längerem Verdienstausfall, zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten. So eine Durststrecke kann ja der Betreffende im Normalfall nicht selbst überbrücken, also von der Substanz zehren. Man kann es aber auch dem Arbeitgeber nicht anlasten. Dafür muß also die AGV aufkommen. Wir leben in einem Sozialstaat, in dem jeder Bürger seinen Beitrag zum Gemeinwohl in Form seiner Steuer- und Versicherungsleistungen liefert und damit die Grundlage dafür schafft, daß Alte, Schwache, Kranke und sonstige Hilfebedürftige unterstützt werden.“
„Und damit auch die medizinische Versorgung?!“
„Ja, wie schon gesagt: Alle Maßnahmen, die medizinisch notwendig sind, werden von der gesetzlichen AGV bezahlt, Vorsorgeuntersuchungen eingeschlossen. Sie sind in einem Leistungskatalog definiert. Darüberhinausgehende, nicht unbedingt notwendige ärztliche, pflegerische oder sonstige Leistungen sind allerdings dadurch nicht abgedeckt. Die können von jedem, der will und bezahlen kann, durch eine private Zusatzversicherung bei einer freien Versicherungsgesellschaft abgesichert werden. Und besondere Risiken für erhöhte Unfallgefahren, Schäden aus besonders riskanten sportlichen oder sonstigen Unternehmungen beispielsweise, müssen sogar extra versichert sein. Andernfalls erfolgt Privatverrechnung. Denn dafür kommt die AGV nämlich nicht auf.“
„Hört sich alles in allem sehr vernünftig an, wirklich. So ein Sozialstaat ist schon eine feine Sache – solange alles so funktioniert, wie es soll“, sagte Qiang anerkennend. „Bei uns in China gibt es das leider nicht. Da muß jeder selbst sehen, wo er bleibt. Staatliche Unterstützung hat es früher mal gegeben, zu Maos Zeiten. Aber die sozialistische Planwirtschaft mit ihrem Versorgungssystem ist ja lange überholt. Das hat sich alles nicht bewährt.“
„Das war vorauszusehen“, bemerkte Klaus. „Das konnte ja auf Dauer gar nicht gut gehen!“
„Ja, ja. Das ist alles Schnee von gestern, und wir sind letztlich froh darüber. Aber ich hab‘ nochmal eine ganz andere Frage, und zwar zur Ausbildungsversicherung, die du vorhin erwähntest. Wie funktioniert die eigentlich?“
„Aus deiner Frage entnehme ich, daß ihr keine solche Versicherung für eure Kinder abgeschlossen habt.“
„Das ist richtig. So etwas hat uns auch niemand angeboten.“
„Ja, das kann ich dir erklären“, sagte Klaus. „Für jedes neugeborene Kind legt der Staat automatisch eine solche Versicherung bei der AGV an und zahlt einen bestimmten Anfangsbetrag ein, gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk. Die Folgebeiträge müßten von den Eltern gezahlt werden. Ich sage bewußt ‚müßten‘ und nicht ‚müssen‘, weil es freiwillig ist. Der Staat geht mit gutem Beispiel voran, aber wenn die Eltern selbst nichts weiter einzahlen können oder wollen, dann bleibt der Anfangsbetrag halt stehen und wird normal verzinst, bis das Kind 18 ist, und dann ausgezahlt. Damit kommt man natürlich nicht sehr weit, aber wie gesagt, das liegt allein in der Entscheidung der Eltern. Sinnvollerweise sollten sie regelmäßig Beiträge zahlen, damit die Ausbildung der Kinder nach der Schule davon finanziert werden kann, andernfalls müssen sich die Kinder selbst um diese Finanzierung kümmern, indem sie nebenher jobben oder einen Kredit aufnehmen.“
„Das ist interessant“, sagte Chan. „So eine Versicherung haben wir in China nicht.“
„Aber das bekommen nur die hier geborenen Kinder, habe ich verstanden. Richtig?“ fragte Qiang.
„Richtig“, bestätigte Klaus. „Die Initiierung und Bereitstellung des Anfangsbetrages durch den Staat erfolgt ausschließlich bei hier im Lande Neugeborenen. Deshalb gilt es nicht für eure Kinder, die habt ihr ja schon aus China mitgebracht. Hättet ihr sie allerdings hier geboren, dann hättet ihr selbstverständlich die gleichen Anrechte. . . . Übrigens, wenn ich hier immer von unserem Staat spreche, so gilt das alles immer auch im übertragenen Sinne für jedes Land der EU.“
„Hätten wir eigentlich selber, von uns aus, so eine Ausbildungsversicherung für unsere Kinder abschließen können – ohne den Staatszuschuß, versteht sich?“
„Selbstverständlich. Das könnt ihr in jedem Fall.“
„Haben wir aber leider nicht gewußt“, bemerkte Qiang. . . . „Naja, vielleicht ist es auch gut so. Wir wissen ja gar nicht, wie lange wir in Deutschland bleiben.“
„Immerhin haben wir hier den Vorteil, keine Schulgebühren für unsere Kinder zahlen zu müssen“, sagte Chan wie zum Trost.
„Ja, da kommt ihr hier drumherum“, konstatierte Ellen. „Da ihr hier arbeitet und die gleichen Steuer- und Versicherungsbeiträge zahlt wie jeder EU-Bürger auch, habt ihr natürlich auch die gleichen Nutzungsrechte – das ist nur gerecht. Aber Ausländer, die lediglich ihre Kinder hier zur Ausbildung schicken ohne selbst hier zu leben und zu arbeiten, müssen dafür auch Gebühren bezahlen.“
„An den Vorteilen der AGV partizipieren wir allerdings nicht gerade viel“, bemerkte Chan. „Denn die Krankenversicherung nutzen wir zum Beispiel überhaupt nicht, weil wir regelmäßig zweimal im Jahr in China gründlich untersucht und nötigenfalls ärztlich versorgt werden. Wir haben bisher in den ganzen fünf Jahren, die wir inzwischen hier leben, noch nicht ein einziges Mal einen Arzt gebraucht! Naja, und die Erwerbslosenversicherung werden wir sicher – das hoffe ich jedenfalls! – nie in Anspruch nehmen müssen.“
„Weiß man’s?“ fragte Ellen, ohne eine Antwort darauf zu erwarten. „Aber mit der Krankenversicherung wäre ich an deiner Stelle nicht so sicher. Es kann immer ganz schnell mal was passieren, wie gerade bei Gerd zum Beispiel. Und wenn sich eins eurer Kinder nur mal beim Sport verletzt, schon mußt du zum Arzt mit ihm, und dann kannst du froh sein, daß du versichert bist.“
„Ja, klar, so einen Fall kann ich nie ausschließen. Fragt sich nur, ob ich in Summe nicht besser wegkäme, in so einem Fall privat zu verrechnen, anstatt von allen Kapitaltransfers 10 Prozent für die AGV abzuführen.“
„Das hängt natürlich von der Schwere der Krankheit oder Verletzung ab“, wandte Ellen ein. „Eine Operation kann schon ganz schön teuer werden.“
„Ja, sicher. Aber es ist eigentlich müßig, darüber nachzudenken, denn ich habe ja keine Alternative. Ich lebe in dem System, und also muß ich mich dessen Regeln beugen und brav meine Beiträge abführen. Lediglich die freiwillige Zusatzversicherung kann ich mir sparen.“
„Warum fahrt ihr eigentlich immer nach China zum Gesundheits-Check? Das ist doch ganz schön aufwendig. Habt ihr kein Vertrauen zur westlichen Medizin?“ wollte Ellen wissen.
„Hm, . . . nein, das ist es eigentlich nicht“, antwortete Chan. „Natürlich sind wir mit der chinesischen Medizin besser vertraut, das ist keine Frage. Aber wir hegen auch kein Mißtrauen in eure Medizin – wie kämen wir dazu? Wir haben ja bisher keinerlei Erfahrungen damit gemacht. Nein, es ist einfach so, daß wir zu unserer Familie und zu unserem Land eine gute und enge Bindung haben und aufrechterhalten wollen. Und Beziehungen müssen nun mal gepflegt werden, sonst gehen sie verloren. Deshalb fahren wir regelmäßig rüber und pflegen sie. Ja, und wenn wir dann schon mal dort sind, dann nutzen wir die Gelegenheit und lassen uns gleich noch durch-checken. Wir verbinden also einfach das Nützliche mit dem Angenehmen!“
„Verstehe!“ antwortete Ellen lakonisch.
Das hätte ein guter Schlußpunkt für dieses Thema sein können, und Chan wäre dies sicher sehr recht gewesen, weil sie ohnehin nicht die Absicht hatte, hier in Deutschland einen Arzt zu konsultieren. Aber Ellen schien gerade erst richtig zu weiteren Erläuterungen ausholen zu wollen, bevor Klaus sie unterbrach: „Entschuldige mal, macht es euch was aus, wenn wir beide“, und er meinte Qiang und sich, „uns noch ein bißchen in die Ecke zurückziehen? Ich habe mal wieder ein paar technische Fragen an Qiang.“
„Nein, nein. Geht ihr nur“, erwiderte Ellen, „wir kommen schon allein zurecht.“
Mit dem Essen war man ohnehin schon längst fertig, und die Kinder hatten sich bereits vor längerer Zeit in ihren Hobbyraum zurückgezogen.
„Weißt du“, nahm Ellen den Faden wieder auf, nachdem sich die Männer verzogen hatten, „nur um das Thema von eben abzuschließen, möchte ich gerade noch zwei, drei Sätze anfügen.“
Aber, als mochte sie sich mit dem Ergebnis dieser Diskussion nicht zufriedengeben, insistierte sie weiter: „War überhaupt schon mal einer von euch hier beim Arzt?“
Und wieder wartete sie keine Antwort ab, sondern sprach ohne Pause weiter: „Wir haben hier übrigens auch schon seit langem Ärzte, die sich auf TCM verstehen.“ Sie gebrauchte die übliche Abkürzung für ‚Traditionelle Chinesische Medizin‘. „Ihr würdet euch also in gewohnter Umgebung und Behandlung wiederfinden. Also, wenn doch mal jemand von euch hier zum Arzt gehen muß, sagt mir einfach Bescheid. Ich kann euch einen guten Tipp geben.“
„Ja, das ist gut zu wissen, Ellen. Aber, wie schon gesagt, das ist sicher nicht das Problem“, wehrte Chan erneut ab.
„Weißt du“, fuhr Ellen ungerührt fort, „wir haben inzwischen in der ganzen EU ein sehr modernes medizinisches Versorgungssystem. Von den hochmodernen und gut ausgestatteten Krankenhäusern will ich gar nicht reden, die braucht man ja Gott sei Dank sowieso nur wenig bis überhaupt nicht. Was man dagegen häufiger braucht, das sind die niedergelassenen Ärzte. Die haben zwar nach wie vor ihre freien Praxen, aber sie haben inzwischen fast überall interdisziplinäre Gemeinschaften gebildet, die sich in hervorragend ausgestatteten und gut organisierten Ärztehäusern lokal zusammengefunden haben – zum beiderseitigen Vorteil: Die Ärzte können die Infrastruktur und die medizinischen Geräte zumindest zum Teil gemeinsam nutzen. Und auch die administrativen Aufgaben lassen sich auf diese Weise partiell konzentrieren beziehungsweise zentralisieren, so daß der Verwaltungsaufwand für jeden einzelnen reduziert wird. Kurz: Die Ärzte sparen Zeit und Kosten. Die Patienten profitieren davon, daß sie praktisch alle Fachdisziplinen lokal konzentriert vorfinden und deshalb nicht mehr mit ihren Überweisungen ‚von Pontius zu Pilatus’ laufen müssen. Auf diese Weise können sich auch schnell mal zwei oder drei Ärzte direkt miteinander absprechen und einen Patienten gemeinsam, das heißt interdisziplinär, behandeln. Das ist sehr viel aufwand- und zeitsparender und vor allem behandlungseffizienter für den Patienten. Und selbst die Ärzte profitieren davon, weil sie bei diesen Behandlungen im Gespräch mit Kollegen anderer Fachdisziplinen über ihren eigenen ‚Tellerrand’ hinausgucken und auf diese Weise ihren Horizont erweitern können. Also, wieder eine win-win-situation.“
„Das hört sich sehr vernünftig an. Doch, muß ich sagen, Ellen.“
Ellen ließ sich durch diese Bemerkung von Chan in keiner Weise stören, als wenn sie sie gar nicht vernommen hätte, und parlierte munter weiter:
„Die Ärztehäuser sind in der Regel sehr verkehrsgünstig gelegen, was den ÖPNV betrifft, verfügen aber auch über genügend Parkmöglichkeiten für PKWs.
Im Erdgeschoß befinden sich üblicherweise eine Apotheke, ein Café, ein paar Läden sowie eine für alle Praxen im Haus zuständige Erst-Anlaufstelle zum Zwecke der Informationsauskunft und Anmeldung. Man kann dann nach der Anmeldung solange im Café sitzen und warten oder durch die Geschäfte gehen und Besorgungen machen, bis man aufgerufen wird. Man muß also nicht unbedingt im Wartezimmer sitzen. Wenn man zum ersten Mal hinkommt, wird man in der Regel erst einmal bei einem Arzt für Allgemeinmedizin eingeordnet, der die Erstdiagnose stellt und gegebenenfalls anschließend gleich weiter zum entsprechenden Facharzt im Hause überweist. Hat man dagegen einen zweiten oder weiteren Termin beim selben behandelnden Arzt, dann wird man sofort in die betreffende Warteliste eingereiht. Teilweise sind in diesen Ärztehäusern, zumindest in den gutgehenden, auch schon mal zwei Fachpraxen derselben Disziplin, so daß man ‚seinen’ Doktor auswählen kann. Auch sind dann die Wartezeiten nicht so groß.“
„Interessant, ja! Und sehr vernünftig.“
„Was ich auch sehr vernünftig finde, ist, daß jeder Patient auf seinem PACCS seine gesamte Krankenakte von Kindheit an gespeichert hat – alles verschlüsselt natürlich! Früher hätten die Datenschutzbeauftragten ‚Zeter und Mordio’ geschrien. Aber inzwischen sind die Datenschutzverfahren so sicher, daß man keine Befürchtungen wegen Datenklaus und -mißbrauchs mehr zu haben braucht. Und es ist ja ein Riesenvorteil, daß der Arzt die für die Anamnese notwendigen Daten des Patienten – dessen Einwilligung vorausgesetzt – auslesen und sich auf diese Weise unmittelbar einen schnellen Überblick über mögliche Vorerkrankungen oder Unverträglichkeiten verschaffen kann. Das befähigt ihn, eine fundiertere Diagnose zu stellen und eventuelle Allergien bei der Verschreibung von Medikamenten entsprechend zu berücksichtigen. Bei Abschluß der Behandlung werden die Diagnose und gegebenenfalls die durchgeführten Behandlungsmaßnahmen gemäß Leistungskatalog sowie die verordneten weiteren Maßnahmen auf den PACCS zurückgeschrieben.“
„Wie wird denn die Leistung abgerechnet?“
„Die dafür zu erstattenden Gebühren werden automatisch und unmittelbar von der Arztpraxis an die AGV und gegebenenfalls an die private Zusatzversicherung des Patienten gemeldet, die die entsprechenden Ärztehonorare am Monatsende überweisen. Der Patient erhält zu seiner Information eine Kopie der Rechnung und hat somit die Möglichkeit zur Kontrolle der verrechneten Leistung. Es gibt keine zwischengeschaltete Institution mehr, wie beispielsweise früher die Kassenärztliche Vereinigung. Durch den Wegfall dieses unnötigen Verwaltungs-Overheads werden Kosten gespart und mehr Transparenz gewährleistet.“
„Bei uns in China müssen wir immer gleich selber die Arztrechnung bezahlen und können sie danach – soweit wir versichert sind – bei der Krankenkasse einreichen.“
Plötzlich stand Gerd Eppelmann im Raum und sagte zu seiner Mutter: „Mein Fuß ist angeschwollen und schmerzt immer noch.“
„Hab ich’s doch befürchtet! seufzte Ellen. „Zeig mal her!“
Sie begutachtete den Fuß und beschloß dann: „Wir sollten doch gleich noch den Arzt aufsuchen, bevor die Sache noch schlimmer wird.“ Und Chan zugewandt fuhr sie fort: „Siehst du, so schnell kann es gehen. Tut mir leid, wenn wir jetzt so plötzlich aufbrechen müssen, aber die Gesundheit geht vor. Dafür habt ihr sicher Verständnis.“
Selbstverständlich hatten die Wangs Verständnis dafür. Und sehr viel länger hätte das Zusammensein ohnehin nicht mehr gedauert. Die Eppelmanns packten ihre Sachen zusammen, verabschiedeten sich von den Gastgebern und verließen das Haus.