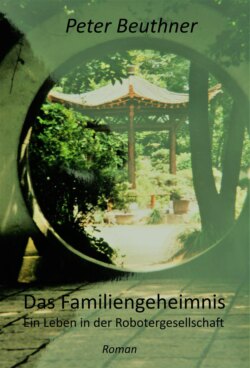Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Besuch bei Freunden
ОглавлениеEinige Tage später waren die Wangs bei Freunden, den Eppelmanns, zum Abendessen eingeladen. Sie besuchten sich wechselseitig relativ häufig, und es waren immer irgendwie interessante und amüsante Begegnungen. Auch die Kinder verstanden sich sehr gut mit denen von Eppelmanns, zwei Jungen, nur wenig älter als Long und Jiao.
Qiang hatte Klaus Eppelmann schon vor vielen Jahren, als er noch in China lebte, anläßlich einer Geschäftsreise nach Deutschland kennengelernt. Er war damals noch in der Roboterfirma seines Großvaters in Nanjing, in der Nähe von Shanghai, als Chefingenieur tätig und wollte auf seiner Reise einigen seiner Kunden, aber auch einigen potentiellen Neu-Kunden sein neuestes Roboter-Modell präsentieren. Einer dieser Interessenten war Klaus Eppelmann, Geschäftsführer in einem Unternehmen der Verteidigungsindustrie mit Sitz in Ulm, dem es dabei um eine neue Generation von Kampf-Robotern mit einer sehr viel größeren Performance ging, wie sich die Ingenieure auszudrücken pflegten, als sie die Vorgängerversion aufwies. Und daraus sind dann allmählich gute Geschäftsverbindungen und mit der Zeit auch gute persönliche Beziehungen entstanden.
Persönliche Beziehungen, sogenannte Guangxi, waren für Chinesen schon seit den Zeiten feudalistischer Gesellschaftsordnung von elementarer Bedeutung, denn nur ein möglichst gut funktionierendes und breites Beziehungsgeflecht konnte einen relativ zuverlässigen Schutz der eigenen Interessen gegen die allgegenwärtige bürokratische Korruption gewährleisten. Sie umfaßten sowohl formelle als auch rein informelle Verbindungen im privaten wie im beruflichen Umfeld, und sie beruhten auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. So bestand einerseits die Verpflichtung, anderen Mitgliedern des Netzwerkes zu helfen, andererseits aber auch die Sicherheit, diese Hilfe selbst in Anspruch nehmen zu können. Die Guangxi übernahmen somit eine zentrale Integrationsfunktion und bildeten gewissermaßen das soziale Netz der chinesischen Gesellschaft. Deshalb wendeten die Chinesen sehr viel Zeit und Mühe für den Aufbau und die Pflege solcher Beziehungen auf, oft mehr als für ihre Arbeit. Wer über Guangxi verfügte, kam schneller, oder überhaupt nur dann, an die gewünschten Informationen, erhielt Genehmigungen für seine Vorhaben, hatte Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, hatte generell mehr Erfolg bei der Erreichung seiner Ziele und konnte selbst schwierigste Probleme am Gesetz vorbei regeln lassen. Andererseits ging er aber mit jeder Inanspruchnahme einer Gunsterweisung auch eine Verpflichtung zur Gegenleistung ein – eine Hand wäscht die andere, sagt man dazu in Deutschland –, so daß dieses Beziehungsnetz mit seinen Loyalitätsverpflichtungen und Dankesschulden zu einer großen persönlichen Belastung werden konnte. Dessenungeachtet hatte sich dieses Sozialverhalten über Jahrtausende tief in den Köpfen der Chinesen verwurzelt, wie auch die Korruption, und beides konnte selbst im kommunistischen China nicht überwunden werden – trotz aller Bestrebungen und Veranlassungen der herrschenden Klasse.
Klaus Eppelmann und seine Kinder erwarteten die Wangs schon im Vorgarten, während seine Frau noch in der Küche mit der Zubereitung des Essens beschäftigt war. Sie wußten aus Erfahrung, daß die Wangs immer sehr pünktlich waren, denn, obwohl diesen die hierzulande übliche Inanspruchnahme des sogenannten akademischen Viertels hinlänglich bekannt war, hielten sie es persönlich doch nach wie vor mit der chinesischen Konvention, nach der ein Gast seinen Gastgeber niemals warten lassen durfte, weil dies als Unhöflichkeit empfunden würde. Deshalb erschienen sie zu Verabredungen regelmäßig überaus pünktlich. Die Begrüßung war – wie unter alten Freunden üblich – sehr herzlich.
„Schön, euch wiederzusehen“, sagte Klaus, indem er Chan an sich drückte und sie auf beide Wangen küßte – und dann, zu Qiang gewandt: „Du mußt mir unbedingt vom Stand deiner Vertragsverhandlungen erzählen, ich bin schon wahnsinnig neugierig.“
Die Kinder waren inzwischen schon in den Garten gelaufen und vergnügten sich dort unüberhörbar. „Aber kommt doch erst mal rein“, sagte Klaus, „die Kinder können ruhig noch etwas draußen herumtoben, bis das Essen fertig ist.“
Klaus Eppelmann war von großer, etwas bullig wirkender Gestalt. Das fiel ganz besonders deutlich auf, wenn er neben Qiang stand, der trotz seiner etwa Einmeterfünfundachtzig mit seiner sehr schlanken, fast schmächtigen Figur recht klein daneben wirkte. Auch im Alter unterschieden sie sich deutlich. Klaus Eppelmann war fast zwanzig Jahre älter und nahm intuitiv die Rolle des väterlichen Freundes in dieser Beziehung wahr.
Sie gingen ins Wohnzimmer, wo sie kurz darauf Ellen Eppelmann begrüßte, eine etwas rundliche Frau um die Mitte Vierzig mit einem sehr freundlichen, warmherzigen Gesichtsausdruck. Sie war – wie man so sagt – die gute Seele des Hauses, die ausgleichende, mit viel Geduld ausgestattete Kraft, der es auch in manchmal etwas hitziger ausgetragenen Auseinandersetzungen zwischen den Jungs oder zwischen Vater und den Söhnen immer wieder gelang, den häuslichen Frieden herzustellen.
Die Jungs waren sechzehn und vierzehn Jahre alt, in einem Alter also, in dem sie sich nicht gern bevormunden ließen, weder vom Bruder noch von den Eltern. Sie reagierten leicht gereizt und trotzig, wenn sie auch nur das Gefühl hatten, jemand wollte ihnen irgendwelche Vorschriften machen. Aber Ellen verstand es immer wieder, die Wogen zu glätten – mit diplomatischem Geschick und viel Fingerspitzengefühl.
„Wie geht es euch?“, fragte sie und umarmte beide nacheinander. Ohne lange auf eine Antwort zu warten, fuhr sie fort, Chan zugewandt: „Ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen. Ich muß aber eben noch schnell in die Küche, kommst du mit?“
Eppelmanns hatten natürlich auch einen Hausroboter. Den hatte Qiang ihnen mal anläßlich eines Geburtstages von Ellen geschenkt, aber Ellen ließ es sich nicht nehmen, das Essen selber zuzubereiten. Sie kochte leidenschaftlich gern, und sie war dabei stets am Experimentieren und Probieren, und so komponierte sie immer wieder interessante und sehr gut schmeckende, aber auch optisch sehr ansprechende Variationen. Sie empfand diese Tätigkeit als äußerst kreativ, denn dabei konnte sie täglich alle ihre Sinne von neuem ins Spiel bringen. Essensmonotonie und Fast Food waren Fremdworte, die in Eppelmanns Sprachschatz gar nicht vorkamen – im Gegenteil, Essen bei Eppelmanns war immer ein Erlebnis. Und so war natürlich klar, daß Frau Eppelmann da keinen Roboter heranlassen wollte. Selbst das Servieren des Essens ließ Ellen sich nicht nehmen. Es war für sie ein Stück Tradition, die sie sehr liebte und pflegen wollte, ein Teil der Kultur. Aber da war auch ein unbestimmtes, schwer definierbares Gefühl, das sie davon abhielt, den Roboter das Essen machen zu lassen. So setzte sie diesen vorwiegend für Reinigungs- und sonstige Hausdienste, aber natürlich auch draußen bei der im Schwäbischen üblichen Kehrwoche ein. Den Tisch durfte er nur decken und später wieder abräumen.
Inzwischen hatte Klaus Qiang zu sich herangezogen und ging mit ihm ins Wohnzimmer zur Sofaecke. „Erzähl doch mal, wie deine Geschäfte laufen. Klappt es jetzt eigentlich mit der Übernahme von AnthropoTech, oder gibt es da immer noch Probleme?“
Ein Strahlen ging über Qiangs Gesicht, er konnte seine Freude nicht verbergen, und noch bevor er anfangen konnte, zu erzählen, ergänzte Klaus gleich noch: „Ah, ich sehe schon – es hat endlich geklappt! Erzähl doch mal!“
„Ja“, fing Qiang an, „es hat geklappt, wir sind uns grundsätzlich einig geworden. Natürlich sind noch verschiedene Details zu klären. Aber die kriegen wir schon in den Griff.“
„Wirst du den Standort dort aufrechterhalten?“
„Wir haben es noch nicht endgültig entschieden, aber ich tendiere eher dazu, den Standort Leipzig zu schließen und die für uns wichtigen Know-how-Träger nach Ulm zu holen – jedenfalls, soweit notwendig. Viele arbeiten ja ohnehin die meiste Zeit zu Hause, und in der Produktion haben wir – wie du weißt – nur noch wenige Ingenieure, genaugenommen sogar nur zwei, wenn ich mal die freien Mitarbeiter außer acht lasse. Unsere Roboter vervielfältigen sich ja völlig selbständig. Naja, und die notwendigen Abstimmungsgespräche erledigen wir ja überwiegend per Videokonferenz übers WorldNet. Und wenn wir tatsächlich mal einen Workshop machen – und das machen wir insbesondere auch zur Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen, weil die Leute einfach besser miteinander kooperieren und sich wirklich als Team verstehen, wenn sie sich persönlich einigermaßen gut kennen – dann können die Leute von Leipzig auch mal schnell für ein paar Stunden oder auch Tage herkommen, so weit ist das ja nicht.“
„Ja, ja, du hast recht“, pflichtete Klaus bei, „du hast uns gegenüber den großen Vorteil, daß deine Produktion weitgehend automatisch ablaufen kann, weil du en masse produzierst. Unsere Systeme hingegen sind eher Einzelfertigungen. Wir sind schon froh, wenn wir mal einen Auftrag über fünf oder gar zehn Systeme bekommen – dafür lohnt sich das Anlernen deiner Roboter nicht einmal.“
„Oh, sag das nicht!“ unterbrach ihn Qiang entschieden. „Unsere Roboter zeichnen sich gerade durch sehr hohe kognitive Fähigkeiten aus, sie ‚kapieren' unheimlich schnell. Ich garantiere dir, daß du mit unserem Roboter schon bei deinem zweiten System einen Profit machst, wenn du ihn beim ersten System anlernst. Das zweite macht er garantiert schon völlig selbständig.“
„Klingt märchenhaft. Aber woher soll denn der Profit kommen? Ich brauche die Leute doch trotzdem weiterhin, weil die nächste Systemvariante schon wieder ganz anders aussehen kann. Und die kann mir dein Roboter nicht entwickeln – dafür brauchen wir immer noch die Kreativität unserer Ingenieure.“
„Aber schau doch mal. Während . . .“, und er sprach das „während“ sehr betont und gedehnt, „die Roboter die Kleinserie bauen, können doch deine Ingenieure bereits über dem nächsten Modell ‚brüten‘, verstehst du?“
„Ja, ja, das klingt ganz plausibel, zumindest theoretisch – und wenn es denn wirklich so funktionierte, wie du sagst. Aber in der Praxis haben wir auch gar nicht immer gleich die Anschlußaufträge, um schon gleich wieder ein neues Modell zu entwickeln.“
„Und trotzdem kannst du zumindest in der Produktion die Monteure einsparen, weil die Roboter diese Aufgabe sehr viel kostengünstiger übernehmen können und letztlich sogar präziser arbeiten.“
Sie waren so vertieft in ihr Gespräch, daß sie gar nicht gehört hatten, wie sie von den Frauen zum Essen gerufen worden waren. Erst als diese näher an den Tisch herantraten, wurden die Männer aufmerksam und unterbrachen ihr Gespräch. „Darauf kommen wir aber nochmal zurück“, sagte Klaus, „das will ich schon noch etwas genauer wissen.“
Die Tafel – zwei Tische, die man zusammengestellt hatte – war inzwischen gedeckt, und die Kinder kamen gerade vom Händewaschen zurück. „Tante Ellen!“ rief Jiao, doch bevor sie aussprechen konnte, was sie sagen wollte, stolperte sie über ihre eigenen Füße und fiel zu Boden. „Autsch!“, rief sie und rieb die Hände über die Knie.
Alexander, der ältere der beiden Eppelmann-Kinder, sprang ihr sofort besorgt zu Hilfe und hob sie behutsam auf. Ihr linkes Knie begann leicht zu bluten.
„Soon Mist!“ rief sie ärgerlich.
„Komm mal mit ins Bad, Jiao“, sagte Ellen, „wir waschen es ab, und dann machen wir ein Pflaster drauf.“
Kurze Zeit später saßen alle am Tisch und genossen das vorzügliche Essen. Es gab Fenchelsalat Orangerie, kleine Pasteten mit Fischklößchen, Hühnerconsommé mit Gemüse, Kalbsrippenstück aus dem Backofen mit Zucchinigratin und Kartoffelschnee, und zum Dessert gab es Birnen in Ingwerwein für die Erwachsenen beziehungsweise Mousse au Chocolat für die Kinder, worauf sich diese schon ganz besonders freuten.
„Was wolltest du mir denn eigentlich vorhin so eilig sagen?“ fragte Ellen Jiao.
„Ach, ich wollte dich eigentlich nur was fragen“, antwortete diese.
„Und? Ist es jetzt nicht mehr so wichtig?“
„Doch schon, aber ich weiß nicht, ob es jetzt hier so richtig paßt.“
„Ja, worum geht es denn?“
„Ach weißt du, wir haben uns vorhin so ‘n bißchen über die Zeit, in der wir leben, unterhalten. Und dann sind wir an der Frage hängengeblieben, wie diese Zeit, also die Globalisierungszeit, eigentlich angefangen hat. Wir hatten ja vorher zwei Weltkriege und dann die Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Und danach fing ja praktisch die Globalisierungszeit an. Aber wie kam es zu dieser Entwicklung? Wodurch wurde das ausgelöst? Oder anders gefragt: Warum hat es sich gerade so und nicht anders entwickelt? Und da waren wir uns eben nicht einig.“
„So, so!“ sagte Ellen.
„Ja. Long meint, die neuen Technologien, und zwar insbesondere die Informations- und Kommunikationstechnologien, und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten seien ausschlaggebend für die ganze weitere Entwicklung gewesen. Jie ist dagegen der Meinung, daß die wirtschaftspolitische Entwicklung maßgeblich war. Durch die vielen Firmenfusionen und ‚feindlichen Übernahmen‘, und was es da sonst noch alles gab, sind die Konzerne immer größer und mächtiger geworden, und sie expandierten dabei auch über Ländergrenzen hinweg, also sie agierten globaler. Und damit stieg auch ständig ihr Einfluß auf die Politiker und deren Entscheidungen. Alexander und ich sind der Meinung, daß die Auflösung der politischen Blöcke Ost-West eigentlich erst dazu führte, daß die Firmen jetzt auch in Länder expandieren konnten, in die sie vorher keinen Zugang hatten, und das hat eine richtige Expansionswelle ausgelöst. Ja, und Gerd meint“, – Gerd war der jüngere Sohn der Eppelmanns – „daß die zunehmende Ausbreitung des Terrorismus’ eigentlich die ganze Entwicklung getrieben hat.“
Sie schaute fragend in die Runde und fuhr dann fort: „Ich finde das alles wahnsinnig spannend, und irgendwie habe ich das Gefühl, daß letztlich alle diese Faktoren ihren Einfluß auf die Entwicklung hatten, aber ich möchte es gern wissen“, die Betonung überdeutlich auf das „wissen“ legend. „Ich würde gern die Zusammenhänge verstehen.“
„Ich weiß, daß du sehr daran interessiert bist“, antwortete Ellen, „nicht umsonst bist du meine beste Schülerin!“
Ellen hatte Geschichte und Politikwissenschaften studiert und war jetzt Lehrerin an dem im Zentrum von BrainTown gelegenen Einstein-College. Sie liebte ihren Beruf und verstand es ausgezeichnet, ihre Schüler für die historischen wie auch für die aktuellen politischen Vorgänge und Zusammenhänge zu interessieren.
„Und dein Gefühl, daß nicht nur einzelne, sondern die Summe all dieser und vielleicht noch einiger weiterer Faktoren maßgeblich für diese geschichtliche Entwicklung waren, ist sicher richtig. Aber das Thema ist naturgemäß sehr komplex und nicht einfach zu verstehen; auch nicht einfach zu erzählen. Trotzdem, und gerade weil ihr daran so interessiert seid, bin ich natürlich gerne bereit, diesen Themenkomplex mal etwas ausführlicher mit euch zu besprechen. Allerdings würde das heute abend viel zu weit führen, deswegen schlage ich vor, wir setzen uns mal an einem der nächsten Samstage für ein paar Stunden zusammen.“
„Au ja“, schoß es förmlich aus Jiao heraus, „von mir aus gleich am nächsten Samstag!“
„Nächsten Samstag haben wir schon etwas vor, vielleicht in der übernächsten Woche? Ich schaue gleich mal in meinen Kalender. Vielleicht wäre es ja auch nicht schlecht, wenn Klaus dabei wäre – er kann gerade zu den wirtschaftlichen Fragen natürlich viel mehr sagen als ich. Was meinst du, Klaus?“
„Äh, . . . ja, natürlich gerne – wenn wir einen Termin finden, der paßt?!“
„Gut, dann denkt bitte daran, daß wir nach dem Essen mal einen passenden Termin heraussuchen“, sagte Ellen.
„Ich finde es ja wirklich phänomenal, daß unsere Kinder so wißbegierig sind und sich schon in dem Alter mit so schwierigen Gesellschaftsthemen auseinandersetzen“, sagte Chan und schaute dabei ein Kind nach dem anderen anerkennend an.
„Ja, das ist es in der Tat“, bestätigte Ellen, „aber bei den Eltern auch kein Wunder!“ Dabei lachte sie laut auf.
„Eigenlob stinkt!“ rief Gerd Eppelmann dazwischen und schaute seine Mutter etwas vorwurfsvoll an.
„Ja, ja. Es war ein Scherz!“ beruhigte Ellen ihn. „Aber Spaß beiseite. Daß die Kinder heutzutage ganz offensichtlich wesentlich stärker zum Lernen motiviert sind als früher, das hängt sicher zu einem ganz wesentlichen Teil mit unserem hervorragenden Bildungs- und Gesellschaftssystem zusammen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Gott sei Dank wird ja der Aus- und Weiterbildung inzwischen endlich die ihr gebührende sehr hohe Priorität eingeräumt. Lange genug hat es wahrlich gedauert, bis unsere Politiker nicht mehr nur in Talk-Shows und schönen Sonntagsreden darüber fabulierten, sondern endlich mal was in die Tat umgesetzt haben!“
Qiang und Chan schauten sie fragend an.
„Ja, das ist richtig“, pflichtete Klaus ihr sofort bei. „Wenn ich bedenke, wie das noch zu meiner Schulzeit aussah und wieviel Mühe es – über Jahrzehnte! – gekostet hat, den jetzigen Zustand zu erreichen, dann können wir uns wirklich glücklich schätzen, daß wir überhaupt so weit gekommen sind. Also ich hatte, ehrlich gesagt, schon nicht mehr daran geglaubt. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Deutschen allein – ohne die EU – wären noch längst nicht soweit, sie würden sich immer noch um Kaisers Bart streiten.“
„Wie meinst du das?“ wollte Chan wissen.
„Ach weißt du, das ist so eine Redewendung bei uns“, erklärte Klaus, „wenn sich die Leute um Nebensächlichkeiten streiten, anstatt sich um das Wichtige zu kümmern. Ich will damit sagen, es gab sehr viele Selbst-Berufene aller möglichen Couleur, die sich in schönen Sonntagsreden darüber ausließen, wie wichtig eine gute Bildung für unsere Zukunftschancen sei und daß man deshalb jedes einzelne Kind optimal fördern müsse, aber in der Praxis änderte sich leider nur wenig bis nichts. Es wurden zwar hier und da mal einige Versuche in die eine oder andere Richtung unternommen, es blieb dann allerdings meistens beim Experimentieren. Neue Konzepte wurden nicht umgesetzt, weil man sich schon über die konkreten Vorschläge nicht einigen konnte. Statt dessen wurden hitzige Debatten über das bessere System und die Bezahlbarkeit geführt. Kaum hatte einer einen Verbesserungsvorschlag gemacht, dann meldeten sich auch sogleich etliche Bedenkenträger und Besserwisser zu Worte und erklärten, daß der Vorschlag aus diesen und jenen Gründen nichts tauge und daß sie ihn deshalb auf gar keinen Fall mittragen könnten. Es gab teils heftige gegenseitige Beschuldigungen zwischen Pädagogen, Schülern, Eltern, Kultusbeamten, Politikern und Medien wegen fehlender Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel durch die Politiker, wegen Ignoranz und falscher Prioritätensetzung der Kultusbeamten, wegen mangelnder Fähigkeiten der Pädagogen, wegen desinteressierter, unerzogener und gewaltbereiter Kinder, wegen Erziehungsversäumnissen der Eltern, und so weiter. Der ‚Schwarze Peter’ wurde immer im Kreis herumgereicht. Es war eine endlose, zum Teil äußerst kleinkarierte und in der Summe völlig unfruchtbare Streiterei. Genauso die Parteien: Keine Seite gönnte der anderen einen Erfolg, indem sie ihr auch mal zugestand, einen brauchbaren Vorschlag gemacht zu haben, und dessen Umsetzung dann auch zu unterstützen. Nein, aus reiner Prinzipienreiterei oder Parteitaktik wurde dann lieber gar nichts unternommen, und alles blieb in dem allseits beklagten Zustand.“
„Ja, leider viel zu lange“, hakte Ellen ein. „Für mich völlig unverständlich ist vor allem, daß insbesondere die Kultusminister, deren ureigene Aufgabe es ja gerade war, für das bestmögliche Schulsystem zu sorgen, daß ausgerechnet die so lange die von vielen Fachleuten empfohlenen Systemverbesserungen ignorierten und penetrant ihr altes, längst überholtes mehrgliedriges Schulsystem, in dem die Schüler bereits nach der vierten Klasse auf unterschiedliche Schularten – Hauptschule, Realschule, Gymnasium – verteilt wurden, verteidigten. Schon nach der vierten Klasse! Da kann man doch noch gar nicht richtig beurteilen, was wirklich in einem Kind drinsteckt! Vor allem die sogenannten Spätentwickler wurden auf diese Weise ihrer Chancen beraubt. Aber die Selektion war unerbittlich, und die in die Hauptschulen Abgeschobenen ahnten sehr bald, daß ihre Berufsaussichten mehr als hoffnungslos waren. Die natürliche Folge: Frust und Resignation in steigendem Maße, geringes Selbstwertgefühl und zunehmende Empfänglichkeit für ‚Heilsbotschaften’, Abrutschen in Gauner- und Verbrecherkreise, erhöhte Gewaltbereitschaft, steigende Belastung für die Gesellschaft – eine unheilvolle Spirale in das Verderben. Das ist aber leider noch nicht das Ende der Story. Denn daneben gab es nämlich sogar noch eine Reihe von Sonderschulen, in die die Lernbehinderten und Langsamlerner, aber auch die Störer, die Aggressiven, die Armen, die Vernachlässigten und Migranten geschickt wurden. Anfang dieses Jahrtausends saß bereits jeder zwanzigste Schüler in Deutschland in einer Sonderschule – mit steigender Tendenz! Und von denen schafften durchschnittlich nur etwa 20 Prozent einen Schulabschluß. Daran sieht man doch, daß mit diesem Schulsystem etwas nicht stimmen kann! Denn wenn die Regelschulen einen wirklich guten Unterricht böten, dann wären die Sonderschulen völlig überflüssig, und selbst das Hauptschulniveau wäre nicht nötig. In anderen europäischen Ländern gab es genügend Beispiele für bessere Schulsysteme, was durch die vergleichenden PISA-Studien immer wieder bestätigt wurde. Aber in Deutschland lernte man nicht daraus, oder jedenfalls viel zu spät und zu langsam. Und selbst als Deutschland von der UN eine ‚Politik der Absonderung’ attestiert wurde, scherte das die Kultusminister in keiner Weise. Im Gegenteil, mit einem gerüttelt Maß an Arroganz unterstellten sie dem zuständigen UN-Inspektor, keine Ahnung vom ‚hervorragenden deutschen Bildungswesen’ zu haben.“
Das war nun genau das Stichwort, auf das Klaus schon lange gewartet hatte, um seinen zuvor von Ellen unterbrochenen Redefluß wiederaufnehmen zu können und nahtlos mit seiner Schimpfkanonade fortzusetzen:
„Und das war ja nicht nur in der Schulpolitik so. Überall wurde blockiert. Es fehlte schlicht und einfach der Wille zu einer Einigung! Das war ganz evident! Unsere Politiker handelten nicht mehr im Interesse und zum Wohle Deutschlands, wozu sie eigentlich verpflichtet waren, sondern nur noch taktiererisch im Sinne ihrer Partei und für sich selbst! Wichtige gesellschaftliche Themen, die dringend einer Entscheidung bedurft hätten, dümpelten in Form von durch ständige Wiederholungen abgedroschenen Sprechblasen und leeren Worthülsen plan- und ziellos bis zum Überdruß durch den Raum und verschwanden schließlich wieder, ohne daß sich auch nur das Geringste im Sinne einer Problemlösung getan hätte. Nein, nein! Es war schlicht deprimierend, diese krasse Diskrepanz zwischen vorgetäuschter Aktivität, die sich lediglich in verbalen Scheingefechten und eitler Selbstdarstellung erschöpfte, einerseits und Lethargie bis zur Ohnmacht im Handeln andererseits mit ansehen zu müssen. Es ist traurig, aber wahr: Die ganze politische Klasse in Deutschland hat seinerzeit völlig versagt!“
Ellen versuchte durch Handzeichen, mäßigend auf ihren Mann einzuwirken, und sagte, den Wangs zugewandt, entschuldigend: „Bei dem Thema kann er sich immer so richtig in Rage reden.“
„Darüber kann man sich ja auch aufregen!“ entrüstete Klaus sich, deutlich lauter werdend. „Nein, darüber muß man sich sogar aufregen! So etwas ist völlig inakzeptabel! Wenn wir in der Wirtschaft so agieren würden wie die Politiker in der ‚Deutschland AG‘, dann wären die Unternehmen längst pleite!“
„Dabei war es ziemlich egal, welche Partei gerade an der Regierung war“, ergänzte Ellen. „Deshalb haben wir uns bei jeder Wahl mit unserer Entscheidung, wen wir eigentlich wählen sollten, immer wieder sehr schwer getan.“
„Und wir haben ja dauernd Wahlen“, ergänzte Klaus und zählte auf: „Eine Wahl zum europäischen Parlament, eine Bundestagswahl, sechzehn Landtagswahlen und dann noch die Gemeinderatswahlen! Jede Partei möchte natürlich gewinnen, was ja verständlich ist. Aber daß deswegen überhaupt nichts mehr voran geht, nur noch Stillstand herrscht und Lähmung sich wie Mehltau über das ganze Land ausbreitet, das ist für mich völlig unverständlich, ja, das ist sogar in höchstem Maße skandalös! Da muß ich mich einfach aufregen! . . . Ja, und dann immer noch dieses Kleinstaaterei-Denken“, echauffierte sich Klaus weiter, „das die Leute einfach nicht aus den Köpfen kriegen – bis heute nicht! Jeder kleine Landesfürst ist eben ein Fürst, und er verteidigt seine angestammten landeshoheitlichen Rechte, wie zum Beispiel auch die Kulturhoheit – und damit komme ich mal wieder auf unser Thema zurück –, mit Zähnen und Klauen. Stellt euch das mal vor: In jedem noch so kleinen Bundesland hatten sie ihre eigenen Lehrpläne und Schulbücher. Wenn du da von einem Bundesland in ein anderes umziehen wolltest oder mußtest – und von uns wurde Mobilität und Flexibilität in jeder Hinsicht ja immer wieder ausdrücklich gefordert! –, dann hatten die Kinder mitunter nicht unerhebliche Probleme mit der Umstellung und den veränderten Verhältnissen. Auch die Prüfungen fielen unterschiedlich streng aus – mit dem Ergebnis, daß das eine Abiturzeugnis mehr oder weniger wert war als das andere. Und die Kultusminister der Länder stritten sich über Jahrzehnte um teilweise lächerliche Lappalien – bloß keine Vereinheitlichung! Oh, ich darf mir das gar nicht weiter ausmalen, sonst kriege ich jetzt noch Zustände!“
„Naja, das ist ja nun, Gott sei Dank, heute schon alles viel besser“, versuchte Ellen die Schimpfkanonade ihres Mannes zu stoppen. „Und es lag ja auch nicht allein an den Politikern. Selbst in den Schulen müssen zum Teil ziemlich frustrierende Zustände geherrscht haben. Die Lehrer hatten keine Autorität mehr. Die Schüler sind ihnen förmlich auf der Nase rumgetanzt, zum Teil haben sie sie sogar bedroht. Und mancher durchgeknallte Schüler hat sogar einige seiner Mitschüler und Lehrer erschossen – furchtbare Zustände. Ich kann mich noch gut an die Erzählungen meiner Eltern von ihrer Schulzeit erinnern, und selbst in meinen ersten Schuljahren waren die Verhältnisse ja auch noch ziemlich unbefriedigend. Also in dieser Zeit hätte ich kein Lehrer sein mögen!“
„Glücklicherweise hat sich das ja nun erledigt“, sagte Klaus und beruhigte sich langsam. „Es hat lange gedauert, aber sie haben es letztlich doch noch hingekriegt – unsere Politiker, europaweit!“
„Glücklicherweise, ja“, pflichtete Ellen ihm sofort bei und nutzte gleich die Gelegenheit, die negative Beschreibung des alten Zustandes endlich abzubrechen und das Thema aus einer positiveren Sicht zu betrachten: „Glücklicherweise ist das alles Schnee von gestern. Inzwischen herrscht ein völlig anderes Klima an den Schulen. Das ganze Schulsystem ist sehr verbessert worden!“
Ellen schien gerade erst richtig zu weiteren Erläuterungen ausholen zu wollen, als Klaus sie unterbrach: „Entschuldige mal, macht es euch was aus, wenn wir beiden“, und er meinte Qiang und sich, „uns noch ein bißchen in die Ecke zurückziehen? Ich habe da noch ein paar technische Fragen an Qiang.“
„Nein, nein. Geht ihr nur“, erwiderte Ellen, „wir kommen schon allein zurecht.“
Mit dem Essen war man ohnehin schon längst fertig, und die Kinder hatten sich bereits vor längerer Zeit in ihren Hobbyraum zurückgezogen.
„Weißt du“, nahm Ellen den Faden wieder auf, nachdem sich die Männer verzogen hatten, „das Bildungssystem ist so ein ‚Lieblingsthema’ bei uns. Für mich sowieso, denn für mich ist es Profession, und für Klaus ist es immer wieder ‚ein gefundenes Fressen’, sich über die Unfähigkeit der politischen Klasse zu mokieren.“
„Ja, scheint ihm Freude zu machen.“
„Freude? Nein, das kann man eigentlich nicht behaupten, wenn es vielleicht auch manchmal den Anschein haben mag. Im Grunde ärgert es ihn eher. Er hat ja auch geschäftlich sehr viel mit Politikern zu tun – zwangsläufig. Aber da kommt er oft enttäuscht oder gar deprimiert zurück. Und trotzdem muß er dabei immer noch gute Miene zu den hohlen Phrasen einiger aufgeblasener Wichtigtuer machen, obwohl ihm so etwas eigentlich gar nicht liegt. Er vertritt viel lieber ganz offen seine ehrliche Meinung. Naja, und da bietet sich das Thema Schulpolitik, in dem sich gleich mehrere Politikergenerationen bei uns in stümperhafter Weise versucht haben, für ihn gewissermaßen als Ventil an, um Luft abzulassen, weißt du?“
„Ja, ja, verstehe.“ Chan lächelte. Und als wenn sie das Gefühl hatte, dies erklären zu müssen, fügte sie bestätigend hinzu: „Wir haben viel Verständnis dafür, glaub´ mir. Auch mit unseren Politikern ist es oft alles andere als lustig. Aber schließlich und endlich seid ihr mit eurem Bildungssystem in Europa ja nun doch zu einem guten Ergebnis gekommen.“
„Das will ich nicht bestreiten“, stimmte Ellen zu. „Es hat halt nur alles viel zu lange gedauert. Das hätten wir – in Deutschland zumindest – schon 100 Jahre früher haben können.“
„Sagt ihr in Deutschland nicht auch ‚Gut Ding will Weile haben’?“
„Ja, schon. Das ist so ein Sprichwort und wird gern als Entschuldigung für Nichtstun benutzt.“
„Letztlich kommt es auf das Ergebnis an, und da muß ich sagen, daß euer Ausbildungssystem wirklich hervorragend ist“, sagte Chan bestimmt. „Unsere Kinder fühlen sich sehr wohl hier und lernen eine Menge – mit Freude! Und darüber sind wir sehr froh, denn in China hätten sie es wahrscheinlich etwas schwerer.“
„Ach, eure Kinder sind doch so intelligent! Warum sollten sie es in China schwerer haben?“ wollte Ellen wissen.
„Das liegt im System begründet. Dort herrscht im Grunde Drill und harter Konkurrenzkampf! Und das ist nicht unbedingt förderlich für empfindsame Naturen.“
„Ja, ich erinnere mich, daß du schon mal etwas darüber erzähltest“, antwortete Ellen.
„Bei der Gelegenheit fällt mir übrigens gerade ein, daß wir demnächst Herrn und Frau Li aus Beijing zu Besuch bei uns haben. Er ist Professor für Synthetische Biologie und wird hier auf unserem Kongreß in zwei Wochen einen Vortrag halten. Und er wird seine Frau mitbringen – eine Pädagogin, wie du.“ Dabei schaute sie Ellen an. „Es sind sehr nette Leute. Wir kennen sie schon seit geraumer Zeit. Wenn du Lust hast, lade ich euch zum Kaffeekränzchen ein. Dann könnt ihr euch ein bißchen über die Ausbildungssysteme austauschen. Was hältst du davon, Ellen?“
„Das ist eine sehr nette Idee. Wann wäre das denn?“
„Freitag oder Samstag in 14 Tagen wäre gut.“
„Ich glaube, das könnte passen. Ich schaue gleich mal nach“, antwortete Ellen. Und mit einem verschmitzten Blick zu den Herren sprach sie betont laut, so daß die Herren es in ihrer Ecke gar nicht überhören konnten: „Oder ginge vielleicht auch der Donnerstag? Da haben die Herren ja abends ihren Stammtisch, da könnten wir also ungeniert und ungestört lange plaudern.“
Und prompt kam die Antwort von Klaus, der dabei Qiang mit einem vielsagenden Blick zuzwinkerte: „Hört, hört! Kaum ist der Kater aus dem Haus, da tanzen auch schon die Mäuse auf dem Tisch!“
Allgemeines Gelächter.
Inzwischen war es spät geworden. Die Männer unterhielten sich immer noch im Wohnzimmer über allerlei geschäftliche Belange, und die Frauen saßen inzwischen im Wintergarten bei einer Tasse Tee und tauschten jede Menge Informationen über das ganze Themenspektrum des alltäglichen Lebens aus – wie Frauen das halt so zu tun pflegen. Sie kamen von Höcksken auf Stöcksken, wie man im Norddeutschen zu sagen pflegt.
„Jetzt ist das Jahr auch schon gleich wieder herum“, stöhnte Ellen. „Die Zeit rast nur so dahin! Ich habe den Eindruck, daß es von Jahr zu Jahr schneller geht. Empfindest du das auch so?“
„Ja, . . .“, bestätigte Chan nachdenklich, „die Tage fliegen wirklich nur so vorbei.“
„Ja, wirklich! Ich ertappe mich immer öfter bei dem Gedanken: Augenblick, verweile doch! Du bist so schön! – frei nach Goethes ‚Faust‘, weißt du? Ich möchte manchmal die Zeit anhalten. Aber sie rinnt erbarmungslos immerfort, die Augenblicke vergehen im Nu, und besonders die schönen Augenblicke!“
„Der Augenblick, das ist das, was wir landläufig als ‚Gegenwart‘ bezeichnen. Das ist nur ein kurzer, drei Sekunden langer Zeitabschnitt, in dem unser Gehirn alle Ereignisse bündelt, wie Hirnforscher herausgefunden haben.“
„Wie? Unsere Gegenwart ist nur ein Drei-Sekunden-Zeitraum?“
„Für unser Gehirn ist das so, ja. Das hängt mit seiner Kapazität und Organisation der Informationsverarbeitung zusammen. Stell dir nur mal vor, wie viele Informationen ständig über unsere unterschiedlichen Sinnesorgane in unser Gehirn einströmen. Es würde sehr schnell zu einer Reizüberflutung kommen, wenn das Gehirn jedes Informationsdetail in Echtzeit analysieren, bewerten und kontextuell zuordnen müßte. Damit wäre es total überfordert, denn dafür ist es nicht ausgelegt. Aber es weiß sich zu helfen: Es faßt alle Sinnesreize eines Zeit-Intervalls von 20 bis 40 Millisekunden zu einem Moment ohne Zeit zusammen, arbeitet also gewissermaßen getaktet. Die Hirnforscher haben herausgefunden, daß die Schwelle, ab der zwei Ereignisse als getrennt erkannt werden, vom jeweiligen Sinnesorgan abhängig ist. So müssen beim Menschen optische Eindrücke 20 bis 30 Millisekunden auseinanderliegen, um zeitlich getrennt zu werden, während für akustische Wahrnehmungen bereits drei Millisekunden ausreichen. Und die Schwelle, ab der die Reihenfolge zweier Reize unterschieden werden kann, ist unabhängig von der Art der Wahrnehmung etwa 30 bis 40 Millisekunden, richtet sich aber stets nach der langsamsten Reizübertragung. In dem erwähnten Drei-Sekunden-Zeitraum faßt unser Gehirn demnach rund 100 Einzel-Wahrnehmungen zur Gegenwartsdauer zusammen. Und deren Aneinanderreihung schafft den zeitlichen Fluß.“
„Das ist ja wirklich sehr interessant. Allerdings ist mein Verständnis von Gegenwart deutlich länger als drei Sekunden.“
„Natürlich! Das geht uns allen so. Für gewöhnlich fassen wir die Gegenwart als längeren Zeitraum unbestimmter Dauer auf, weil uns ja auch die einzelnen Arbeitsschritte des Gehirns gar nicht bewußt sind. Hier kommt wieder unser Zeitgefühl zum Tragen, daß individuell unterschiedlich und eben auch von unbestimmter Dauer ist, also nicht genau in Sekunden, Minuten oder Stunden angegeben werden kann.“
„Offenbar, ja! Aber nicht nur das. Mir scheint es – wie schon gesagt – sogar über die Lebenszeit gesehen stark veränderlich.“
„Kann ich nur noch mal bestätigen: Das geht uns wohl allen so. Aber die Ursachen dafür sind noch nicht abschließend erforscht. Bisher gibt es lediglich verschiedene Erklärungsversuche“, erklärte Chan.
„Ich habe mal so eine Theorie gehört, die besagte, daß man mit zunehmendem Alter die Dauer der verbleibenden Lebens-Restlaufzeit seiner inneren Uhr intuitiv umso stärker spürt, je kürzer diese wird. Und in der Tat haben alte Leute ja häufig eine ganz bestimmte Vorahnung des nahenden Todes. Wenn es sich also wirklich so verhielte, daß wir zumindest unterschwellig ein gewisses Gefühl für die uns verbleibende Lebenszeit hätten, dann wunderte es mich nicht, wenn wir das Empfinden haben, die Zeit würde immer schneller vergehen, je älter wir werden. Hast du auch schon mal so etwas gehört?“
„Ehrlich gesagt, nein, diese Theorie kenne ich nicht“, mußte Chan die Frage verneinen. „Aber ich könnte mir auch gut einen anderen Grund für die Ursache dieses Zeitgefühls denken.“
„So? Welchen?“
„Ja, schau mal, in der Jugend hat man noch nicht so viele Verpflichtungen und Termine und Aufgaben. Da kann man es sich leisten, so ein bißchen in den Tag hineinzuleben, verstehst du? So nach der Devise: ‚Kommst du heute nicht, kommst du morgen‘. So eine Redewendung gibt es doch im Deutschen, nicht?“
„Ja schon, aber es gibt auch eine andere: ‚Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen‘.“
„Das ist gut, daß du das Beispiel anführst“, entgegnete Chan. „Die beiden Aussagen stehen ja offenbar – oder nur scheinbar? – im Widerspruch zueinander. Aber ich denke eben, die jüngeren Jahrgänge handeln eher nach der von mir genannten Devise, während die älteren Generationen vornehmlich deinen Leitspruch beherzigen. Und das würde genau die Überlegung bestätigen, die ich gerade versuchte zu erläutern. Während also die Jüngeren vergleichsweise viel Zeit haben, und sie ihnen deshalb scheinbar langsamer vergeht, haben die Älteren oft sehr volle Terminkalender, so daß sie kaum wissen, was sie nun eigentlich als erstes tun sollen. Außerdem sind sie im Alter nicht mehr so fix in der Erledigung ihrer Aufgaben, brauchen also mehr Zeit dafür als jüngere. Deshalb sind sie fortwährend unter Zeitdruck, das heißt, die Zeit reicht gar nicht aus, alles zu erledigen, was sie sich vorgenommen haben. Für ihr Gefühl vergeht daher die Zeit zwangsläufig viel zu schnell. Aber es liegt nicht an der Zeit, sondern an ihnen selbst: Sie haben sich einfach zu viel vorgenommen!“
„Also Fehlplanung, meinst du?!“ konstatierte Ellen lakonisch. „Aber wie erklärst du es dann, daß fast alle Leute, die ich kenne, denselben Fehler machen?“
„Es muß nicht unbedingt ein Fehler sein, wenn jemand glaubt, er müßte so viele Dinge tun. Es liegt ja ganz allein in seiner eigenen Entscheidung. Je mehr man sich vornimmt, desto anstrengender wird es – das weiß jeder. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Der eine nimmt sich einfach weniger vor, erlebt dann vielleicht nicht ganz so viel, lebt dafür aber etwas beschaulicher, vielleicht auch intensiver. Der andere will unheimlich viel unternehmen, und dann hat er ständig das Gefühl, die Zeit reicht nicht aus, beziehungsweise sie vergeht zu schnell. Manche helfen sich dann noch ein bißchen mit konsequentem Zeitmanagement, um möglichst viel zeitlich unterzubringen, aber es bleibt eben doch ein gewisser Streß.“
„Hm . . . !“ Ellen seufzte vernehmlich. „Ja, kann schon sein. Klingt auch irgendwie plausibel. Und wie du schon sagst: Mit zunehmendem Alter ist man ja nicht mehr so leistungsfähig wie in jüngeren Jahren, dann braucht man für die gleichen Dinge wahrscheinlich sowieso immer ein bißchen länger, also bleibt beim gleichen Pensum weniger Zeit übrig, sie vergeht scheinbar noch schneller. . . . Allerdings, wenn ich’s recht bedenke, kann man doch eigentlich nicht wirklich so generell sagen, daß die Älteren vollere Terminkalender haben als die Jüngeren. Ist es nicht vielmehr so, daß die Rentner im allgemeinen weniger gefordert sind, also mehr Zeit haben? Und wenn das tatsächlich so wäre, dann spräche das doch eher für Langeweile als für Zeitdruck. Und das wiederum hieße, die Zeit verliefe für ihr Empfinden sehr langsam, oder?“
„Nun, ja! Es gibt immer solche und solche: Die einen sind ständig aktiv, die anderen nicht.“
„Aber alle haben doch das gleiche Gefühl, denke ich, daß nämlich mit zunehmendem Alter ihre Zeit immer schneller vergeht.“
„Vielleicht stimmt ja mit ihrem Gefühl etwas nicht“, sagte Chan lachend, „um es mal mit Loriot zu sagen. Aber Spaß beiseite. Fakt ist, daß diese Zusammenhänge noch nicht abschließend geklärt sind. Die Hirnforscher gehen davon aus, daß es im Gehirn jedenfalls keine speziellen Zellen oder gar ein Organ für die Zeitwahrnehmung gibt, die eine Messung des Zeitablaufs für die Einschätzung der Verlaufsdauer eines objektiven Vorgangs vornehmen, sondern daß das Maß der geistigen Tätigkeiten, die aus der Beschäftigung während des Vorgangs resultieren, unser Zeitgefühl bestimmt: Und zwar in der Weise, daß eine hohe geistige Tätigkeit uns die Vorstellung von einer längeren Zeitdauer vermittelt und umgekehrt.“
„Aber steht das nicht im Widerspruch zu dem, was du gerade vorher erklärt hast, daß nämlich die Zeit gerade schneller zu vergehen scheint, wenn man sehr vielbeschäftigt und also auch geistig sehr rege tätig ist?“
„Es hat auf den ersten Blick den Anschein, ja. Und ich bin mir selbst nicht ganz sicher, ob ich diese Auffassung so teilen kann. Auf jeden Fall denke ich, wir müssen hier differenzieren zwischen dem aktuellen Zeitempfinden während eines aktiv erlebten Vorgangs und der Erinnerung an Erlebnisse aus der Rückschau-Perspektive. Im ersten Fall bist du mit etwas beschäftigt, das du in einer bestimmten Zeit erledigen willst oder mußt. Dafür reicht dir oft die vorgesehene oder vorgegebene Zeit nicht – du hast das Gefühl, sie ist einfach zu schnell vergangen. Aus der Rückschau hingegen sieht die Sache anders aus: Wenn du auf sehr viele Erlebnisse, Unternehmungen, geistige Tätigkeiten zurückschauen kannst, dann hast du das Gefühl, du hättest damals sehr viel mehr Zeit gehabt.“
„Das leuchtet mir ein.“
„Nun kommt noch ein anderer Effekt hinzu, der bereits durch viele Versuche mit Tieren und Menschen faktisch belegt ist: Die Beschäftigung mit für uns neuen Eindrücken und Dingen erfordert nachweislich mehr geistige Tätigkeit als mit solchen, die uns schon bekannt sind. Und mehr geistige Tätigkeit bedeutet nach Ansicht der Hirnforscher, wie erwähnt, die Vorstellung, daß der Vorgang längere Zeit andauert – und im Umkehrschluß, daß bekannte Vorgänge weniger Zeit beanspruchen. Damit begründen sie die Vorstellung, daß für ältere Menschen, die aufgrund ihrer längeren Lebenserfahrung im Vergleich zu jüngeren ja viel weniger mit neuen Eindrücken konfrontiert werden, die Vorgänge schneller verlaufen – eben weil ihnen die meisten schon bekannt sind.“
„Aha, ja. . . . Das wäre wohl auch eine Erklärung dafür, daß wir bei Reisen zum Beispiel das Gefühl haben, die Rückfahrt habe kürzer gedauert als die Hinfahrt, weil uns auf dem Rückweg alles schon bekannt erscheint und weniger Aufmerksamkeit mit Denkprozessen erfordert?!“
„Das wäre eine Erklärung, ja. Jedenfalls erscheint das sehr plausibel. Aber ich hadere immer noch mit der Vorstellung, daß eine hohe geistige Tätigkeit das Gefühl einer längeren Zeitdauer vermitteln soll. Das Gegenteil scheint mir der Fall. Denk doch nur mal an eine Prüfungssituation: Da hat doch jeder schon das Gefühl kennengelernt, daß die Zeit für die Aufgabenlösung einfach nicht ausreichte – die Zeit verging ihm zu schnell. Nur wenn er die Lösung sehr schnell gefunden hat, also wenig geistige Anstrengung dafür aufwenden mußte, dann bleibt ihm noch viel restliche Prüfungszeit übrig, die ihm wahrscheinlich sehr lang vorkommt, weil er in der Zeit nichts mehr zu tun hat.“
„Das klingt auch wieder sehr plausibel.“
„Oder ein anderes Beispiel: Wenn du im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzt und darauf wartest, hereingerufen zu werden, dann kommt dir die Zeit elend lang vor. Hast du aber eine spannende Lektüre dabei, dann merkst du gar nicht, wie lange du schon warten mußtest, bis du ‚plötzlich‘ aufgerufen wirst.“
„Ja, genau! Das habe ich auch schon selber mehrfach festgestellt.“
Chan schaute sie schmunzelnd an und stellte dann resümierend fest: „Ist schon ein interessantes Phänomen, unser Zeitgefühl, nicht?“
„Ja, ja, das ist es“, pflichtete Ellen ihr bei und fügte dann lachend hinzu: „aber wir werden es heute abend sowieso nicht mehr klären können.“
Beide lachten.
„Auf jeden Fall ist dieses Jahr nun auch schon bald wieder vorbei“, stellte Ellen nochmal fest. „Und wann ist das bei euch in China?“
„Unser Neujahr beginnt auch am ersten Januar, seit wir 1912 vom Mond- auf den Gregorianischen Kalender umgestellt haben. Aber die traditionellen Feste nach dem Mondkalender werden trotzdem weitergepflegt. Und danach feiern wir das Frühlingsfest, das ist am ersten Tag des ersten Mondes und fällt in der Regel in den Februar. Da haben alle Chinesen eine Woche Urlaub.“
„Fahrt ihr dann wieder hin?“
„Ja, wie jedes Jahr. Wir treffen immer unsere ganze Familie.“
„Schön“, sagte Ellen gedehnt und mit einem Ausdruck bewundernder Anteilnahme.
„Ja, wir freuen uns auch schon darauf“, entgegnete Chan, „obwohl Qiang diesmal wegen der Ausschreibung für die Mars-Mission ziemlich unruhig ist. Er hat immer etwas Sorge, er könnte was verpassen, wenn er da am anderen Ende der Welt ist, oder es könnte irgendwas schieflaufen in seiner Firma. Dabei ist er in ständigem Kontakt mit seinen Kollegen und mit Robby, hat überall, wo er auch ist, direkten Zugang zu allen wichtigen Informationen und so weiter – also ich weiß wirklich nicht, warum er sich Sorgen machen müßte. Aber so ist er nun mal, er will alles immer unter unmittelbarer Kontrolle haben.“
„Ach, wenn man vom Teufel spricht!“ rief Ellen, als sie Qiang auf sich zukommen sah.
Es war etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht, als Qiang begann, seine Familie zusammenzutrommeln, um sich mit ihnen auf den Heimweg zu machen. Bei der Verabschiedung fiel Jiao aber wieder ein, daß man sich ja noch für die Globalisierungsdiskussion verabreden wollte.
„Ja gut, daß du daran erinnerst, Jiao“, sagte Ellen, „beinahe hätten wir es nun doch noch vergessen. Also dann schauen wir mal in den ‚Dispo‘, wann wir einen geeigneten Termin finden.“
Man sagte einfach „Dispo“, wenn man das Dispositionsprogramm für die individuelle Terminplanung meinte, das jeder auf seinem ständigen Begleiter, dem sogenannten Personal Allround Computer and Communications System oder kurz PACCS, verfügbar hatte.
So ein PACCS war praktisch ein Universalgerät, das sehr viele Funktionen in sich vereinte, nicht nur so triviale Dinge wie Uhrzeit, Kalender, Terminplaner, Rechner, Datenbank, Notizbuch, Enzyklopädie, Sprachdolmetscher, Mobilfunk-Telefon, Radio/TV, Photoapparat, Navigationssystem und ähnliches. Er war auch gleichzeitig der persönliche Identitätsnachweis, ersetzte also den in früheren Zeiten üblichen Personalausweis und Reisepaß, er war Versicherungsausweis, Kfz-Führerschein, Mitgliedsausweis jedweder Vereinigung, und er war zudem das Mittel für den bargeldlosen Zahlungsverkehr – und es gab nur noch solchen, da man das Bargeld mit der Einführung des PACCS in Europa völlig abgeschafft hatte. Damit war der PACCS praktisch das wichtigste Utensil überhaupt, das jede Person besaß und auch ständig bei sich trug. Entsprechend sorgsam mußte man damit umgehen; vor allem galt es, den Zugangscode gut zu hüten. Dieser mußte über mehrfaches Berühren einer Sensortaste, durch die der Fingerabdruck aufgenommen wurde, in einer vom Besitzer selbst vorprogrammierten Weise, die Reihenfolge unterschiedlicher Finger sowie den Eingabe-Rhythmus betreffend, eingegeben werden. Dies war die einzige Taste an dem Gerät. Alle anderen Eingaben wurden per Sprachbefehl über ein integriertes Mikrophon getätigt, während alle Ausgaben auf einem integrierten Display dargestellt oder direkt in einem kleinen Ohrhörer verbal ausgegeben wurden. Daneben verfügte jeder PACCS über eine Funkschnittstelle zum Informationsaustausch mit anderen Computern, direkt oder über das WorldNet, zum Übertragen von Telefongesprächen oder eben zum Geldtransfer. Alle Spracheingaben wurden kontinuierlich durch einen integrierten Stimmen-Analysator auf Identität mit dem gespeicherten Sprachmuster des Besitzers geprüft. Das war als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gegen Mißbrauch eingebaut; so reagierte PACCS grundsätzlich nur auf die Stimme „seines Herrn“. Alle wichtigen Eingabebefehle, wie zum Beispiel Geldbeträge und Empfänger im Zahlungsverkehr, wurden grundsätzlich vor Ausführung auf dem Display dargestellt und mußten durch ein „ja“ oder „okay“, oder was sonst der jeweilige Besitzer vorprogrammiert hatte, nochmals bestätigt werden, um Fehlanweisungen möglichst weitgehend auszuschließen. Die meisten Leute trugen ihren PACCS am Handgelenk wie früher die Armbanduhren. Gehäuse und Display waren in diesem Fall leicht gewölbt, um sich der Form des Unterarms anzupassen. Es gab aber auch eine ganze Reihe von Frauen, die – wie auch Ellen Eppelmann – das Gerät, als Schmuckstück gestaltet, an einer Halskette trugen. Für die Sprachausgabe, zum Beispiel bei Telefongesprächen, gab es einen speziellen Ohr-Clip mit Kleinstlautsprecher, der die Sprachsignale über die Funkschnittstelle des PACCS empfing.
Ganz „Fortschrittliche“ – Menschen, die sich jedenfalls als solche empfanden – verfügten bereits über ein Hirnimplantat, das heißt, einen am Kopf unter die Haut implantierten elektronischen Chip mit künstlicher Intelligenz und neuronaler Vernetzung über eine entsprechende Gehirn-Computer-Schnittstelle aus Hunderten haarfeiner Mikroelektroden, was sie zum direkten Gedankenaustausch mit dem Computerchip und darüber hinaus auch zu anderen Computern befähigte. Auf diese Weise kombinieren diese Menschen ihre Intelligenz, ihre Kenntnisse und kreativen Fähigkeiten mit der künstlichen Intelligenz, der Speicherkapazität, der Schnelligkeit und Präzision des Computerchips, was ihnen auf eine völlig neue Art zu denken, zu kommunizieren und zu erschaffen erlaubt. Solche Menschen, bei denen sich ihr Organismus mit technischen Implantaten zu einer hybriden Lebensform verbindet, bezeichnet man als „Cyborgs“ – ein Akronym von cybernetic organism. Allerdings scheuten noch immer die meisten Menschen davor zurück, weil damit ja doch ein nicht ungefährlicher Eingriff in das Gehirn verbunden war.
Die PACCS und die Computer-Implantate, diese kleinen, aber äußerst leistungsfähigen Universal-Computer, verfügten über eine enorm große Speicherkapazität, denn mit der hier eingesetzten Technologie wurde nicht nur die elektrische Ladung, sondern auch die Eigenrotation von Elektronen, der sogenannte Spin, zur Datenspeicherung genutzt. Das verwendete Material, das über eine sehr hohe Spin-Polarisation verfügte, ermöglichte eine extreme Miniaturisierung der Scheichermedien. Daneben aber hatte diese Technologie den weiteren Vorteil gegenüber herkömmlichen Siliziumchips, daß die Informationen fest gespeichert wurden, so daß sie bei einem Ausfall des Akkus nicht verlorengehen konnten.
Die Chips waren äußerst dünn – dünn wie eine Folie. Die PACCS konnten von den Trägern im ungenutzten Zustand zu einer kleinen Rolle zusammengerollt werden.
Jeder fingerte an der Sensortaste seines PACCS, um diesen betriebsbereit zu schalten, hielt ihn dann an den Mund und sagte leise: „Kalender“, woraufhin auf dem Display der jeweilige persönliche Terminkalender abgebildet wurde. Da man sich schon darauf verständigt hatte, daß es ein Samstag sein sollte, an dem man sich zusammensetzen wollte, sagte jeder in sein Gerät: „Samstag“, worauf der nächste Samstag mit allen eingetragenen Terminen angezeigt wurde. Jiao hörte, wie Herr Eppelmann mehrfach sagte: „weiter“, „weiter“, „weiter“, „weiter“.
„Das sieht bei mir nicht so gut aus“, sagte er schließlich in die Runde. „Die nächsten vier Samstage sind bereits weitgehend verplant, ich könnte also frühestens Samstag in fünf Wochen einplanen. Wie sieht es bei euch aus?“
„Ja, da könnte ich auch“, sagte Frau Eppelmann.
„Ich auch!“, rief Jiao.
Und auch die anderen Kinder hatten da noch nichts vor, so daß man sich auf Samstag in fünf Wochen zum Nachmittagstee verständigte und jeder den Termin in seinen PACCS einbuchte.
„Na, da habt ihr aber Glück, daß ihr noch kurz vor Weihnachten einen gemeinsamen Termin gefunden habt“, sagte Chan.
„Ja, stimmt“, ergänzte Jiao, „dann kommen die Feiertage und danach fliegen wir ja schon bald nach Nanjing – dann sind wir erst mal vier Wochen weg.“
„Da würde ich zu gerne mal mitkommen“, sagte Alexander etwas wehmütig. „Ich habe schon so viel über China gelesen, daß ich es kaum abwarten kann, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Das stelle ich mir wahnsinnig interessant vor.“
„Die Gelegenheit wirst du sicher noch bekommen“, versuchte Ellen ihren Sohn zu trösten. Dann verabschiedete man sich.
„Denkt an unsere Party nächsten Freitag!“ rief Jiao noch zurück zu den Eppelmann-Jungs.
„Ach, und wir haben übrigens übernächste Woche wieder Stammtisch, Qiang, denk dran!“
„Ja sicher, Klaus, ich freue mich schon drauf!“