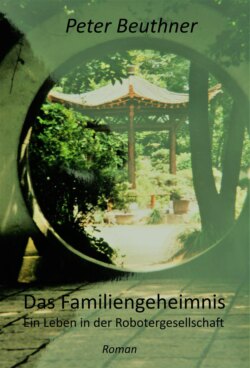Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geschäfte, Geschäfte
ОглавлениеAm nächsten Morgen hatte es Qiang wieder eilig, in die Firma zu kommen. Für acht Uhr hatte er eine Vorstandssitzung anberaumt. Pünktlich standen seine Kollegen in seinem Zimmer. Nach kurzer Begrüßung ging man ohne weitere Umschweife in medias res: „Wie weit ist der Vertragsentwurf?“ fragte Qiang.
„Es geht voran“, antwortete Sandrine Marchal. „Die meisten Punkte sind eigentlich geklärt. Woran es jetzt hauptsächlich noch hapert, das ist die Frage des Unternehmenswertes. Den schätzt Güssen natürlich viel höher ein als wir, unsere due dilligence will er nicht akzeptieren.“
„Wir müssen die Sache jetzt möglichst schnell unter Dach und Fach bringen“, sagte Qiang fest entschlossen. „Notfalls kommen wir ihm halt noch etwas entgegen. Es ist schließlich sein Lebenswerk, das er nun ‚begraben‘ muß. Das fällt ihm natürlich schwer. Es sind ja vor allem emotionale Werte für ihn, denn er hängt immer noch mit seinem Herzblut daran. Und konsequenterweise bewertet man in solcher Gefühlslage auch den materiellen Wert viel höher. Sein Blick ist da schlicht verklärt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch vermeiden, daß er vor seiner Familie und seinen Freunden sein Gesicht verliert. Er würde sich wesentlich leichter tun, wenn er sagen könnte, er habe sein Geschäft altershalber aufgegeben und noch einen guten Preis dafür erhalten. Okay, ich werde gleich noch ein Gespräch mit ihm vereinbaren und sehen, wo wir uns einigen können. Auf jeden Fall müssen wir jetzt sehr schnell zu einer Einigung kommen, denn ich habe gehört, daß die Ausschreibung für die nächste Mars-Mission bald herauskommt, und da müssen wir unbedingt anbieten. Ich bin sehr zuversichtlich, daß wir gewinnen werden, denn mit unserer neuen Roboter-Generation werden wir unschlagbar sein. Aber noch haben wir den Auftrag nicht, selbst eine Kalkulation können wir noch nicht machen, solange das Konzept nicht entwickelt ist. Und dazu brauchen wir endlich die Gespräche mit den Anthropo-Leuten. Die können wir allerdings erst führen, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Alles hängt jetzt vom Vertragsabschluß ab. Also, wir haben keine Zeit mehr zu verschenken. Wir brauchen den Vertrag, das hat absoluten Vorrang vor allem anderen!“
Sie sprachen noch einmal alle Punkte ihrer Aktionsliste der Reihe nach durch, setzten Prioritäten und Termine zum Teil neu und bestätigten die anderen, suchten nach Möglichkeiten für vorgezogene Aktionen, diskutierten Alternativen. Im Anschluß an die Besprechung ging jeder an seine Arbeit. Qiang ließ sich durch Robby mit Herrn Güssen verbinden und verabredete einen neuen Termin, um die Sache endgültig unter Dach und Fach zu bringen.
Nach dem Stand der Dinge dürfte diese hoffentlich abschließende Besprechung mit Güssen eigentlich nicht sehr lange dauern, dachte sich Qiang. Somit ergäbe sich eine gute Gelegenheit, seine Frau mitzunehmen, um sich mit ihr anschließend noch einen schönen Tag in Leipzig zu machen.
Er machte es sich in seinem Büro bequem und ging noch einmal gedanklich seine Verhandlungsstrategie, seine Argumente und vor allem seine Grenze für Zugeständnisse durch. Er spielte die ganze Situation durch, wie sie nach seiner Einschätzung höchstwahrscheinlich ablaufen würde, denn er kannte Güssen inzwischen gut genug, um richtig antizipieren zu können. Und nicht umsonst hatte er Sun Tzu Ping Fa – Die Kunst des Krieges – gelesen, das heißt, die Kriegsmethode des erfolgreichen Feldherrn Sun Tzu, der vor etwa 2500 Jahren gelebt und seine Gedanken über die zum Kriegserfolg führenden Strategien in einer Abhandlung beschrieben hatte – oder besser: haben soll, denn so sicher ist man sich heute nicht mehr, ob die Texte tatsächlich von ihm stammen. Wie auch immer – diese Schrift gehört mit ihren zeitlosen Wahrheiten auch heute immer noch zur Pflichtlektüre eines jeden Militärtaktikers. In Analogie zur Kunst der Kriegführung gelten die in der Abhandlung beschriebenen Erkenntnisse aber auch für Geschäftsleute. Danach ist zum Beispiel die bestmögliche Kenntnis des Gegners und seiner Absichten eine ganz wesentliche Voraussetzung für den eigenen Erfolg – heute eigentlich eine Binsenweisheit, dennoch wird sie nicht immer berücksichtigt. So können auch Manager im Wirtschaftsleben von den Anregungen noch profitieren.
Nachdem Qiang sein Gedankenspiel beendet hatte, machte er sich auf den Heimweg. Er wollte heute gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls schon so frühzeitig zu Hause war, zu Mittag essen und danach noch einige Arbeiten am häuslichen Schreibtisch erledigen.
Während Robby noch in der Küche werkelte, sahen die Wangs ihre Geschäftspost am Computer durch. Es dauerte jedoch nicht lange, da stand Qiang auf und ging zu seiner Frau rüber. „Was hältst du davon, Liebling, wenn wir uns demnächst mal einen schönen Tag in Leipzig machen?“
Sie blickte ob des überraschenden Angebotes etwas erstaunt auf, lächelte ihn dann aber freundlich an und sagte: „Das ist eine sehr schöne Idee, mein Schatz. An welchen Tag hast du dabei gedacht?“
„Mittwoch oder Donnerstag übernächster Woche. Was würde dir passen?“
„Hm, laß mal sehen.“ Sie bemühte ihren Dispo und meinte dann: „Ich schaue erst mal nach dem Donnerstag, dann brauchten wir unseren Familienabend nicht ausfallen zu lassen. . . . Ah, da haben wir es. Donnerstag, ja, das ließe sich einrichten. Ich habe da zwar schon zwei Termine, aber die könnte ich auch verschieben. Das dürfte kein Problem sein.“
Chan war beruflich sehr stark engagiert. Ihr Arbeitsgebiet war die Neuroinformatik, ein interdisziplinäres wissenschaftliches Forschungsgebiet an der Schnittstelle zwischen Informatik, also der Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen mit Hilfe von Digitalrechnern, und den Neurowissenschaften mit ihren verschiedenen biologischen, physikalischen und medizinischen Wissenschaftsbereichen zur Untersuchung des Aufbaus und der Funktionsweise von Nervensystemen. Das Aufgabengebiet beschäftigt sich also mit der Informationsverarbeitung in biologischen neuronalen Systemen und deren mögliche Funktionsübertragung auf technische Systeme. Oder anders ausgedrückt: Es geht zunächst um das Verständnis der Organisations- und Funktionsprinzipien der perzeptuellen und kognitiven Prozesse, also der im Gehirn ablaufenden Wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und Lernprozesse, und schließlich deren Modellierung sowie Implementierung auf Computern in Form künstlicher neuronaler Netze – eine sehr ambitionierte Aufgabe, denn das Gehirn ist das komplexeste aller uns bekannten Systeme.
Es handelt sich dabei um ein komplexes Netzwerk, das aus rund 100 Milliarden Neuronen besteht, die untereinander über Synapsen verschaltet sind und miteinander wechselwirken können, wobei jedes Neuron zwischen 1.000 und 10.000 Verbindungen zu anderen Zellen unterhält. Zusätzlich gibt es im Hirn noch etwa 500 bis 1.000 Milliarden Gliazellen, welche die Nervenzellen und ihre Umgebung im Gehirn stützen, nähren und erhalten. Dank komplexer dynamischer Kommunikationsprozesse über die vielfach rückgekoppelten Netzwerke ist das Nervensystem in der Lage, außerordentlich große Informationsmengen zu verarbeiten. Die neuronale Informationsverarbeitung vollzieht sich im Bereich von Millisekunden und ist damit langsam im Vergleich zur elektronischen Datenverarbeitung moderner Computer. Aber die hohe Vernetzungsdichte der Neuronen ermöglicht eine massive Parallelverarbeitungskapazität und damit die „Echtzeitfähigkeit“ des Gesamtsystems. Im Gehirn arbeiten an jedem „Rechenschritt“ – anders als im Computer – Tausende von Neuronen gleichzeitig. Ein dichtes Netz von Verbindungen ermöglicht die Koordinierung ihrer Aktivität.
Das Gehirn, der Sitz mentaler Funktionen wie beispielsweise der Wahrnehmung, des Bewußtseins, der Denkfähigkeit, des Gedächtnisses, der Emotionen und des zielgerichteten Verhaltens, ist ein selbstorganisierendes, offenes, dynamisches System ohne zentrale Kontrolle. Es ist der Prototyp eines adaptiven Systems in seiner höchst entwickelten Form. Seine Anatomie und funktionelle Architektur sowohl auf der Ebene einzelner Neuronen als auch größerer Zellverbände, die Funktionseinheiten bilden, aber auch des Nervensystems als Ganzes sind zwar seit langem hinlänglich untersucht und weitgehend bekannt, aber die neuronale Verankerung der höheren kognitiven Prozesse erschloß sich nur sehr langsam in kleinen Schritten und ist bisher immer noch nicht vollständig ergründet. Auch die Tatsache, daß die fortgesetzten Interaktionen und wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Hirn und Umwelt hochkomplexe Rückkopplungseffekte bewirken und zudem die Effektivität der synaptischen Kontakte – und damit die Systemeigenschaften – dauernd verändern, erschwerte die Forschungsarbeit lange Zeit. Daher war es nicht verwunderlich, daß die kognitiven Leistungen des menschlichen Gehirns, insbesondere die Fähigkeit zum Lernen, zur Mustererkennung und -verarbeitung, zur zielgerichteten Steuerung der Bewegungen und zur immer neuen Anpassung an die komplexe, veränderliche Umwelt, selbst mit den leistungsstärksten Supercomputern bis dato allenfalls partiell und näherungsweise erreicht wurden. Aber nicht nur die kognitiven Leistungen des Gehirns, sondern auch seine „Fehlleistungen“, beispielsweise die Ursachen von Nervenkrankheiten wie etwa Parkinson, Alzheimer oder Demenz, und deren Heilungsmöglichkeiten waren immer noch nicht hinreichend gut verstanden und daher nach wie vor Gegenstand medizinischer Grundlagenforschung. Die größten Schwierigkeiten aber bereitete die – nach wie vor nicht abgeschlossene – Erarbeitung einer wissenschaftlich fundierten, empirisch nachprüfbaren „Theorie des Gehirns“ zum Verständnis von Begriffen wie Bewußtsein, Gedächtnis, Seele, Geist, Emotionen sowie über den Zusammenhang von Geist und Gehirn, von Bewußtsein und Nervensystem.
Mit zunehmendem wissenschaftlichen Interesse an Aufbau und Funktion des menschlichen Gehirns schon im 20. Jahrhundert und gefördert durch immer bessere technische Untersuchungsmöglichkeiten, beispielsweise mit der Elektro- und der Magnetoenzephalographie, der Computertomographie, der Multiphotonenmikroskopie sowie mit Bildgebenden Verfahren wie der Positronen-Emissions-Tomographie, der Single Photon Emission Computed Tomography und der Funktionellen Magnetresonanztomographie, haben sich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr wissenschaftliche Forschungsdisziplinen herausgebildet, die unter dem Sammelbegriff ‚Neurowissenschaften‘ zusammengefaßt werden. Dazu gehören unter anderen die Kognitive Neurowissenschaft, Biopsychologie, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Neurobiologie, Kognitionspsychologie, Computational Neuroscience, Künstliche Intelligenz (KI) und eben auch die Neuroinformatik, das Arbeitsgebiet von Chan. Zwischen den einzelnen Teildisziplinen gibt es mehr oder weniger große Überlappungen, weil sich die Teilaspekte des komplexen Systems „Gehirn“ nicht ohne weiteres eindeutig gegeneinander abgrenzen lassen. Man hatte zwar längst herausgefunden, daß unterschiedliche Informationsformen unabhängig voneinander in verschiedenen Gehirnarealen verarbeitet werden, deren Lokalisation man beispielsweise mit den Bildgebenden Verfahren oder bei der Untersuchung von Patienten mit Hirnläsionen vornehmen konnte. So hatte man zum Beispiel an Patienten mit Gedächtnisstörungen beim Ausfall bestimmter Gehirnregionen die verschiedenen Formen des Gedächtnisses den entsprechenden Verarbeitungszentren zuordnen können. Aber diese Zuordnungen hatte man zunächst nur anhand der Aktivierungsmuster im Sinne erhöhten Energieverbrauchs der „arbeitenden“ Areale treffen können. Wie sich die Informationsverarbeitung darin im einzelnen abspielte und wie deren Zusammenspiel in der Koordination aller involvierten Bereiche funktionierte, das wußte man damit noch lange nicht. Denn fast immer sind mehrere Funktionsbereiche des Gehirns bei der Informationsverarbeitung involviert: So werden etwa die von den Sinnesorganen aufgenommenen Informationen bei der Weiterverarbeitung im Gehirn in kleinere Einheiten zerlegt, an unterschiedlichen Stellen getrennt verarbeitet, das heißt verstärkt, abgeschwächt oder bewertet, und dann in verschiedenen Gehirnarealen wieder zusammengeführt. Daher arbeiten die Forscher der einzelnen Spezialdisziplinen zumeist in interdisziplinären Teams zusammen.
An der Universität Ulm, die mit ihrer interdisziplinären und kooperativen Arbeitsweise zahlreiche Forschungsschwerpunkte und Sonderforschungsbereiche sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung etablieren und erfolgreiche Ergebnisse erzielen konnte, war schon gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein Institut für Neuroinformatik etabliert und in den Folgejahren um weitere Institute im Kontext der Neuro- und Kognitionswissenschaften ergänzt worden. Hier war nun Chan als Dozentin für Neuroinformatik tätig, seit sie in Deutschland lebte. Neben ihrer Lehrtätigkeit lag der Schwerpunkt ihrer Beschäftigung vor allem in der Forschungsarbeit. Neuronale Methoden werden vor allem bei der Gewinnung von Informationen aus schlechten oder verrauschten Daten eingesetzt, aber auch bei der Generierung von Algorithmen, die sich neuen Situationen anpassen, also lernen. Daher lag es nahe, daß ihre Aufgabe in der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Kognitive Neuroinformatik“ schwerpunktmäßig darin bestand, höhere kognitive Fähigkeiten, wie das automatische Lernen von neuem, die Verarbeitung und Repräsentation von unsicherem Wissen sowie das Ziehen von Schlußfolgerung zu untersuchen. Zusammen mit ihren Kollegen von der KI-Forschung arbeitete sie an der Weiterentwicklung von Maschinen, die sich im Ergebnis „intelligent“ verhalten. Insofern ergänzte sich ihre berufliche Tätigkeit ganz ausgezeichnet mit den Roboterentwicklungen ihres Mannes.
Der Tagesablauf bei der Arbeit von Chan gestaltete sich ganz unterschiedlich, je nachdem ob sie eine Vorlesung halten, praktische Experimente ihrer Studenten im Labor beaufsichtigen, Prüfungen abnehmen, an Seminaren oder Symposien teilnehmen, Verwaltungsaufgaben wahrnehmen mußte oder ob sie sich ganz ihrer Forschungstätigkeit widmen konnte. Letzteres machte sie besonders gerne, und darin sah sie auch ihre Hauptaufgabe. Vorlesungen betrachtete sie eher als Pflichtübung und Verwaltungsaufgaben sogar als lästig. Die Arbeit im interdisziplinären Forschungsteam, der Erfahrungsaustausch mit Kollegen, aber auch das gemeinsame Experimentieren mit ihren Studenten im Labor, das waren ihre bevorzugten Tätigkeiten. Sie entsprachen ihrer kooperativen und wißbegierigen Art. Lernen von den anderen und eigenes Wissen an andere weitergeben, das war ihre Devise.
Aber natürlich nahm sie auch ihre anderen, weniger geliebten Aufgaben gewissenhaft wahr. Ihre Vorlesungen waren immer bestens in Form von Computer-Präsentationen und Versuchsdemonstrationen aufbereitet. Wie inzwischen allgemein üblich, wurde jede Vorlesung im Hörsaal auf einem Großdisplay präsentiert, während der oder die Lehrende am Podium steht und jederzeit die Präsentation unterbrechen kann, um auf Fragen von Studenten unmittelbar erklärend eingehen und gegebenenfalls auch Diskussionen zur Thematik führen zu können. Es war also kein Frontalunterricht im herkömmlichen Sinne, keine „Vor-Lesung“ im wörtlichen Sinne, sondern eigentlich eher ein meist lebhaftes Wechselgespräch zwischen Lehrenden und Lernenden anhand der anschaulich präsentierten Vorlagen. Während in früheren Zeiten die Studenten häufig durch öde Monologe die Konzentration verloren und überdies vornehmlich damit beschäftigt waren, das teilweise unleserliche Tafelgekritzel der Professoren abzuschreiben, um sich später zu Hause nochmal mit dem Stoff auseinandersetzen zu können, konnten sie sich jetzt voll auf die Inhalte konzentrieren und entstehende Fragen sofort an Ort und Stelle klären. Wenn sie jetzt aus der Vorlesung gingen, dann hatten sie den Stoff verstanden und mußten zu Hause nicht noch nacharbeiten.
Alle Präsentationen wurden ins „Netz“ – ins WorldNet – gestellt, und jeder eingeschriebene Student konnte, wenn er wollte, sie auch später jederzeit nochmal aufrufen und am Computer darstellen. Er mußte dazu lediglich den Berechtigungscode mit seiner Matrikelnummer eingeben, denn diese Präsentationen waren nicht allgemein öffentlich zugänglich. Der Ersteller dieser Dokumentationen hatte schließlich ein Eigentumsrecht daran und verdiente ja damit sein Geld.
Apropos Geld: Auch die Professoren und Dozenten waren sporadischen Kontrollen hinsichtlich ihrer Leistungen unterworfen. Sie hatten lediglich befristete Verträge und mußten sich immer wieder von neuem bewähren. Zu diesem Zweck wurden alle ihre Vorlesungen für ein Jahr aufgezeichnet – als Grundlage für eine Leistungsbeurteilung durch eine Prüfungskommission. Insofern lag es im ureigenen Interesse eines jeden Dozierenden, seine Themen inhaltlich und didaktisch gut aufzubereiten und vorzutragen. Und auch die Höhe ihres Gehaltes wurde in Abhängigkeit von ihrem Engagement, das heißt Güte und Einsatz, in Forschung und Lehre immer wieder neu festgelegt. Denn auch für sie galt – wie für alle anderen in der Gesellschaft – das Leistungsprinzip. Sie sollten sich nicht auf ihrem einmal erworbenen Status ausruhen können. Die Studenten haben einen Anspruch auf eine gute Ausbildung in angemessener Zeit. Und es lag eben auch im allgemeinen gesellschaftlichen Interesse.
Chan war sich dessen bewußt. Und da sie die Absicht hatte, ihren Job auch weiterhin auszuführen, bemühte sie sich stets, in allen ihr übertragenen Aufgaben möglichst gut zu sein. Also auch in denen, die sie eher als Pflichtübung empfand. Daher, aber nicht nur deshalb, sondern auch aus Eigeninteresse an ihrer Arbeit, war sie üblicherweise jeden Tag von etwa acht bis 16 Uhr an der Uni, um sich ihren Aufgaben mit genügend Zeit möglichst gründlich und ungestört widmen zu können.
Aber natürlich hatte sie auch immer noch genügend Freiraum, ihre Termine weitgehend selbst zu planen und nötigenfalls umzudisponieren. Und davon wollte sie nun gerne Gebrauch machen, denn die Reise nach Leipzig zusammen mit ihrem Mann versprach ihr eine interessante und zugleich erholsame Ablenkung von der Arbeit. Die beiden festen Termine in ihrem Dispo ließen sich ohne Schwierigkeiten verschieben. Und die restliche Zeit hatte sie für ihre Forschungstätigkeit ohne Verpflichtung anderen gegenüber eingeplant, lagen also in ihrem alleinigen Verfügungsrecht und waren daher problemlos zu vertagen. So stimmte sie dem überraschenden Reiseangebot ihres Mannes freudig zu.
„Gut, dann beschließen wir das jetzt“, freute sich Qiang. „Ich muß am Morgen noch ein abschließendes Gespräch mit Güssen führen, du weißt schon. Das wird aber bestimmt nicht lange dauern. In der Zeit kannst du dir ja schon mal ein paar Geschäfte in der Innenstadt ansehen. Und sobald ich fertig bin, melde ich mich. Dann unternehmen wir noch gemeinsam etwas. Ich habe da auch schon eine Idee.“
„Und die wäre?“ wollte Chan wissen.
„Wird nicht verraten!“ tat Qiang ein bißchen geheimnisvoll und küßte sie zärtlich auf den Mund.
„Willst du mich vielleicht verführen, du böser, böser Bube du?“ säuselte Chan, während sie sich an ihn schmiegte.
Robby hatte schon zum zweiten Mal gemeldet, daß das Essen bereits serviert sei, aber Qiang und Chan waren in diesem Augenblick zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als daß sie jetzt an Essen denken konnten. Sie umarmten sich zärtlich, liebkosten sich und sahen sich tief in die Augen. Sie rieben ihre Körper aneinander und ihre Atmung wurde schwerer – verhaltenes Stöhnen. Als Qiang begann, an ihrem Rockverschluß herumzufummeln, keuchte Chan leise und ein wenig verlegen: „Robby schaut zu.“ Qiang drehte sich um und sah Robby, sie aufmerksam beobachtend, an den Türrahmen gelehnt stehen. Er ergriff Chans Hand und zog sie wortlos hinter sich her, geradewegs ins Schlafzimmer. An Robby vorübergehend sagte er: „Robby, halt das Essen warm!“
Robby lächelte freundlich, scheinbar verständnisvoll, und zwinkerte mit einem Auge, während er seine übliche kurze Verbeugung machte. Wirklich verstanden hatte er allerdings nicht, was sich da abspielte, obwohl er diesem Schauspiel schon des öfteren hatte beiwohnen können. Er registrierte die intime Körpernähe und die streichelnden Handbewegungen, die veränderte Stimmlage und die glänzenden Augen. Aber deuten konnte er dies nicht. Anfangs, als er es die ersten Male erlebte, hatte er sich auch ein paarmal von Qiang und Chan streicheln lassen, um vielleicht nachempfinden zu können, was da passierte. Er hatte jedoch nicht die geringsten Empfindungen dabei wahrgenommen, und so blieb es für ihn im Grunde unverständlich, was die Menschen da taten. Es mußte wohl eine allzu menschliche Regung sein – das war sein Verständnis dieser Situation. Und so hatte er sich angewöhnt, jedesmal ein scheinbar verständiges Lächeln aufzusetzen und scheinbar verschmitzt mit dem Auge zu zwinkern – jedenfalls konnten sich Qiang und Chan dieses Eindrucks nicht erwehren.