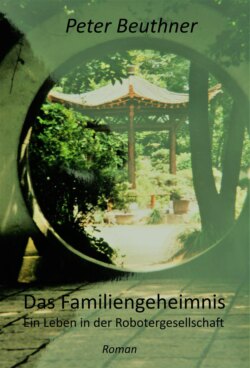Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Am nächsten Tag
ОглавлениеPünktlich um 6.00 Uhr erklang in den Schlafzimmern Musik, bei den Eltern Klaviermusik von Chopin, zart beginnend und dann langsam stärker werdend, bei den Kindern Modern Beat. Man hielt sich aber nicht lange auf dabei. Alle waren von früher Jugend an gewohnt, jeden Morgen, auch am Wochenende, regelmäßig zu dieser Zeit aufzustehen, und die Gewohnheit ließ sie inzwischen längst von allein erwachen. Es hätte eigentlich keines Weckers bedurft, aber mit der Gewißheit rechtzeitigen Gewecktwerdens ließ es sich eben doch irgendwie besser schlafen; man hatte dann nicht die Unruhe, vielleicht doch einmal zu verschlafen. Und ein bißchen angenehme Musik am Morgen war ja auch eine gute Einstimmung für den Tag. Alle kamen aus ihren Betten gekrochen, zogen sich einen Trainingsanzug über und gingen in den Garten.
Qiang und Chan pflegten von Kindheit an die seit Jahrtausenden überlieferten chinesischen Körperübungen des Tai Chi, und sie hatten es frühzeitig auch ihren eigenen Kindern weitervermittelt. Regelmäßig morgens gegen sechs Uhr ging die ganze Familie in den Garten, um gemeinsam ihre Entspannungsübungen zu machen. Es waren harmonische, fließende Bewegungen, die langsam und ohne Unterbrechung ausgeübt wurden, kombiniert mit einer bestimmten Atemtechnik und einer meditativen Konzentration auf bestimmte Körperregionen. Gemäß dem Prinzip von Yin und Yang ist jede Übung eine fortwährende Folge von Bewegung und Gegenbewegung: Auf Heben folgt Senken, auf Beugen folgt Strecken, auf Vorwärts- folgt Rückwärtsbewegung.
Nach etwa 40 Minuten beendeten sie ihre Übungen und gingen zum Duschen, und nach einer weiteren Viertelstunde saßen alle beisammen am Frühstückstisch.
Chinesen beginnen ihren Tag üblicherweise mit einem warmen Frühstück. Kaltes Essen ist für sie kein Essen. Dazu trinken sie entweder frisch aufgekochtes Wasser oder grünen Tee. Robby hatte bereits alles vorbereitet. Die Kinder aßen gern – so auch an diesem Morgen – gebratenes Gemüse mit Nudeln. Außerdem hatten sie sich ein paar süße Baozi, das sind gefüllte Klöße aus Hefeteig, bestellt. Es gibt nicht nur süße, sondern auch salzige Baozi, saure und sogar bittere, insgesamt mehr als 70 Varianten. Als Füllung wird Schweine-, Rind- oder Hammelfleisch, Krabben, Fisch und Gemüse aller Art verwendet. Sie sind sehr beliebt in China, man kann sie an fast jeder Straßenecke kaufen – chinesisches Fast Food. Sie werden gleich so, wie sie sind, das heißt ohne Soße oder ähnliches, von der Hand gegessen. Chan hatte sich Youtiao bei Robby bestellt, das sind fritierte Teigstangen, ähnlich den spanischen Churros, und dazu eine Art Crêpe, gefüllt mit Fleisch, Soja, Ei und Koriander. Qiang aß nur eine Schüssel Reissuppe, denn er mußte sich heute kurzfassen beim Frühstück, weil er bereits einen Besprechungstermin zu acht Uhr mit seinen Vorstandskollegen vereinbart hatte. Die neue Lage sollte besprochen, notwendige Maßnahmen mußten erörtert werden. Und dazu wollte er noch ein paar Dinge vorher vorbereiten.
Er wählte, wie gewöhnlich, den Runway, um zu seiner Firma zu kommen. Das war ökonomischer und ging sogar schneller, als wenn er seinen Wagen benutzt hätte. Diese Runways sind eine Art ‚Laufbänder‘ nach dem Prinzip der Rolltreppen, aber technisch verbessert und so breit, daß drei Leute bequem nebeneinander herlaufen können. Außerdem sind sie großzügig überdacht, so daß man sie auch bei Regen und Schneefall trockenen Fußes passieren kann, und des Nachts beleuchtet. Sie durchzogen die ganze Trabantensiedlung sternförmig, jeweils in Abschnitten von etwa 50 Meter Länge. In den vom Zentrum etwas entfernter gelegenen Bereichen gab es Querverbindungen. So wirkte die Gesamtanlage dieser Runways von oben betrachtet wie ein überdimensionales Spinnennetz.
Viertel vor acht war Qiang in seinem Büro, wo er von seinem Sekretär, natürlich auch ein Roboter, freundlich begrüßt wurde.
„Hallo Robby!“ grüßte er zurück. „Du weißt, daß wir gleich eine Besprechung haben?! Hast du uns ein paar Getränke hingestellt?“
„Ja, selbstverständlich! Alles erledigt!“ erwiderte Robby.
„Aber heute brauchen wir einen Prosecco zum Anstoßen. Es gibt was zu feiern!“
„Okay! Wird sofort erledigt!“
Qiang ging in sein Büro. Es war ein relativ großer, heller und unter Beachtung der Feng-Shui-Regeln sehr repräsentativ gestalteter Raum. Eine den neun Lebensbereichen des sogenannten Bagua entsprechende Gliederung und dezente Zuordnung verschiedener das Chi spendender, verstärkender und verteilender Hilfsmittel sowie weiterer im Raum verteilter Symbole und Accessoires sollten dafür sorgen, daß das Chi durch die Gesamtheit der in diesem Raum wirkenden Schwingungen positiv beeinflußt würde.
Eine breite Fensterfront ließ viel Licht herein. Das Mobiliar, eine Schrankwand, sein Schreibtisch, ein Tisch mit sechs Stühlen sowie eine Sesselgruppe, waren großzügig im Raum verteilt. Ein großes Aquarium stand zwischen der Sessel- und der Tischgruppe. Aquarien gelten in China als exzellente Chi-Spender, weil sie bewegtes Wasser mit dem Chi von Pflanzen und Tieren kombinieren, und gehören deshalb in jede Wohnung und eben auch in sein Arbeitszimmer. Daneben durften selbstverständlich die Pflanzen im Raum nicht fehlen, denn sie bringen ja selbst immer neue Lebenskraft hervor und gelten deshalb als ausgezeichnetes Hilfsmittel, um das Chi zu verstärken. Außerdem verbessern sie die Atemluft, indem sie die schädlichen Umweltgifte, die beispielsweise in Klebstoffen, Holzschutzmitteln und Kunststoffen enthalten sind, vernichten. Deshalb waren mehrere große Pflanzenkübel im Raum verteilt, vorzugsweise an Stellen, an denen das Chi nur spärlich vorhanden war und angereichert werden sollte, also insbesondere in den Ecken. Dabei handelte es sich vor allem um Philodendren und Drachenbäume, aber auch andere, bunt blühende Grünpflanzen, jedoch immer solche mit runden Blättern, da Pflanzen mit spitzen, lanzettförmigen Blättern ‚schneidendes Chi‘ aussenden und somit schädigend wirken könnten.
Die Ausgestaltung des Raumes war ganz wesentlich von Chan beeinflußt worden, die mit viel Liebe zum Detail und Gespür für Schönheit und schlichte Eleganz dafür gesorgt hatte, daß dieser Raum auf jeden, der ihn betrat, sogleich eine Atmosphäre des Wohlgefühls, der Harmonie und Behaglichkeit ausstrahlte.
Qiang machte sich ein paar Notizen, studierte seinen Terminkalender und gab noch verschiedene Anweisungen an seinen Sekretär, dann trafen auch schon seine Vorstandskollegen ein. Es war ein kleines, international besetztes Team, bestehend aus der Deutschen Susanne Krämer, zuständig für Finanzen und Controlling, der Britin Deborah Brown, zuständig für Marketing and Sales, dem Niederländer Lothar van Steben, zuständig für das operative Geschäft, das heißt für Entwicklung, Produktion und Auftragsabwicklung, der Französin Sandrine Marchal, zuständig für alle juristischen, administrativen und personellen Angelegenheiten, sowie ihm selbst, dem Chef, einem Chinesen. Qiang schätzte die Effektivität kleiner Führungsteams und flacher Hierarchien. Und die hohe Effizienz ihres Wirkens war der unbestrittenen Kompetenz der von ihm mit gutem Gespür ausgewählten Personen zu verdanken. Auch die vergleichsweise starke Repräsentanz von Frauen in seinem Team war mit Bedacht von ihm so gewählt, denn es war ihm hinreichend bekannt, daß gemischte Teams aus Männern und Frauen bessere Ideen entwickeln als gleichgeschlechtliche Gruppen – einfach schon deshalb, weil sie sich in ihren Fähigkeiten hervorragend ergänzen. Die sogenannten weiblichen Qualifikationen wie Team- und Dialogfähigkeit, emotionale Intelligenz und Organisationstalent sind in den von Männern dominierten Hierarchien früherer Zeiten meist zu kurz gekommen, häufig genug zum Nachteil der Unternehmen in Form von schlechtem Betriebsklima bis hin zu Frustration und dadurch bedingter Arbeitsunlust, mangelnder Bereitschaft zur Teamarbeit, häufigen „Hahnenkämpfen“ zwischen Konkurrenten auf der Karriereleiter und anderen negativen Begleiterscheinungen – letztlich resultierend in geringerer Rentabilität und geringerem Profit. Das alles war Qiang sehr bewußt, und deshalb legte er so einen gesteigerten Wert auf gemischte Teams, auf Teamarbeit generell und auf interdisziplinäre und internationale Zusammensetzung seiner Teams.
Natürlich können solche Stellenbesetzungen unter Umständen andere Probleme aufwerfen, die entsprechend beachtet und gegebenenfalls behutsam gelöst werden müssen. So war im Team von Qiang beispielsweise die Kenntnis der jeweiligen kulturellen Kommunikationsregeln sowie der unterschiedlichen Glaubens- und Wertorientierungen, insbesondere zwischen der chinesischen und der westeuropäischen Kultur, für die interkulturelle Kommunikation von immenser Bedeutung für das Funktionieren einer guten, effektiven und effizienten Zusammenarbeit.
Es hatte in der Anfangszeit immer mal wieder das eine oder andere Verständigungsproblem gegeben, was niemanden wirklich verwunderte, weil keiner von ihnen die unterschiedlichen, durch die jeweilige Kultur geprägten Interaktionsmuster per se beherrschte. Theoretisch hatten sich sicher alle vorher schon einmal mit dieser Problematik auseinandergesetzt, man lebte ja schließlich in einer „globalisierten“ Welt, aber es ist eben ein Unterschied, ob man sich in der Literatur etwas anliest oder in der Praxis anwenden muß. Während Qiang durch seine frühen Auslandsaufenthalte mit der westlichen Kultur schon vergleichsweise gut vertraut schien, hatten seine – durch die Bank noch relativ jungen – europäischen Kollegen vorher wenig direkte Berührung mit der chinesischen Kultur. Lediglich Deborah, die schon einige Zeit in Shanghai gelebt und an der renommierten China Europe International Business School ihren Master of Business Administration gemacht hatte, beherrschte die chinesische Sprache hinreichend gut. Aber selbst innerhalb des westlichen Kulturraumes gab es ja trotz aller Ähnlichkeiten und Vereinheitlichungsbemühungen immer noch nennenswerte Unterschiede, die in den einzelnen Regionen sogar ausdrücklich gepflegt wurden. Nicht jeder verstand beispielsweise den trockenen und häufig derben englischen Humor. Und nicht jeder kam mit der übertriebenen Gründlichkeit der Deutschen zurecht. So mußten sie alle erst lernen, den anderen wirklich richtig zu verstehen, und zwar im täglichen Umgang miteinander – learning by doing, nannten sie das. So ein Lernprozeß brauchte naturgemäß einige Zeit. Aber Qiang hatte von Anfang an nachdrücklich dafür gesorgt und vorbildhaft vorgelebt – und damit hat er diesen Lernprozeß ganz sicher auch beschleunigt –, daß in seiner Firma eine offene, vertrauensvolle, sehr kollegiale Atmosphäre herrschte, in der der Teamorientierung und der Aufrechterhaltung der sozialen Harmonie ein sehr hoher Stellenwert beigemessen wurde. Mißverständnisse und Fehler wurden offen angesprochen, aber nicht kritisiert, sondern gemeinsam ausgeräumt. Konfrontierende Äußerungen sollten unter allen Umständen vermieden werden. Deshalb war er stets bemüht, eine harmonische Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die einen aggressiven Gesprächsstil, wie er im Westen des öfteren gepflegt wurde, gar nicht erst aufkommen ließ.
Da man sich inzwischen seit der Firmengründung vor etwa fünf Jahren kannte und erfolgreich zusammenarbeitete, hatte jeder eine hinreichend starke Sensibilisierung für die unterschiedlichen kulturellen Prägungen und damit auch das notwendige Verständnis für die verschiedenen Kommunikations- und Verhaltensweisen der anderen erworben, um kulturelle Regelverletzungen zu vermeiden. Die europäischen Kollegen hatten mit der Zeit auch gelernt, „zwischen den Zeilen zu lesen“, das heißt, nichtverbale Mitteilungen, im situativen Kontext verborgene Informationen, „verschlüsselte“ Botschaften wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Das war notwendig für sie, um ihren Chef richtig zu verstehen. Denn obwohl Qiang stets sehr bemüht war, seine Interaktionsweise derjenigen seiner europäischen Kollegen anzupassen, passierte es ihm unwillkürlich doch immer mal wieder, sich in Andeutungen auszudrücken und seinen Zuhörern zu überlassen, das Unausgesprochene selbst zu interpretieren. Seine tiefe Verwurzelung in der chinesischen Kultur und Tradition ließ sich eben nicht so ohne weiteres ablegen, vielmehr prägte sie sein Denken und Handeln ganz selbstverständlich und automatisch. Für ihn war es Routine. Er hatte von klein auf ein feines sensorisches Gespür entwickelt und gelernt, Andeutungen, Unausgesprochenes und verschlüsselte Botschaften wahrzunehmen und zu interpretieren. Und gewöhnlich pflegte er, sich selbst normalerweise in der gleichen Weise auszudrücken. Die Zuhörer mußten deshalb nicht nur darauf achten, was er sagte, vielmehr mußten sie gewissermaßen zwischen den Zeilen lesen, mußten also versuchen zu interpretieren, was er wohl tatsächlich gemeint haben könnte. Wenn er sich allerdings im Gespräch einem verdutzten oder verständnislos blickenden Gesicht gegenüber sah, dann erinnerte er sich aber immer gleich wieder und erläuterte bereitwillig seine Ausführungen.
Dem „Gesicht“ im Sinne der Gesichtswahrung wird im chinesischen Sozialverhalten übrigens eine ganz besondere Bedeutung, ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, und entsprechend schwer wiegt ein „Gesichtsverlust“, zum Beispiel als Folge von Verstößen gegen die von der Gesellschaft als verbindlich erachteten Werte und Normen oder auch nur von unerfüllten Erwartungen an seine Person. So ein Gesichtsverlust führt bei den Betroffenen in aller Regel zu großer Verlegenheit oder Schamgefühl und stört damit die nach Konfuzius geltenden Prinzipien für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die vor allem der Herstellung und Erhaltung der sozialen Harmonie dienen sollen. Deshalb achten die Chinesen beim Reden wie im Handeln sehr darauf, niemanden leichtfertig zu beschämen, sondern bemühen sich vielmehr, ihnen „Gesicht zu geben“.
Die europäischen Kollegen hatten damit in der Regel ein Problem, denn ihr ganzes Reden und Handeln ist traditionell viel stärker durch selbstbewußtes, intellektuelle Überlegenheit ausstrahlendes Auftreten und durch eine gelegentlich sehr aggressive, unerbittlich fordernde Rhetorik geprägt. Sie konfrontieren ihre Gesprächspartner üblicherweise gleich zu Beginn mit den harten Fakten und liefern dann ihre Begründungen nach, während die Chinesen es gewohnt sind, zunächst erst mal – nach europäischem Verständnis – „lange um den heißen Brei“ herumzureden, um sich dann ganz langsam und allmählich an die relevanten Aussagen heranzutasten. Sie fühlen sich oft düpiert von dem konfrontierenden westlichen Gesprächsstil, während die Europäer häufig gelangweilt und schon ermüdet sind, wenn ihre chinesischen Gesprächspartner endlich auf den Punkt kommen. Auch das Gesprochene selbst, die inhaltliche Aussage wird unterschiedlich bewertet – die Schwerpunkte liegen hier auf der Logik und dort auf dem chinesischen Verständnis von Vernunft. Während eine Aussage für Europäer vor allem logisch sein muß, gilt es den Chinesen als entscheidender, daß sie auch vernünftig ist im Sinne einer Übereinstimmung mit der menschlichen Natur, seiner Behutsamkeit, Geduld und Selbstzurücknahme in den zwischenmenschlichen Beziehungen sowie in der Vermeidung aller Extreme. Wer sich in einer Auseinandersetzung dem Vorwurf „bu jiang-li“, das heißt: „Er redet keine Vernunft“, aussetzt, der hat sein Gesicht verloren. Das ist die schlimmste Mißbilligung. „Alles Unheil kommt davon, daß man den Mund zu weit auftut“, lautet ein chinesisches Sprichwort. Deshalb gehen die Chinesen mit sprachlichen Äußerungen gewöhnlich zurückhaltend um und vermeiden Konflikte, wie sie leichthin in Diskussionen durch Rede und Gegenrede entstehen können. Der Austausch von Informationen und Fakten, nach westlicher Auffassung das Hauptziel einer Kommunikation, ist bei chinesischen Gesprächspartnern eher Nebensache; für sie ist die verbale Kommunikation in erster Linie ein Mittel, um Beziehungen zu beeinflussen und zu festigen.
Für Marketing and Sales hatte Qiang mit Deborah Brown ganz bewußt einen English native speaker eingestellt, denn Englisch war nun mal die Weltsprache schlechthin. Die Globalisierung hatte es mit sich gebracht, daß Englisch sich als einheitliche Verkehrs- und Geschäftssprache durchsetzte – und das, obwohl um die Jahrtausendwende nur etwa 320 Millionen Menschen Englisch gegenüber 1,3 Milliarden Menschen Chinesisch als Muttersprache hatten. Aber China war zu jener Zeit noch in der Entwicklung zur Weltmacht, hatte damals einfach nicht die Bedeutung wie die führenden westlichen Industrienationen, die sich im Geschäftsverkehr und selbst im Tourismusbereich alle des Englischen befleißigten. Inzwischen haben sich die Verhältnisse dramatisch geändert; jetzt ist China die Weltmacht schlechthin. Viele Nicht-Chinesen in aller Welt lernen inzwischen die chinesische Sprache. Nichtsdestotrotz hatte sich Englisch längst als Weltsprache durchgesetzt und fest etabliert. Auf dem Wege zur Weltmacht hatten mehr und mehr chinesische Jugendliche Englisch in den Schulen gelernt, um im internationalen Handel bessere Chancen zu haben. Auch dieser Trend hatte die Vormachtstellung von Englisch weiter unterstützt. Und gerade weil Englisch im Geschäftsverkehr so wichtig war, hatte Qiang den Marketing- und Sales-Bereich britisch besetzt.
Qiang begrüßte jeden seiner Kollegen per Handschlag, obwohl er eigentlich – wie alle Chinesen – das in Europa übliche Händeschütteln verabscheute. Aber da er nun mal hier lebte, versuchte er, sich den europäischen Sitten so gut wie möglich anzupassen. Während er noch mit jedem seiner Kollegen ein paar freundliche Worte wechselte, hatte Robby den Prosecco eingeschenkt und ging nun herum, um jedem ein Glas anzubieten.
„So, meine Damen und Herren“, begann Qiang feierlich seine Rede, obgleich sie sich seit Jahren untereinander duzten, „um gleich mal ohne Umschweife auf den Anlaß dieser Besprechung zu kommen: Die Sache ist so gut wie perfekt! Und darauf sollten wir erst einmal anstoßen.“ Sie erhoben die Gläser und prosteten sich zu. „Ich bin ausgesprochen happy“, fuhr Qiang fort, „daß wir gestern so weit gekommen sind. Herr Güssen, der Geschäftsführer von AnthropoTec, zeigte sich am Ende doch ziemlich kooperativ. Unsere Abschätzung des Unternehmenswertes und seiner weiteren Geschäftsaussichten, die ich lange und ausführlich mit ihm diskutiert habe, machten ihm letztlich klar, daß sein Unternehmen in dieser Form nicht mehr lange würde bestehen können. Mit der derzeitigen kognitiven Performance seiner Roboter ist er einfach nicht mehr konkurrenzfähig, da helfen ihm auch die Vorteile seiner sicher sehr guten anthropotechnischen Eigenschaften nicht weiter. Die Kunden wollen heute einfach immer intelligentere Roboter, und da haben wir eindeutig die Nase vorn. Er hätte dringend in die Verbesserung der kognitiven Performance investieren müssen, aber dazu fehlten ihm die Mittel und das Know-how – vielleicht auch die notwendige Einsicht. Und den besten Zeitpunkt dafür hat er ohnehin schon verpaßt. Das könnte er jetzt auch gar nicht mehr aufholen, und das hat er schließlich eingesehen. Man konnte förmlich spüren, wie sich in ihm die Resignation breitmachte, obgleich er sehr bemüht war, sich nichts davon anmerken zu lassen. Und dann ging es nur noch um die Konditionen. Er wollte natürlich noch möglichst viel herausholen – für sich, aber auch für seine Mitarbeiter. Er selbst wird sich wohl zur Ruhe setzen, jedenfalls hatte ich diesen Eindruck. So deutlich hat er es nicht gesagt. Immerhin ist er bereits über sechzig und finanziell gut versorgt, wozu wir ja jetzt auch noch etwas beitragen. Das wird also nicht das Problem sein. Wichtiger ist ihm seine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern, und das ehrt ihn. Er hat zirka 80 Leute ohne die freien Mitarbeiter. Wenn wir die alle übernehmen würden, hätten wir ´ne ganze Menge Redundanz – aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Wir können nur die übernehmen, die uns das Know-how mitbringen, das uns fehlt, beziehungsweise wo die besser sind als wir – also vor allem im anthropotechnischen Bereich. Nur so haben wir einen Synergiegewinn.“
Bei dem Wort bekam er ganz glänzende Augen und kam fast ins Schwärmen: „Stellt euch das mal vor, Leute, wir verlieren auf einen Schlag einen unserer größten Konkurrenten und gewinnen gewissermaßen für ´nen Appel und ´nen Ei“, er beherrschte das Deutsch schon wie seine Muttersprache, „genau die Kompetenz, die wir bisher nicht in dem Maße hatten, um wirklich ‚Spitze’ zu sein. BrainTech und AnthropoTech vereinigt – das ist nicht mehr zu toppen, jedenfalls kann uns in Europa keiner mehr das Wasser reichen. Wir werden eine ganz neue Roboter-Generation entwickeln, eine Symbiose aus den hervorragenden kognitiven Fähigkeiten unserer Roboter mit den ausgezeichneten anthropotechnischen Eigenschaften derer von AnthropoTech. Damit werden wir unschlagbar sein.“
Nachdem er sich so eine Weile fast in den Rausch geredet hatte, kehrte allmählich wieder die Sachlichkeit zurück.
„Eine andere Frage, die wir noch zu klären haben, ist die Standortfrage: Was machen wir mit dem Standort Leipzig? Geben wir ihn auf? Und wann? Und wie können wir dabei noch ein gutes Geschäft machen? Ich denke, es macht einfach keinen Sinn, den Standort mit seiner Infrastruktur zu erhalten“, gab er gleich selbst die Antwort. „Dann brauchten wir auch wieder mehr Personal dort. Es ist in jeder Hinsicht effektiver, den Standort zu schließen und die Leute, die wir brauchen, hierher zu holen. So deutlich habe ich das Thema gestern noch nicht angesprochen, aber wir werden in diesem Sinne verhandeln müssen. Ich bin sicher, Güssen wird das letztlich akzeptieren – er ist selbst Geschäftsmann und kennt die ökonomischen Erfordernisse. Wir werden aber seinen Mitarbeitern, die wir nicht übernehmen können, sicher eine Abfindung zahlen müssen, das erwartet er von uns. Und anders werden wir wahrscheinlich auch gar nicht aus den Verträgen mit ihnen herauskommen.“
„Ist da schon über Zahlen gesprochen worden?“, fragte Sandrine.
„Nein, soweit sind wir gar nicht gekommen; Güssen gab hier nur generell seiner Erwartung Ausdruck.“
Er machte eine kurze Pause, und da keine weitere Frage kam, fuhr er fort: „Wir müssen also jetzt sehr kurzfristig“, und er legte die Betonung deutlich auf das „kurz“, „folgende Action Items behandeln: Erstens alle juristischen Fragen im Zusammenhang mit der Geschäftsübernahme klären, Sandrine. Und denk auch an deren Patente, die sind sehr wichtig für uns. Zweitens die Personalfrage, also welche Leute sollten wir übernehmen und welche nicht – das müßt ihr zusammen entscheiden: Sandrine, Deborah und Lothar; zu diesem Zweck habe ich mit Güssen vereinbart, daß er uns eine Liste seiner Mitarbeiter mit deren Personalprofil zuschickt. Drittens eine erste Abschätzung der Gesamtkosten für die Übernahme einschließlich aller möglichen beziehungsweise notwendigen Abfindungszahlungen, Betriebsschließungs- und Überführungskosten, eventuell notwendige Erweiterungen am hiesigen Standort und so weiter, da bist du gefordert Susanne. Viertens Einsichtnahme in die technische Dokumentation, sobald dies möglich ist, und Identifizierung der für unsere weitere Produktentwicklung relevanten und interessanten Potentiale – darum kümmerst du dich mit deinen Ingenieuren, Lothar. Und fünftens, Deborah, du analysierst den Kundenkreis von Güssen und die sich für uns ergebenden zusätzlichen Geschäftspotentiale noch einmal etwas genauer. Du könntest auch schon mal ein Schreiben vorbereiten, mit dem wir alle Kunden von Güssen bezüglich der Geschäftsübernahme informieren, und in dem wir ihnen gleichzeitig unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten, et cetera, et cetera; du weißt schon. Ich selbst entwerfe einen groben Zeitplan für den Gesamtvorgang, den wir dann mit zunehmender Klärung des Prozesses gemeinsam verfeinern werden. Also, wie sagt ihr Deutschen doch immer: ‚Es ist viel zu tun, packen wir es an!‘ – aber unsere laufenden Geschäfte dürfen in der Zwischenzeit nicht darunter leiden!“
Sie machten einen neuen Termin für das nächste Meeting aus und unterhielten sich anschließend noch über diverse Detailfragen, bevor sich die Versammlung gegen frühen Mittag in guter Stimmung auflöste.
Qiang zog sich in sein Büro zurück, wo er noch einmal in Ruhe alles Revue passieren lassen wollte. Immer wieder ging er gedanklich sein Verhandlungsmarathon mit Güssen und alle gerade besprochenen Punkte zum weiteren Vorgehen durch, immer wieder prüfend, ob nicht vielleicht wichtige Dinge übersehen worden sind, die unter Umständen sogar noch ein Scheitern der Geschäftsübernahme verursachen könnten. Es hing für ihn einfach zu viel vom Erfolg der Aktion ab. Zum einen hatte diese günstige Gelegenheit zu einer nicht unerheblichen Expansion seines Geschäfts mit einem Schlage eine überragende Bedeutung für die ganze weitere Entwicklung seiner Firma. Zum anderen aber war es auch für ihn persönlich sehr wichtig, nicht durch einen Mißerfolg sein Gesicht zu verlieren.
So saß er schon längere Zeit grübelnd in seinem Büro, als Robby vorsichtig und leise die Tür öffnete, um ihm mitzuteilen, daß Mister Joseph Samuel Odeke von der ‚African Union System Technology Enterprise‘ ihn am Telefon zu sprechen wünschte.
„Okay, stell durch!“ sagte Qiang, denn er wußte sofort, daß dies ein potentieller Geschäftspartner für ihn sein könnte. Auf jeden Fall aber gehörte er zu der Delegation, die ihm demnächst in seiner Firma einen Besuch abstatten wollte. Die AUSTER, wie Qiang die Firma kurz zu nennen pflegte, hatte großes Interesse an der Robotertechnologie, und Qiang seinerseits war nicht abgeneigt, ein Joint-venture mit dieser Firma einzugehen, um einen besseren Zugang zum afrikanischen Markt zu gewinnen, vorausgesetzt, die Konditionen stimmten und waren für ihn akzeptabel. So war es also beiderseitiges Interesse, weshalb Qiang sie zu einem Besuch in seiner Firma eingeladen hatte.
Mister Joseph Samuel Odeke erläuterte Qiang etwas umständlich, daß er inzwischen noch einigen Politikern von seinem bevorstehenden Besuch bei ihm erzählt hatte und daß diese sich überaus interessiert an dem Besuchsprogramm gezeigt hätten, weshalb er sich nun veranlaßt sah, Qiang zu fragen, ob sich neben den ohnehin schon bekannten Politikern aus dem Wirtschaftsrat der Pan-Afrikanischen Union vielleicht noch einige weitere der Delegation anschließen könnten. Ja, und im Grunde bekäme die ganze Aktion jetzt einen völlig anderen Touch, da die betreffenden Politiker – allein schon in Anbetracht ihrer zahlenmäßigen Dominanz, aber vor allem auch durch Geltendmachung ihres Führungsanspruchs – das Mandat zum Handeln an sich zogen. Wie auch immer, Qiang willigte selbstverständlich ohne Zögern ein, denn es konnte schließlich nur vorteilhaft für seine möglichen künftigen Geschäfte dort sein, wenn er bereits über gute Beziehungen zur wirtschaftspolitischen Zunft verfügte.
Nachdem das Telefonat beendet war, stand Qiang auf und ging zum Fenster. Gedanklich war er schon wieder bei AnthropoTech, aber seine Blicke schweiften über das vor ihm liegende Firmengelände. Das ganze Areal – eingezäunt von einem hohen, stabilen und elektronisch überwachten Sicherheitszaun – war von hier oben gut überschaubar, denn es war nicht sehr groß, und es gab insgesamt nur drei Gebäude: Das vierstöckige Zentralgebäude, in dem die Unternehmensführung residierte und in dem sich neben einer ganzen Reihe von Konferenzräumen auch verschiedene Arbeitszimmer für die Ingenieure, Vertriebs- und Kaufleute befanden. Daneben gab es eine Fertigungshalle sowie ein Trainingszentrum für die Roboter.
Mehr Platz brauchte er auf absehbare Zeit auch nicht, denn die Vertriebler waren vorwiegend im Außendienst tätig, und seine Ingenieure arbeiteten zu einem großen Teil ihrer Zeit zu Hause. Sie waren alle mit sehr leistungsfähigen Computern ausgestattet und über die schnellen und gesicherten Übertragungsstrecken des WorldNets miteinander verbunden. So konnten sie jederzeit Informationen untereinander austauschen – per Videotelefonie beziehungsweise Videokonferenzschaltungen oder in Form von Bild- und Dateiübertragungen. Sie konnten aber auch gleichzeitig auf den zentralen Server der Firma zugreifen und interaktiv die dort gespeicherten Dateien mittels geeigneter Kollaborationstools gemeinschaftlich bearbeiten. Ihre Computer wurden ihnen von der Firma zur Verfügung gestellt und waren mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen gegen Mißbrauch und Spionage ausgestattet. In der Firma mußten sie lediglich zur Aufgabenverteilung und -abstimmung sowie zu speziell anberaumten Projektbesprechungen oder sonstigen besonderen Anlässen erscheinen, wofür die verschiedenen Konferenzräume zur Verfügung standen. Aber es stand ihnen selbstverständlich auch frei, in der Firma zu arbeiten, wenn sie beispielsweise zu Hause nicht die notwendige Ruhe und Konzentration zum Arbeiten fanden. Es gab zwar in Summe deutlich weniger Arbeitsräume als Mitarbeiter, aber, wie die Erfahrung zeigte, immer ausreichend viele. Es gab jedoch keine feste Raumzuteilung. Wer in die Firma zum Arbeiten kam, konnte heute in diesem und morgen in jenem Raum Platz finden. Die Belegung war immer nur temporär geregelt. Die Räume verfügten alle über die gleiche Ausstattung. In einem gesicherten und video-überwachten Lagerraum hatte jeder Mitarbeiter einen verschließbaren Schrank, in dem er seine Arbeitsunterlagen wie auch persönliche Dinge verwahren konnte.
Qiang beschloß, mal wieder einen Rundgang durch die Firma zu machen. Das tat er häufiger, unter anderem auch, weil er die Kontakte zu seinen Mitarbeitern ganz bewußt pflegen wollte. Natürlich war ihm klar, daß er immer nur wenige antreffen würde, aber da er das relativ häufig zu machen pflegte, erwischte er schließlich doch alle mal. Und immer nahm er sich dann genügend Zeit, um sich mit ihnen über ihre Aufgaben und Lösungsansätze, über mögliche Probleme oder Risiken, über Verbesserungsvorschläge und sonstige fachlichen beziehungsweise betrieblichen Fragen, oder auch einfach nur über persönliche Belange zu unterhalten. Daher konnte er sich von jedem seiner Mitarbeiter ein gutes Bild machen, wußte sie hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Leistungen richtig einzuschätzen und erfuhr auch von möglichen Schwierigkeiten oder Krankheiten im familiären Bereich, was ihn als überzeugten Konfuzianer stets ganz spontan veranlaßte, seine Hilfe anzubieten.
Heute traf er in einem der Konferenzräume auf eine Gruppe angeregt diskutierender Ingenieure, die nach einer verbesserten Lösung für die vergleichsweise noch sehr rudimentäre Mimik der Roboter suchten – eine schwierige Aufgabe. Denn der Ausdruck des Gesichts entsteht aus einem äußerst facettenreichen und komplexen Zusammenspiel von 43 Gesichtsmuskeln, welches den Menschen zu insgesamt mehr als 10.000 unterschiedlichen Mienen befähigt. Dieses vielfältige Mienenspiel für die Roboter auch nur annähernd nachzubilden, ist allein schon eine kolossale Herausforderung. Aber der Mensch ist nicht nur zu dem eigenen Mienenspiel in der Lage, nein. Fast jeder Mensch auf der Welt, ausgenommen Autisten, versteht dank seiner Spiegelneuronen auch ganz spontan und instinktiv, ohne darüber nachdenken zu müssen, das Mienenspiel seiner Mitmenschen. Selbst feinste Regungen im Gesicht der Mitmenschen kann er entschlüsseln und sich auf diese Weise in deren Gefühlswelt hineinversetzen. So erkennt er Freude, Liebe, Trauer, Schmerz, Angst, Verachtung, Lüge, Wut und so weiter, und so weiter. Dieses Einfühlungsvermögen, die Empathie, ermöglicht es dem Menschen erst, emotionale Beziehungen zu anderen aufzubauen – eine eminent wichtige Eigenschaft, da sie die Grundlage sämtlicher sozial höher entwickelter Gemeinschaften bildet. Schon Neugeborene, die noch gänzlich auf den Schutz und die Fürsorge ihrer Eltern angewiesen sind, drücken ihr Befinden durch ein babyhaftes Mienenspiel aus. Und bereits im Alter von etwa zwei Jahren entwickeln sie ein Ich-Bewußtsein, unterscheiden zwischen ihren eigenen Gefühlen und denen anderer und beginnen die Emotionen der anderen zu deuten. Aber wie bringt man so etwas einem Roboter bei? Immerhin sollte er sich ja in seinem sozialen Umfeld völlig autonom bewegen können. Und überall hat er es mit Menschen zu tun, die sich in hohem Maße über Mimik und Körpersprache ausdrücken. Um sich mit ihnen adäquat verständigen und ein allseits akzeptiertes Mitglied dieser menschlichen Gemeinschaft sein zu können, sollte er logischerweise deren Sprache – aktiv und passiv – auch verstehen. Davon war Robby allerdings noch ziemlich weit entfernt. Er beherrschte das gesprochene Wort, aber Emotionen waren ihm noch weitgehend fremd. Man hatte ihm die „Deutung“, das heißt die Interpretation, gewisser grundlegender Mienen und das Erkennen der entsprechenden Mienen anderer antrainiert. Aber das richtige Verständnis dafür fehlte ihm noch.
Qiang hatte sich zu ihnen gesetzt und eine Weile zugehört. Er beteiligte sich auch an der Diskussion, denn das Thema war ihm sehr wichtig, arbeitete er doch ständig an der Perfektionierung seiner Roboter. Und gerade diese Thematik – Bewußtsein, Emotionen – beschäftigte ihn besonders intensiv. Aber eigentlich, fiel ihm irgendwann ein, wollte er ja einen Rundgang in der Firma machen, und so verabschiedete er sich schließlich von seinen Mitarbeitern und ging weiter zur Fertigungshalle.
Dort begrüßte er den Aufsicht habenden Ingenieur, den einzigen Menschen in der ganzen Halle: „Guten Tag, Herr Wolter. Wie geht es Ihnen?“ Seine Mitarbeiter sprach er grundsätzlich alle per Sie an.
„Guten Tag, Herr Wang“, antwortete dieser. „Danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Hab’ auch nicht viel zu tun heute; die Roboter machen einen guten Job.“
„Ja, das hoffe ich doch“, erwiderte Qiang. „Und Sie werden auch bald wieder ordentlich zu tun bekommen. Es stehen einige Neuerungen an, und die müssen sehr schnell umgesetzt werden. Das dauert allerdings noch ein Weilchen. Also genießen Sie die Ruhe noch solange, damit Sie dann mit frischen Kräften drangehen können.“
„Mache ich gerne. Aber ich freue mich auch schon auf Ihre Neuerungen. Eine interessante Abwechslung ist immer willkommen.“
„Wir haben viel vor, Sie werden sehen. Es wird fast einen Quantensprung geben. Und ich möchte, daß Sie dabei in einem der beiden Teams mitwirken und Ihr fertigungstechnisches Know-how einbringen.“
„Ja selbstverständlich, gerne! Sie machen mich schon richtig neugierig.“
„Naja, etwas Geduld noch. Wir reden bald konkreter darüber.“
„Okay!“
„So, und hier läuft alles rund?“ Er schaute in die Halle.
Dort herrschte reges „Leben“: Zahlreiche Roboter standen an Fließbändern und montierten neue Roboter. Andere schafften unentwegt neue Baugruppen und Montageteile herbei, die größtenteils im „Additive Manufacturing“-Verfahren mit 3D-Druckern auf der Basis von mit ComputerAidedDesign-Programmen erstellten Konstruktionsdateien hergestellt wurden. Die Roboter reproduzierten sich somit gewissermaßen selbst. Sie arbeiteten rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Pausen brauchten sie nicht. Nur ihre Akkus mußten von Zeit zu Zeit ausgetauscht und wieder aufgeladen werden. Aber auch dabei halfen sie sich gegenseitig, brauchten keine menschliche Unterstützung. Sie funktionierten so perfekt, daß es selbst einer Aufsichtsperson nicht bedurft hätte. Aber Qiang wollte trotzdem wenigstens tagsüber nicht darauf verzichten. Und Herr Wolter war ja auch nicht nur zur Aufsicht da. Es mußten immer mal wieder neue Programme eingegeben und Maschinen für neue Arbeitsvorgänge von neuem eingerichtet werden. Sämtliche Arbeitsvorgänge, die mit der Produktion zu tun hatten, gehörten zu seinem Job. Er hatte auch sicherzustellen, daß eine gleichbleibend gute Qualität der Produkte gewährleistet wurde.
Nachdem sich Qiang mit ihm eine Weile unterhalten hatte, ging er weiter zum Trainingszentrum, einem Gebäude mit verschiedenen, für unterschiedliche Schulungs- und Trainingszwecke ausgestatteten Räumen. Dort wurden die neuen Roboter auf die für ihre künftigen Einsatzzwecke und Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten getrimmt. Aus der Produktion kamen sie lediglich mit bestimmten Basisfähigkeiten, die ihnen per Computerprogramm vermittelt worden waren. Das war gewissermaßen ihre „Erbanlage“, alles Weitere mußten sie lernen wie ein neugeborenes Kind. Allerdings ging dies bei ihnen sehr viel schneller als bei einem heranwachsenden Kind. Sie brauchten nicht zu schlafen, sie brauchten keine Pausen. Sie wurden tagelang, wenn nötig auch wochenlang, rund um die Uhr trainiert. Dazu gab es beispielsweise Räume, in denen sie audiovisuell mit diversen simulierten Situationen sowohl aus dem alltäglichen Leben als auch aus ihrem künftigen Einsatzumfeld konfrontiert wurden. Ein Robot-Teacher gab jeweils zusätzliche Erklärungen, Verhaltensregeln, Gut-Schlecht-Bewertungen und anderes mehr. Anschließend mußten sie diese Situationen selber nachspielen und beweisen, daß sie ihre Lektion, das „richtige“ Verhalten, gelernt hatten. In einem anderen Raum machten sie – wieder unter Anleitung eines Robot-Teachers – allerlei sportliche Übungen, um die Koordination und Sicherheit ihrer Bewegungsabläufe zu vervollkommnen. In wieder anderen Räumen wurde ihnen jede Menge speziell aufbereitetes Fakten-Wissen „eingebläut“, das sie wie mit einem „Nürnberger Trichter“ förmlich in sich rein saugten. Und was sie hierbei gegenüber Menschen besonders auszeichnete, war die Tatsache, daß sie das, was sie hier einmal eingespeichert hatten, später auch nicht mehr vergaßen. Dieses Wissen hatten sie für alle Zeit ständig parat. Nur das richtige Anwenden dieses Wissens mußte intensiv trainiert und wiederholt geprüft werden, denn das richtige Einordnen der Ereignisse und Vorgänge in den jeweiligen Gesamtkontext bereitete ihnen immer mal wieder Schwierigkeiten.
Auch hier gab es einen menschlichen „Supervisor“, Herrn Grünschnabel. Der Mann war nicht so grün, wie sein Name hätte vermuten lassen können; ganz im Gegenteil, der Mann war ein exzellenter Psychologe und Neuroinformatiker. Er hatte die Lernprogramme alle selbst entwickelt und beobachtete nun fortlaufend ihre Wirksamkeit und die damit erzielten Erfolge. Jedesmal, wenn ihm etwas mißfiel oder auch nur suboptimal erschien, griff er spontan korrigierend in das Ablaufgeschehen ein, wies seine Robot-Teacher zu entsprechend anderen Verhaltensweisen an und änderte daraufhin seine Lernprogramme. So lernte auch er selbst ständig hinzu und optimierte seine Roboter-Lernprogramme Schritt für Schritt.
Vor einiger Zeit war er bei Qiang damit vorstellig geworden, seine Lernstrategien und Untersuchungsergebnisse in einem Buch veröffentlichen zu wollen. Generell spräche nichts dagegen, hatte Qiang ihm geantwortet. Er erwarte aber, daß der Inhalt vor einer Veröffentlichung mit ihm abgestimmt werden müsse, denn es ging immerhin um wichtiges Firmen-Know-how. Alle für die Firma erarbeiteten Ergebnisse waren schließlich deren Eigentum, deshalb war eine Publizierung ohne seine Zustimmung nicht erlaubt.
„Guten Tag, Herr Grünschnabel“, begrüßte Qiang ihn, als er seinen Raum betrat.
„Ach, Herr Wang, grüß Gott!“ schreckte dieser von seinem Platz hoch. Er war offenbar gerade sehr in seine Studien vertieft gewesen. An seiner Wand hingen verschiedene Flachbildschirme, auf denen das Geschehen jedes Übungsraumes dargestellt wurde. Hier saß Herr Grünschnabel oft stundenlang und beobachtete alles sehr genau.
„Was machen Ihre Studien? Kommen Sie gut voran? Auch mit Ihrem Buch?“ wollte Qiang wissen.
„Ja, ja, ich komme voran“, antwortete dieser, immer noch nachdenklich. „Aber das Schreiben ist doch etwas schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Gesprochen ist alles ziemlich schnell, aber wenn man es schreiben soll, dann müht man sich manchmal elend lange mit einzelnen Formulierungen herum. Das kostet viel Zeit – Zeit, die man anderweitig auch interessanter oder jedenfalls angenehmer ausfüllen könnte. Und so erwische ich mich selber manchmal bei der Fragestellung, ob ich nicht die ganze Schreiberei wieder aufgeben sollte. Der ‚innere Schweinehund‘, wissen Sie?“
„Ja, das verstehe ich“, bestätigte ihm Qiang. „Das Schreiben liegt nicht jedem, mir zum Beispiel auch nicht. Ich bin mehr ein Praktiker, wissen Sie? Ich habe Visionen und Ideen, aber ich will sie nicht beschreiben. Ich will sie umsetzen! Da halte ich es ganz mit ihrem klugen Landsmann Johann Wolfgang von Goethe, der wohl für so ziemlich jede Situation einen passenden Spruch parat hatte. Und in diesem Kontext beziehe ich mich auf seinen Ausspruch:
‚Es ist nicht genug zu wissen, man muß es auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen, man muß es auch tun‘.
Trifft doch den Nagel auf den Kopf, oder?“
„Ich bin begeistert, Herr Wang, wie Sie sich selbst in der deutschen Literatur auskennen“, entgegnete Herr Grünschnabel fast ehrfurchtsvoll. „Ja, wenn ich auch nur ein bißchen von Goethes Talent zum Schreiben hätte, dann wäre mein Buch schon fertig“, fügte er wehmütig hinzu.
„Kopf hoch, mein Lieber!“ ermutigte Qiang ihn. „Sie werden das schon schaffen, davon bin ich überzeugt. Haben Sie nur etwas Geduld mit sich selber. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Entspanntes Arbeiten ist leichteres Arbeiten, Sie werden sehen.“
„Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Wang.“
Qiang klopfte ihm ermutigend auf die Schulter: „Sie machen das schon!“
Dann verabschiedete er sich und ging zurück in sein Büro. Es war inzwischen kurz nach drei Uhr geworden, und er beschloß, nach Hause zu gehen. Er wußte, daß auch Chan heute früher zu Hause sein würde. Mal sehen, vielleicht ließe sich ja gemeinsam noch etwas unternehmen?