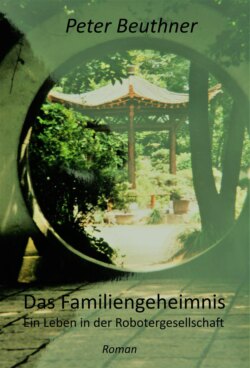Читать книгу Das Familiengeheimnis - Peter Beuthner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Familienabend
ОглавлениеPünktlich um 19 Uhr saß die Familie vollständig versammelt an dem runden Essenstisch. Es war Mittwochabend, der fast schon traditionelle, wöchentliche Familienabend bei Wangs. Eigentlich bemühten sich alle Familienmitglieder, möglichst jeden Abend gemeinsam zu essen, weil man sich tagsüber kaum sah. Aber dies ließ sich aufgrund vieler unterschiedlicher Verpflichtungen leider nicht immer so einrichten. Deshalb hatte man sich schon früh darauf verständigt, wenigstens einen Abend in der Woche für die Familie freizuhalten. Natürlich ließ sich auch dieser Termin nicht immer streng einhalten, aber es blieben doch eher Ausnahmen, wenn mal jemand fehlte.
Robby hatte gerade das Essen aufgetragen: Es gab Tang Tschu Dschu Ro, Schweinefleisch süß-sauer, was die Kinder ganz besonders gern aßen. Außerdem gebackene Jao Tse, köstlich gefüllte Teigtäschchen in verschiedenen Variationen, und Sia Tang, eine Krabbensuppe.
„Hmmm! Super Essen!“ schwärmte Jiao, als sie sah, was es heute gab.
„Man, geht’s uns heute wieder gut!“ stimmte auch Jie gleich zu.
„Ihr tut ja gerade so, als wenn ihr schon am Verhungern seid! Oder als gäbe es sonst nie etwas Gutes bei uns!“ erwiderte Chan etwas verwundert.
„Wie kommst du denn darauf?“ protestierte Jie. „Ich habe doch extra betont, daß es uns heute w i e d e r gut geht! Also wie immer!“
„Na, dann ist ja gut. Das wollte ich wohl auch meinen. Ihr habt wirklich keinen Grund zum Klagen.“
„Es klagt doch auch niemand!“ ereiferte Jie sich nochmal. . . . „Hast du heute irgendwie einen schlechten Tag?“
„Nein! Wieso?“
„Na, wie kann man denn unsere Freude über das leckere Essen so mißverstehen?“
„Hmm . . . Vielleicht ist meine Wahrnehmung tatsächlich noch etwas gestört, . . .“
„Vielleicht stimmt was mit deinem G e f ü h l nicht?!“ amüsierte sich Jie. Und alle mußten lachen, denn es war ja klar, daß er damit mal wieder auf Loriot anspielte. Auch Chan mußte herzlich lachen.
„Ja“, sagte sie dann, nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, „ich habe gerade noch sagen wollen, daß ich heute einen ziemlich anstrengenden Tag hatte und eigentlich geistig immer noch bei meiner Arbeit bin. Daher habe ich offenbar nicht genau genug hingehört, was ihr gesagt habt. Aber von jetzt an bin ich wieder bei der Sache! . . . Wie war’s denn heute bei euch in der Schule?“
„Wir haben heute einen neuen Mitschüler bekommen“, sagte Jiao. „Ein Daniel. Der stammt aus Hannover“.
„So, sind die jetzt mitten im Schuljahr hierher gezogen?“ fragte Qiang.
„Ja, warum denn nicht?“ entgegnete Chan. „Das Schulsystem ist doch überall gleich. Also spielt es doch gar keine Rolle, wann man die Schule wechselt.“
„Ja, ja. Aber ich denke, die Schulen und sogar jeder einzelne Lehrer haben da gewisse Freiheitsgrade in der Unterrichtsgestaltung.“
„Das ist richtig, ja. Aber eben nur in einem bestimmten Rahmen – das heißt, so gravierend sind die Unterschiede nicht, als daß sich nicht jeder Schüler ziemlich schnell reinfinden könnte.“
„Also heute, an seinem ersten Tag, hat er noch keine Probleme gehabt“, bestätigte Jiao. „Ich habe mich nach dem Unterricht mal eine Weile mit ihm unterhalten, und da hat er mir erzählt, daß das hier alles sehr ähnlich läuft wie in Hannover.“
„Das will ich meinen! Das war ja der Sinn der europäischen Schulreform, wie mir Ellen Eppelmann erzählt hat“, betonte Chan.
„Und? Wie ist der Typ so?“ fragte Long.
„Och, der macht einen ganz netten Eindruck“, sagte Jiao. „Er ist sehr gesprächig, hat ´ne Menge zu erzählen und ganz passable Ansichten. Man kann sich wirklich gut mit ihm unterhalten. . . . Er hat mir übrigens auch schon ein Kompliment gemacht.“
„Hört! Hört!“ raunte Long.
„Na, nicht was du denkst!“ ereiferte sich Jiao.
„Und? Was dann?“
„Er zeigte sich erstaunt, daß ich als Chinesin so eine gute Aussprache des Deutschen habe, und vor allem, daß ich so gut Hochdeutsch spreche, obwohl ich hier in Schwaben lebe. Mit dem Schwäbischen hat er nämlich ein kleines Problem – da versteht er so manches nicht. In Hannover sprechen sie ja hochdeutsch, und der schwäbische Dialekt ist ihm völlig fremd. . . . Ich fand das so nett, als er sagte, er könne sich hier offenbar mit einer Chinesin besser unterhalten als mit seinen eigenen Landsleuten.“
Allgemeines Schmunzeln.
„Und . . . ja, genau! Und er war noch viel mehr erstaunt, daß ich das ‚r‘ so gut ausspreche. Er meinte, Chinesen könnten doch eigentlich überhaupt kein ‚r‘ aussprechen. Wieso können wir es dann?“
„Und? Was hast du ihm geantwortet?“ wollte Jie wissen.
„Das war jetzt eine Frage an euch“, und dabei schaute sie auf ihre Eltern. „Ich weiß es doch selbst nicht.“
Qiang und Chan schauten sich an. Und als Chan den fragenden Gesichtsausdruck von Qiang bemerkte, begann sie selbst mit einem Erklärungsversuch: „Richtig ist, daß es im Chinesischen keinen ‚r‘-Laut gibt. Chinesische Kinder hören also von klein auf nie diesen Laut und können ihn somit auch nicht lernen. Umgekehrt können Europäer beispielsweise Wörter nicht mehr nach ihrer Tonhöhe unterscheiden, beziehungsweise messen sie unterschiedlichen Tonhöhen keine eigene Bedeutung zu. Man muß dazu wissen, daß die Sprachfähigkeit des Menschen zwar von der Anlage her ein immenses Potential bietet. Was auch notwendig ist, damit ein neu geborener Mensch sich auf völlig unterschiedliche Gegebenheiten einstellen und die Laute seiner jeweiligen Muttersprache unterscheiden kann. Aber das Gehirn des Kindes spezialisiert sich dann in der Wachstumsphase auf das Gehörte und erkennt schließlich nur noch Laute der eigenen Sprache. Ein Chinese kann dann eben beispielsweise keinen Unterschied zwischen ‚r‘ und ‚l‘ mehr hören. Es sei denn, er wächst zweisprachig auf, so wie ihr. Euch haben wir ja gleich von Anfang an in Chinesisch und in Englisch angesprochen. Deshalb könnt ihr auch das ‚r‘ verstehen und aussprechen.“
„Aber man kann doch auch in späterem Alter noch Fremdsprachen lernen“, wandte Jiao ein.
„Das kann man schon. Aber es ist dann schwerer und nie ganz perfekt. Ein Einheimischer wird dann immer heraushören, daß der Betreffende kein native speaker ist. Und bestimmte sprachliche Charakteristika, die dem Betreffenden völlig fremdartig sind, die wird er wohl kaum jemals beherrschen.“
„Wie kommt das?“
„Ja, wie schon gesagt: Babys beginnen bereits sehr früh, nämlich schon im Alter von wenigen Monaten, Sprache zu analysieren – also lange bevor sie selbst zu sprechen beginnen. Wichtig ist dabei der Kontakt zu den Eltern, denn die stellen sich auf ihr Kind ein, wenn sie es ansprechen, suchen Augenkontakt und erregen dessen Aufmerksamkeit. Babys nehmen die Mimik ihrer Eltern, die Lippenbewegungen, die Aussprache und die Satzmelodie wahr. Daraus können sie bereits ab einem Alter von vier Monaten wichtige Informationen ziehen, die sie fortlaufend vervollständigen. Selbst aus unvollständigen oder fehlerhaften Äußerungen ihrer Eltern filtern sich Kleinkinder immer noch die nötigen Informationen, um daraus Regeln zu bilden, die sie dann kreativ anwenden. Kreativ soll heißen: Sie bilden sogar Sätze, die sie nie zuvor gehört haben – und zwar erstaunlich korrekte. Und intuitiv, das heißt, ohne daß sie es explizit gelernt hätten, werden sie bestimmte Fehler nie machen. Zum Beispiel: ‚Trinken Tee ich’ – so etwas würde ein deutscher Dreijähriger niemals sagen. Denn die Satzstellung ist eine der ersten Regeln, die ein Kind intuitiv lernt.“
„Eigentlich erstaunlich“, bemerkte Jiao. „Da denkt man immer, die Kleinen kriegen die Gespräche der Erwachsenen sowieso noch nicht mit, dabei analysieren die bereits alles und plappern es dann irgendwann mit ihren eigenen Worten nach. Darüber habe ich mich eigentlich schon immer ein bißchen gewundert.“
„Ja, auch den Inhalt des Gesprochenen erfassen die Kleinen schon recht früh erstaunlich gut“, bestätigte Chan. „Sie haben eine phänomenale Auffassungsgabe in dem Alter. In dieser frühen Phase können sie auch leicht zur Mehrsprachigkeit herangebildet werden. Sie erkennen unwillkürlich, wenn die Eltern von einer Sprache in eine andere wechseln – auch wenn sie nur die Lippenbewegungen sehen. Allerdings nur für eine bestimmte Zeit, etwa acht Monate. Danach können sich nur Kinder, die in zweisprachigen Elternhäusern aufwachsen, diese Fähigkeit erhalten. Und wenn man sich erst nach dem sechsten Lebensjahr eine neue Sprache aneignen möchte, dann müssen alle Worte und alle Regeln und natürlich auch die Aussprache mühsam gelernt werden.“
„Die Kleinen, wie du sagst“, bemerkte Qiang, „erfassen nicht nur den Inhalt des Gesprochenen, sondern auch die Körpersprache, die Mimik und damit die Emotionen anderer, also etwa deren Freude und Schmerz, Wohlbehagen und Angst. Etwa ab ihrem zweiten Lebensjahr beginnen sie, diese Emotionen zu deuten. Ist doch erstaunlich, nicht?“
„Das ist wirklich erstaunlich, ja“, bestätigte Chan. „Aber diese Fähigkeit ist für alle Mitglieder einer sozial höher entwickelten Gemeinschaft eine unabdingbare Voraussetzung fürs Überleben, weil diese Körpersprache sehr viel über das Gefühlsleben des Gegenübers verrät. Ein typischer Gesichtsausdruck für Angst signalisiert uns beispielsweise blitzartig und ganz ohne Worte, daß wahrscheinlich Gefahr im Verzuge ist, und ermöglicht eine schnelle Reaktion. Das Einfühlungsvermögen in die Gefühlswelt der anderen, unsere Empathie, befähigt uns vor allem auch dazu, emotionale Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Das ist kolossal wichtig für das Leben in der Gruppe, für deren Zusammenhalt schon unsere frühen Vorfahren gelernt haben, ständig ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten untereinander abzugleichen. Je stärker das Miteinander im sozialen Verband, desto geschlossener und erfolgreicher agiert die Gruppe gegenüber Konkurrenten. Evolutionsbiologen vertreten daher die Auffassung, daß sich die Empathie-Fähigkeit schon vor Jahrmillionen bei den in Gruppen lebenden, höher entwickelten Säugetieren mit der Entstehung von Spiegelneuronen herausgebildet hat, und daß diese Fähigkeit dann im Laufe der Evolution zum Vorteil der jeweiligen Spezies weiter vervollkommnet wurde.“
„Apropos Evolution. Wie weit seid ihr eigentlich inzwischen mit eurer Simulation?“ fragte Qiang seine Frau.
„Wieso Simulation? Was hat das denn mit der Evolution zu tun?“ wollte Long wissen.
„Ach, hast du das noch gar nicht mitgekriegt?“ fragte Qiang erstaunt. „Die haben doch an der Uni ein Riesenprogramm laufen, mit dem sie die Evolution per Simulation nachbilden wollen.“
Long guckte mit großen Augen erst seinen Vater und dann seine Mutter, die ihm bestätigend zunickte, an. „Was? Wie soll das denn funktionieren?“ fragte er ungläubig.
„Naja, einfach ist diese Aufgabe natürlich nicht“, versuchte Chan zu erklären. „Aber unmöglich scheint sie auch nicht. Wir wissen ja inzwischen sehr viel über die erdgeschichtliche Entwicklung, über Entstehen und Werden von Leben. Wir wissen jedoch noch längst nicht alles. Und insbesondere gibt es immer noch Ungewißheit hinsichtlich einer ganz essentiellen Fragestellung, nämlich: Sind wir Menschen ein Produkt der Evolution, also ein eher zufälliges Ergebnis von Versuch und Irrtum? Einer Entwicklung fortgesetzter Anpassungsversuche an die jeweiligen Gegebenheiten, bei der sich jeweils nur die Anpassungsfähigsten und Stärksten durchgesetzt und ihre Fähigkeiten weitervererbt haben? Oder bedurfte es einer höheren Intelligenz, die die ganze Entstehung der Welt und die Entwicklung auf der Erde vom Einzeller bis zum intelligenten Menschen zielgerichtet gesteuert hat? Das ist ja nach wie vor die grundlegende Streitfrage.“
„Wenn es nach den Kreationisten ginge, dann wäre die Frage ja schon ganz einfach beantwortet!“ bemerkte Long grinsend.
„Nach denen geht es aber nicht!“ entgegnete Jiao sehr resolut. „Diese fundamental bibeltreuen Christen nehmen die alttestamentarischen Schöpfungsmythen viel zu wörtlich und vertreten allen Ernstes die Überzeugung, Gott habe die Welt und den Menschen vor 6.000 Jahren in echten sechs Tagen erschaffen und Eva aus der Rippe von Adam geformt. So ein Quatsch! Daß die Erde schon mindestens 4,5 Milliarden Jahre alt ist, das ist doch wissenschaftlich längst nachgewiesen!“
„Ich weiß schon, Schwesterchen! Aber versuch‘ mal, einem Kreationisten das zu erklären. Das kannst du glatt vergessen! Denn mit den Kreationisten kann man nicht diskutieren. Die verfolgen einen missionarischen Auftrag. Und wer sich, wie die, seiner Gläubigkeit so sicher ist, der braucht keine Argumente.“
„Das ist zweifellos richtig, großer Bruder. Mich erstaunt nur, daß so viele Menschen trotz unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse diesem Irrglauben verfallen sind. Vor allem viele Amerikaner negieren die Ansicht, der Mensch könne sich aus einer niedrigeren Form des Lebens entwickelt haben. Ich hab‘ mal gelesen, daß in den USA rund 68 Prozent der Republikaner und rund 40 Prozent der unabhängigen Wähler und der Demokraten nicht an die Evolutionstheorie glauben!“
„Ja, die Kreationisten haben vor allem in den USA sehr an Einfluß gewonnen“, bestätigte Qiang. „Sie forderten sogar die Verankerung der Schöpfungsgeschichte im Schulunterricht – und zwar im Fach Biologie! Denn Religionsunterricht in den Schulen ist dort verboten. Religiöse Lehren an staatlichen Schulen wurden von US-Gerichten mehrfach untersagt, weil Staat und Religion in den USA streng voneinander getrennt sind. Daher konnten sie sich mit dieser Forderung nicht durchsetzen, was sie aber nicht davon abhielt, weitere Versuche ‚über Umwege‘ zu unternehmen. So wurde der Kreationismus von seinen Anhängern vor allem aus juristischen Gründen in ‚Intelligent Design‘ umbenannt. Sie versuchten, ihrem Glauben einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Man sprach nicht mehr von Gott, sondern von einem höheren Wesen oder einer höheren Intelligenz hinter den Dingen. Die Welt und das Leben auf der Erde sei das Werk eines intelligenten Planers. Das tatsächliche Alter der Erde wurde nicht mehr bestritten. Aber das Leben auf dieser Welt sei viel zu komplex, als daß es durch Zufall entstanden sein könnte. Evolution könne nur kleine Veränderungen bewirken, größere müßten gesteuert sein – eben durch einen intelligenten Designer. Diese Theorie der Schöpfung versuchten ultra-konservative US-Politiker dann zumindest als gleichberechtigt zur Evolutionstheorie in den Unterricht einzubringen. Und siehe da: Der US-Präsident George W. Bush ließ im Sommer 2005 dazu verlauten: ‚Wenn Sie mich fragen, ob die Menschen mit den verschiedenen Ideen konfrontiert werden müssen, lautet die Antwort: Ja‘.“
„Intelligent Design – da haben die sich ja was Feines ausgedacht, nachdem sie ihre Idee vom Kreationismus nicht mehr aufrechterhalten konnten!“ räsonierte Jiao. „Also mir will das immer noch nicht in den Kopf, was manche Menschen so alles glauben.“
„Nicht nur manche, so viele Menschen sogar!“ meldete sich Jie zu Wort. „Du hast doch selber gerade ein paar Prozentzahlen für die USA genannt. Und Gläubige gibt es doch auf der ganzen Welt!“
„So ist es, ja“, sagte Qiang. „Das heißt zwar nicht, daß die deswegen recht haben. Aber solange keine Theorie eindeutig belegt werden kann, ist es eben immer noch eine Frage des Glaubens, der persönlichen Ansicht, welcher Meinung man eher zuneigt – eben weil keine Seite den Beweis für ihre These erbringen kann.“
„Aber Darwin hat doch eine ganze Reihe von Belegen für die Richtigkeit seiner weithin anerkannten Evolutionsthese gegeben“, wandte Long ein.
„Schon richtig“, bestätigte Qiang. „Aber dennoch gibt es auch viele Zweifler, die sich dieser These nicht anschließen können. Und diese Zweifel werden insbesondere immer an solchen Dingen festgemacht, wo die Evolutionstheorie so bedeutende Entwicklungsschritte wie zum Beispiel das Entstehen menschlicher Intelligenz mit dem Zufallsprinzip zu erklären versucht. Viele Tiere haben sich ja auch fortgesetzt angepaßt und überlebt, obwohl sie nicht über diese Intelligenz verfügen. Wieso also entstand sie trotzdem und gerade bei den menschlichen Vorfahren? Steckt dahinter eine zielgerichtete Entwicklung, oder war das alles nur Zufall? Solange es auf solche Fragen keine überzeugenden Antworten gibt, wird jeder bei seinem Glauben bleiben, wie auch immer er dazu gekommen ist.“
„Verständlich“, pflichtete Jiao bei.
„Wenn da im Laufe der Evolution plötzlich etwas ganz Neues entsteht“, ergänzte Chan, „etwas fundamental und kategorial Neues, was es vorher nicht gegeben hat, dann sprechen die Biologen von ‚Emergenz‘ oder ‚Fulguration‘. Dazu zählen beispielsweise die Entstehung der Materie, die Entstehung des Lebens und die Entstehung des Bewußtseins. Sie waren auf einmal da, und niemand kann bis heute erklären, wie es dazu kam. Auch die Wissenschaft nicht.“
„Aber trotzdem“, insistierte Jiao wieder. „Umgekehrt muß man sich doch auch fragen, wo denn der angebliche Designer eigentlich hergekommen sein soll? Aus dem Nichts? Und wenn es denn überhaupt je einen gegeben haben sollte, wo ist er jetzt? Ist der nach vollbrachter Tat einfach verschwunden – nach dem Urknall in Rente gegangen?“
„Berechtigte Fragen, die dir leider niemand beantworten kann“, konstatierte Chan.
„Oder anders ausgedrückt: Es gibt viele Erklärungsversuche, aber keiner davon läßt sich beweisen“, entgegnete Qiang. „Wir wissen zum Beispiel, daß das Universum ganz bestimmte Bedingungen hinsichtlich der physikalischen Gesetze und Naturkonstanten erfüllen mußte, damit es Leben, wie wir es kennen, nämlich Leben auf Kohlenstoff-Basis, überhaupt hervorbringen konnte. War es Zufall, daß diese Bedingungen für Leben einst erfüllt waren und immer noch sind? Oder war es geplant und zielgerichtet durch den großen Unbekannten?“
„Was waren das denn für Bedingungen?“ wollte Long wissen.
Qiang erläuterte: „Man spricht in der Kosmologie von der ‚Feinabstimmung‘ des Universums und meint damit die unglaublich präzise aufeinander abgestimmten Naturkonstanten und physikalischen Wechselwirkungen als notwendige Voraussetzung dafür, daß die Entstehung von komplexen Systemen wie beispielsweise Galaxien, Sonnensystemen oder menschlichen Wesen überhaupt erst möglich wurde. Bereits winzige Veränderungen an diesen fein austarierten Verhältnissen hätten ausgereicht, das Universum in der Form gar nicht erst entstehen zu lassen. Alles – vom genauen Energiezustand des Elektrons bis hin zur Ausprägung der schwachen Wechselwirkung – scheint maßgeschneidert, um unsere Existenz zuzulassen.“
„Du meinst, da hat jemand maßgeschneidert? Der Intelligent Designer?“ fragte Long.
„Das habe ich damit nicht gesagt.“
„Dann war es also ein Zufall? Ein einmaliger Glücksfall für uns, daß uns die Natur diesen Gefallen getan hat?!“
„Zufall oder Absicht – ich kann dir diese Frage leider nicht schlüssig beantworten. Niemand kann das! Obwohl sich viele daran versuchen. Vielleicht zitiere ich einfach mal beispielhaft den US-Professor Max Tegmark von der University of California at Berkeley:
‚Es gibt zwei mögliche Erklärungen: Entweder wurde das Universum von einem Schöpfer speziell für uns entworfen. Oder es gibt eine große Anzahl von Universen, jedes mit unterschiedlichen Werten der fundamentalen Konstanten, und wir befinden uns, was kaum überrascht, in einem Universum, in dem die Konstanten genau den richtigen Wert haben, um Galaxien, Sterne und Leben zuzulassen.‘
Er bringt hier also sogar noch das sogenannte Multiversum ins Spiel. Aber darauf möchte ich mich jetzt gar nicht weiter einlassen, denn das ist alles Spekulation. Es ist uns als Bestandteil dieses Universums unmöglich, und zwar ganz prinzipiell, über diese Systemgrenzen hinauszuschauen. Aber selbst innerhalb unseres Systems sind ja noch so viele Fragen offen.
Tatsache ist jedenfalls, wie schon gesagt, daß für die Entstehung unseres Systems ganz bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten geherrscht haben müssen, andernfalls existierten wir nicht.“
„Und das sind welche?“ fragte Long.
„Nun, da ist zum einen die Feinabstimmung der fundamentalen Konstanten des Universums, der sogenannten Naturkonstanten, die nach den gegenwärtigen physikalischen Theorien zur Beschreibung des beobachtbaren Universums in ihren Größen genau so dimensioniert sind, daß sich alles in der Weise entwickeln konnte, wie wir es kennen. Dazu gehören zum Beispiel die elektrische Elementarladung, die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit, die Ruhemassen von Elektron und Proton sowie das Massenverhältnis zwischen beiden, die verschiedenen Feinstrukturkonstanten und andere mehr.
Dann haben wir die Feinabstimmung der Expansionsrate – das ist das Verhältnis zwischen der auseinandertreibenden Kraft des Big-Bang und der Gravitationskraft: Die Expansion nach dem Urknall durfte einerseits nicht so schwach sein, daß das Universum nach wenigen Jahrmillionen wieder kollabierte, andererseits aber nicht so stark, daß die Entstehung von Sonnen und Galaxien verhindert worden wäre. Wenn die Gravitation am Beginn des Universums auch nur um einen Billionstel-Betrag vom tatsächlichen Wert abgewichen wäre, dann hätte dieses eine gänzlich andere Gestalt und vermutlich kein Leben hervorbringen können. Oder betrachten wir die Feinabstimmung der elektromagnetischen und der starken Wechselwirkung: Berechnungen zeigen, daß eine Änderung ihres Wertes um lediglich ein Prozent schon zu so gewaltigen Änderungen der physischen Welt führen würde, daß darin kein intelligentes Leben mehr möglich wäre und auch gar nicht erst hätte entstehen können. Ähnliches gilt für die Feinabstimmung der Sommerfeld‘schen Feinstrukturkonstante, die ein Maß für die elektromagnetische Wechselwirkung ist, und des Massenverhältnisses von Elektron zu Proton.“
„Was genau meinst du mit Wechselwirkungen?“ wollte Jie wissen.
„Das sind Kräfte, die zwischen den Elementen beziehungsweise Materieteilchen wirken. Das kosmologische Standardmodell kennt vier elementare Kräfte oder Wechselwirkungen: Die elektromagnetische Kraft, die Starke und die Schwache Kraft sowie die Gravitation.“
„Die du uns sicher gleich noch erklären wirst?!“
„Natürlich. Die elektromagnetische Kraft wird durch die elektrische Ladung eines Teilchens verursacht. Sie ist ursächlich für den elektrischen Strom, hält sämtliche Kristalle zusammen und spielt bei allen chemischen und biochemischen Prozessen die führende Rolle.
Die Starke Kraft wirkt zwischen den Quarks – das sind neben den Leptonen die kleinsten Elementarteilchen – und wird mit zunehmendem Abstand größer. Man kann sich das vorstellen wie ein Expander: Je weiter man zwei Quarks auseinanderzieht, desto mehr spannt sich das Gummi zwischen ihnen, und desto stärker hat man zu ziehen. Dieser Effekt ist so stark, daß das Band zwischen zwei Quarks nicht ohne weiteres reißen kann. Deshalb kommen Quarks nie alleine vor, sondern nur in Quark-Antiquark-Pärchen oder als ‚Dreigestirn‘.
Die Schwache Kraft wirkt zwischen allen Materieteilchen. Sie löst radioaktive Zerfälle aus, indem sie bestimmte Elementarteilchen in andere verwandelt, etwa ein Down-Quark in ein Up-Quark plus ein Elektron plus ein Neutrino. Durch diese Teilchenumwandlung kommt der Zerfall von Atomkernen in Gang. Die Neutrinos können nur über die Schwache Kraft mit ihrer Umgebung wechselwirken.
Und schließlich die Gravitation, die wohlvertraute Schwerkraft: Sie spielt im Mikrokosmos praktisch keine Rolle. Und im Vergleich zu den anderen Naturkräften ist sie extrem schwach.“
„Aha! Verstehe!“ gab sich Jie zufrieden mit der Antwort.
„Man hat auch die Raum-Zeit-Dimensionen untersucht. Für uns ist es ja ganz selbstverständlich, daß wir drei Dimensionen für den Raum und eine für die Zeit haben. Mathematisch betrachtet könnte ein Universum aber beliebig viele Dimensionen haben. Zwei Raumdimensionen reichen jedoch nicht aus, um komplexe Strukturen wie etwa unsere Körper darzustellen. Bei einem Universum mit mehr als drei räumlichen Dimensionen hingegen sind sowohl Atome als auch Planetenbahnen instabil. Und bei einer von eins verschiedenen Zeitdimension ist keine Vorhersagbarkeit möglich.
Auch die uns so selbstverständlich erscheinende Tatsache, daß das Universum mit seinen Galaxien und Sonnensystemen sowie allem Leben darin Materie enthält, ist wohl nur dem Auftreten bestimmter Anomalien beim Urknall zuzuschreiben. Denn eigentlich dürfte all diese Materie überhaupt nicht existieren: Den Theorien der Kosmologen zufolge sollte sich nämlich die Energie beim Urknall gleichförmig in Materie und Antimaterie umgeformt haben. Und da Materie- und Antimaterie-Teilchen genau entgegengesetzte Ladungen haben, hätten sie sich in der kosmischen Ursuppe gegenseitig vernichten müssen, bis kein Rest mehr von ihnen übriggeblieben wäre. Überdauert hätte ein Universum voller Licht, aber ohne Sterne, ohne Planeten und ohne Menschen. Weil dieses Szenario so nicht eingetreten ist, muß sich in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall logischerweise ein kleiner Materieüberschuß gebildet haben. Dieses überzählige Milliardstel der Materie verdichtete sich später zu den Gestirnen. Wie das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie zustande kam, weiß bislang niemand genau.
Angesichts der bisher gewonnenen Erkenntnisse, daß sowohl die Kräfteverhältnisse als auch die Eigenschaften der Materieteilchen und das Auftreten bestimmter Anomalien alle ganz genau so dimensioniert sind, um unser Universum und Leben hervorzubringen, das veranlaßt viele Menschen, insbesondere die Verfechter der Hypothese des Intelligent Design, an einen Schöpfer zu glauben.“
Die Kinder schauten schon etwas müde drein, deshalb fragte Qiang sie: „Wollt ihr noch etwas weiter hören oder lieber ins Bett gehen?“
„Nein! Noch nicht ins Bett! Wir müssen ja nochmal auf unsere Anfangsfrage zurückkommen.“
„Die Anfangsfrage, ja“, wiederholte Qiang. . . . „Hmm, haben wir die nicht schon eigentlich abgehandelt?“
„Nö, nö! Wir sind irgendwann mal vom Thema abgekommen.“
„Na gut! Aber vorher möchte ich noch kurz auf das Thema Kohlenstoff eingehen, daß in diesem Kontext auch sehr wichtig ist. Denn dem Kohlenstoffatom, das mit seiner reichen Kombinationsfähigkeit vier stabile Verbindungen mit sich selbst oder mit anderen Elementen, hauptsächlich mit Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, eingehen kann, verdanken wir die Bildung von Polipeptidketten, die zu Eiweißen gefaltet werden, aus denen unser Körper besteht. Bekanntlich hat ja der Kohlenstoff am Trockengewicht des menschlichen Organismus‘ einen sehr hohen Anteil von 61,7 Prozent. Der Anteil von Sauerstoff beträgt dagegen lediglich 9,3 Prozent. Der Kohlenstoff bildet also vor allem die Grundlage für die Entstehung von Leben auf der Erde. Aber wo kommt der viele Kohlenstoff her? Am Anfang des Universums gab es doch nur Helium und Wasserstoff. Dazu hat man die kosmologische Feinabstimmung bei der Entstehung von Kohlenstoff und Sauerstoff in Roten Riesen untersucht und den Zusammenhang der Kernenergie-Niveaus von Helium-4 und Beryllium-8 mit dem Ausmaß und der Geschwindigkeit der Nukleosynthese von Kohlenstoff-12 erkannt: Im sogenannten Tripel-Alphaprozeß verbinden sich zunächst Helium-4 plus Helium-4 zu Beryllium-8. Das hat allerdings nur eine sehr kurze Halbwertszeit von 6,7 x 10-17 Sekunden. Innerhalb dieser kurzen Zeit muß noch ein drittes Helium-4-Teilchen hinzustoßen, damit Kohlenstoff-12 entsteht. Und das passierte in Roten Riesen offenbar sehr häufig, andernfalls gäbe es nicht so viel Kohlenstoff.“
„Borrr! 10-17 Sekunden, das ist ja nur ein Hundertstel Billiardstel einer Sekunde!“
„Ja, das ist verdammt kurz! Und trotzdem lang genug, daß sogar noch ein viertes Helium-4-Teilchen hinzustoßen kann, wodurch Sauerstoff-16 entsteht. Nun kann man sich fragen, warum so viel mehr Kohlenstoff als Sauerstoff entstanden ist. Und das hängt mit den unterschiedlichen Energieniveaus der Elemente zusammen, die für die Kohlenstoffverbindung gewissermaßen eine Resonanz bilden und daher diese gegenüber der Sauerstoffverbindung bevorzugt. Man spricht daher auch von einer ‚Beryllium-Barriere‘.“
„Dann haben wir es also, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen in irrwitzig engen Grenzen ablaufenden Prozessen zu verdanken, daß wir überhaupt existieren?“ fragte Long erstaunt.
„Diesen und allen anderen kosmologischen Feinabstimmungen, ja. Daher muß es nicht verwundern, daß es Menschen gibt, die sich das Geschehen nicht anders als durch eine höhere intelligente Instanz gesteuert vorstellen können. Sie gehen dabei ganz selbstverständlich davon aus, daß alles extra so ‚gemacht‘ worden ist, damit der Mensch als Ziel der Schöpfung entsteht. Nehmen wir beispielsweise die Äußerung von J. Gribbin und M. Rees in ihrem Buch Ein Universum nach Maß. Bedingungen unserer Existenz:
‚Die Kombination dieser Zufälle, die für Kohlenstoff-12 die genau richtige Resonanz ergeben und für Sauerstoff-16 die genau falsche, ist in der Tat bemerkenswert. Es gibt keine bessere Bestätigung für die Behauptung, daß das Weltall zu unserem Wohl gemacht ist – dem Menschen auf den Leib geschneidert.‘
Oder nehmen wir den Ausspruch von Freeman J. Dyson:
‚Wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohle zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne gewußt, daß wir kommen.‘
Seit Kopernikus und Galilei wissen wir, daß unsere Erde und wir Menschen eben nicht den Mittelpunkt der Welt bilden, sondern daß wir nur einen ganz marginal kleinen Punkt irgendwo im riesigen Universum darstellen. Angesichts solcher Zitate aber muß man fast den Eindruck gewinnen, daß letztlich doch die Menschheit eine besondere Stellung im Universum einnehme, weil eben alle kosmischen Parameter auf menschliches Leben ausgerichtet zu sein scheinen. Es kommt mir ein bißchen so vor wie die Rückkehr zum vorkopernikanischen geozentrischen Weltbild.“
„Empfändest du das als anmaßend? Und könnte es nicht vielmehr so sein, daß die Leute von den vielen Zufällen ganz einfach nur beeindruckt sind und ihrem Eindruck auf diese Weise Ausdruck verleihen?“ gab Jiao zu bedenken.
„Sicher! Ich will ja auch gar nicht in Abrede stellen, daß sich da eine vielleicht ziemlich singuläre Konstellation eingestellt hat. Für mich stellt sich eher die Frage der Interpretation dieser Gegebenheiten: Schaue ich jetzt nur von der menschlichen Existenz ausgehend, dem Anthropischen Prinzip folgend auf die Entstehung des Universums zurück, oder lasse ich es zu, daß sich im Universum möglicherweise auch ganz andere Konstellationen mit vielleicht anderen Lebensformen gebildet haben können.“
„Was bedeutet das Anthropische Prinzip?“
„Gleich. Ich will nur eben noch ein Beispiel zu der anthropischen Argumentation zitieren, das ich mal in einem Vortragsmanuskript von Professor Peter Hägele von der Universität Ulm gefunden habe:
‚Auf der Erde gibt es eine Lebensform mit Bewußtsein, eine beobachtende Intelligenz. Wie muß das dazu gehörige Universum aussehen? Diese Frage kann nicht beantwortet werden ohne die folgenden logischen Schritte:
Bewußtsein setzt voraus, daß es Leben gibt;
Leben braucht als Grundlage seines Entstehens chemische Elemente, vor allem auch solche, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium;
Schwere Elemente entstehen aber nur durch thermonukleare Verbrennung der leichten Elemente, also durch Atomkernverschmelzung;
Atomkernverschmelzungen laufen jedoch nur im Innern der Sterne ab und benötigen wenigstens einige Milliarden Jahre, um größere Mengen an schweren Elementen zu produzieren;
Eine Zeitspanne von mehreren Milliarden Jahren steht aber nur in einem Universum zur Verfügung, das selbst wenigstens einige Milliarden Jahre alt und damit einige Milliarden Lichtjahre ausgedehnt ist. [. . . ]
In späteren kosmischen Epochen würden andererseits kaum mehr sonnenähnliche Sterne existieren, sondern hauptsächlich nur mehr energieschwache Weiße Zwerge, die eine planetare, langsam biologisch evolvierende Lebensform nicht mit ausreichender Energie versorgen könnten.
Daher kann die Antwort auf die Frage, warum das heute von uns beobachtete Universum so alt und so groß ist, nur lauten: Weil sonst die Menschheit gar nicht hier wäre.‘
So, jetzt aber zu deiner Frage: Anthropos bedeutet im Griechischen ‚Mensch‘, und dieses auf den Menschen bezogene Prinzip besagt, daß das beobachtbare Universum für die Entwicklung intelligenten Lebens geeignet sein muß, da wir andernfalls nicht hier sein, es beobachten und physikalisch beschreiben könnten. Das klingt eigentlich ziemlich banal, hat aber zu heftigen Diskussionen in der Wissenschaftswelt angeregt. So schrieben beispielsweise John Barrow und Frank Tipler in ihrem Buch The Anthropic Cosmological Principle:
‚Nicht nur, daß der Mensch in das Universum hineinpaßt. Das Universum paßt auch zum Menschen. Man stelle sich ein Universum vor, in dem sich irgendeine der grundlegenden dimensionslosen physikalischen Konstanten in die eine oder andere Richtung um wenige Prozent verändern würde? In einem solchen Universum hätte der Mensch nie ins Dasein kommen können. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Anthropischen Prinzips. Gemäß diesem Prinzip liegt dem gesamten Mechanismus und dem Aufbau der Welt ein die Existenz von Leben ermöglichender Faktor zugrunde.‘
In den folgenden Auseinandersetzungen, insbesondere auch wegen der mehrdeutigen Definition, haben sich dann verschiedene Versionen dieses Prinzips herausgebildet, als da sind: Das Schwache Anthropische Prinzip: Das physikalische Universum, das wir beobachten, hat eine Struktur, welche die Existenz von uns als Beobachtern zuläßt;
das Starke Anthropische Prinzip: Das Universum muß in seinen Gesetzen und in seinem speziellen Aufbau so beschaffen sein, daß es irgendwann unweigerlich einen Beobachter hervorbringt;
und das Finale Anthropische Prinzip: Im Universum muß intelligentes, informationsverarbeitendes Leben entstehen, evolvieren und für immer existieren.
Es gibt aber nicht nur unterschiedliche Deutungen des anthropischen Prinzips, sondern auch unterschiedliche Formulierungen. Deshalb will ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Vielleicht nur so viel: Es gibt beispielsweise teleologische und nichtteleologische Interpretationen, welche eine geradezu entgegengesetzte Intention aufweisen.“
„Was heißt das?“
„Die Teleologie ist eine Lehre, die besagt, daß die Entwicklung der Natur zweckmäßig und zielgerichtet ist.“
„Aha!“
„Auch gibt es nicht nur die Universum-, sondern auch die Vielwelten-Theorie, die die Existenz von praktisch unendlich vielen Paralleluniversen postuliert. Und schließlich gibt es die Zufallshypothese für die Entstehung des Lebens und die Hypothese des Intelligent Design.“
„Genau! Und damit sind wir nach diesem langen Exkurs wieder bei unserem Ausgangspunkt angekommen“, resümierte Long.
„Aber schlauer sind wir deshalb auch nicht“, entgegnete Jie.
„Wenn du damit meinst, daß wir jetzt die richtige Antwort kennen, dann hast du recht, kleiner Bruder“, entgegnete Long. „Und nur dann! Denn zur Thematik ganz generell haben wir doch heute eine ganze Menge dazugelernt.“
„Na, das ist ja fein! Dann können wir ja für heute erst mal Schluß machen“, stellte Qiang zufrieden fest.
„Halt! Halt! Moment mal! Ihr wolltet uns doch eigentlich von der Simulation erzählen!“
Chan schaute ihren Mann an und sagte achselzuckend: „Wo sie recht haben, haben sie recht.“
„Ja, dann bist du wieder dran“, erwiderte er.
„Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind“, mußte Chan einräumen.
„Das kann ich dir ganz genau sagen“, reagierte Long am schnellsten. „Paps hat dich vorhin nach eurer Simulation der Evolution gefragt, die ihr an der Uni macht. Es ging um die Frage Urknall oder Schöpfung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber dann sind wir ganz schnell vom Thema abgekommen.“
„Ja, richtig. Ich erinnere mich. . . . Es geht in der Tat um die grundlegenden Fragen nach der Entstehung der Welt und der weiteren Entwicklung, der physikalisch/chemischen und der biologischen Evolution bis zum intelligenten Wesen, dem Menschen, auf die wir Antworten suchen.“
„Auf diese Fragen wollt ihr jetzt mit einer Simulation Antworten finden?“ zeigte sich Long ungläubig.
„Natürlich. Es ist ein Versuch, ja“, bekräftigte Chan. „Aber warum sollte man einen solchen Versuch nicht unternehmen? Es besteht immerhin die Chance, eine unserer größten Fragestellungen der Menschheit zu klären. Das ist doch aller Mühen wert.“
„Schon. Aber ist das Ganze nicht viel zu komplex, um es voll zu überblicken und richtig auf den Computer zu übertragen?“ wandte Long wieder ein.
„Selbstverständlich ist das ungeheuer komplex, aber wir arbeiten ja nicht allein an der Aufgabe. Die Wissenschaft ist schon lange weltweit vernetzt. Überall gibt es Experten-Teams, die sich mit diversen Teilaspekten beschäftigen und ihre Ergebnisse austauschen und zusammenführen – und das schon seit Jahrzehnten. Wir erheben im übrigen auch gar nicht den Anspruch, die ganze Welt von Anfang an in ihrer Komplexität zu modellieren. Vielmehr gehen wir schrittweise und abschnittsweise vor, das heißt, wir bauen nicht die ganze Evolutionskette am Stück auf, sondern wir modellieren und untersuchen jeweils einzelne Abschnitte.“
„Wie sind die Abschnitte denn aufgeteilt?“
„Der erste und vielleicht schwerste Abschnitt soll die Urknall-Theorie verifizieren, also die Zeit vom Big-Bang bis etwa 400.000 Jahre danach. Das ist genau der Zeitraum, über den wir bisher am wenigsten wissen.“
„Wenn man darüber nichts weiß, wie will man dann etwas verifizieren?“
„Das ist eine gute Frage. Diese Aufgabe ist in der Tat eine große Herausforderung für die Wissenschaft. . . . Nun, wie geht man vor in so einem Fall: Man geht von dem Entwicklungsstadium des Universums aus, über das man schon recht viel weiß, und rechnet von da aus rückwärts verschiedene Modelle bis zum postulierten Ursprung durch. Das ist nicht unmöglich, aber schwierig, weil man sehr viele Annahmen treffen muß, und weil es in diesem Anfangsstadium möglicherweise auch noch Zustände oder Reaktionsmuster, etwa die schon erwähnten Anomalien, gegeben haben könnte, die den uns bekannten physikalischen oder chemischen Gesetzmäßigkeiten nicht gehorchten.“
„Ohje! Das hört sich nach sehr viel Arbeit an! . . . und generiert vermutlich viel Frust!“
„Viel Arbeit – ja! Aber viel Frust – nein! Dinge zu erforschen, das ist das tägliche Brot, aber auch die Lust der Wissenschaftler. Sie suchen ihre Neugier zu befriedigen. Entstehen dabei neue Erkenntnisse, dann ist das die Krönung ihrer Arbeit. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, betrachten sie ihre Arbeit nicht als frustrierend oder erfolglos. Auch der Ausschluß einer der zahlreichen Hypothesen ist ein wichtiger Baustein im großen Puzzle der vielen noch offenen Fragen.“
„Okay! Akzeptiert!“
„Gut! Dann machen wir weiter: Der nächste Abschnitt betrifft die Entwicklung unseres Universums beginnend etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall bis zur Bildung der ersten Galaxien. Da wird also untersucht, wie die kosmischen Strukturen entstanden sind, wie sich die ersten Sterne aus dem Einerlei der kosmischen Ursuppe bildeten und sich anschließend die ersten Galaxien unter dem Einfluß der Schwerkraft formierten. Entsprechende Simulationen dazu laufen schon sehr lange, unter anderem in Garching. Da haben Wissenschaftler schon Anfang dieses Jahrtausends damit begonnen, auf einem der größten Superrechner diese Entwicklung zu simulieren. Allerdings bisher nur mit mäßigem Erfolg: Ihre theoretischen Modelle hatten beispielsweise sehr viele kleine Galaxien vorausgesagt, die jedoch in der Realität nicht beobachtet werden konnten. Wenn solche Diskrepanzen auftreten, was ganz normal ist, dann muß das Modell mit allen darin getroffenen Annahmen und astrophysikalischen Effekten von Grund auf überprüft und entsprechend korrigiert werden. Das braucht sehr viel Zeit. Dann beginnt ein neuer Durchlauf. Aber auch der muß nicht erfolgreich sein. Inzwischen hat man sehr viele neue Erkenntnisse dabei gewonnen. Aber es wird immer noch weiter daran gearbeitet, weil immer noch einige Fragen offen sind. Das betrifft insbesondere die kalte dunkle Materie. Diese Kraft ist so stark, daß sie das Licht im Weltall um die Ecke biegt und die Ansicht ganzer Galaxien verzerrt. Sie hält unsere Galaxien zusammen, ohne sie würden die Galaxien auseinanderdriften wie die Sitze eines Kettenkarussells. Aber woraus sie eigentlich besteht, darüber sind sich die Wissenschaftler immer noch nicht einig.“
„So lange forscht man schon danach und hat noch immer keine Lösung?“
„Daran könnt ihr ermessen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Allerdings darf man auch nicht vergessen, daß die Forschungsgelder leider nicht immer im notwendigen Maße fließen. Daher hat es immer mal wieder Unterbrechungen in den Arbeiten gegeben. Ihr kennt ja den Ausspruch: Ohne Moos nix los! Und wenn es Unterbrechungen gibt, dann wandern auch immer wieder einige Leute ab, was man ihnen nicht verdenken kann, was aber bei einem späteren Fortgang des Projekts zunächst mal Startschwierigkeiten verursacht.“
„Klar! Bei Mitarbeiterwechsel gibt’s natürlich Verzögerungen.“
„So ist es. . . . Gut, dann mache ich mal weiter: Ein anderer Simulationsabschnitt ist die schon angesprochene physikalisch/chemische Evolution von der Entstehung unserer Erde bis zur Entstehung ersten Lebens. Das war ja auch lange Zeit so ein Streitpunkt: Wie konnte aus toter Materie plötzlich Leben entstehen? Ich erwähnte ja vorhin schon, daß die Biologen in so einem Fall von Emergenz oder Fulguration sprechen, ihr erinnert euch sicher. Diese Arbeiten sind inzwischen sehr weit gediehen. Aber das ist nicht mein Thema.
Ich arbeite in meinem interdisziplinär besetzen Team an der biologischen Evolution. Dabei beschäftigen wir uns speziell mit der Entstehung von Intelligenz – beziehungsweise, um korrekt zu sein, mit dem starken Anstieg der Intelligenzleistung beim Homo Sapiens –, weil diese Frage die Menschheit am meisten bewegt und weil genau dort die größten Zweifel an der Evolutionstheorie ansetzen.“
„Und wie soll das gehen?“ fragte Jiao. „Ich meine, wie muß ich mir das vorstellen mit eurer Simulation?“
„Wir geben alles Wissen und – wo noch kein fundiertes Wissen existiert – alle Annahmen, die wir dazu bisher getroffen haben, über die Zustände auf der Erde im interessierenden Zeitabschnitt und Lebensraum der menschlichen Vorfahren in den Computer ein. Das ist so zu sagen ein Teilmodell der Welt. Und mit diesem Teilmodell arbeiten wir. Da gibt es Tausende von Parametern, die wir einzeln oder gebündelt in der einen oder anderen Richtung verändern können, zum Beispiel unterschiedliche Klimaentwicklungen mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Der Mensch kann gedanklich nie so viele Möglichkeiten durchspielen, und schon gar nicht in einer akzeptablen Zeit. Da ist uns der Computer eine große Hilfe. Der rechnet Millionen von unterschiedlichen Kombinationen und Varianten binnen kurzer Zeit durch und zeigt im Ergebnis die Auswirkungen der unterschiedlichen Einflüsse auf das Geschehen. Und wir wollen sehen, ob es irgendeine Konstellation gibt, die bei unseren Vorfahren zur verstärkten Ausprägung von Intelligenz führte. Wir gehen dabei von der Entwicklungsstufe der Affen aus, die ja bereits über eine gewisse Intelligenz verfügten und verfügen. Die waren ja nicht nur doof. Aber was uns eben am meisten interessiert, ist der quasi-sprunghafte Zugewinn an Intelligenz – die Emergenz, das plötzliche Entstehen von etwas Neuem.“
„Interessant!“ fanden die Kinder.
„Und gesetzt den Fall, eure Simulation liefert euch ein Ergebnis, wie oder woran erkennt ihr dann die höhere Intelligenz?“ wollte Long wissen.
„Na, unter anderem daran, wie diese simulierten Lebewesen agieren; also, wenn sie beispielsweise zum ersten Mal zielgerichtet gehandelt haben.“
„Was zum Beispiel?“
„Denkt doch einfach mal daran, daß sie irgendwann begannen, Werkzeuge herzustellen und für die Bearbeitung von Holz und Stein zu benutzten, oder Jagdwaffen anzufertigen, um leichter und schneller Beute machen zu können, oder Feuer zu machen, um Fleisch zu garen“, erläuterte Chan.
„Ah! Da gibst du mir ein gutes Stichwort“, unterbrach Qiang sie. „Solange man etwas nicht definitiv weiß, kann man ja alle möglichen Hypothesen aufstellen. Und gerade für dieses Thema gibt es eine ganze Reihe davon. Eine besagte zum Beispiel, daß das beschleunigte Hirnwachstum auf den Verzehr von Geröstetem, Gegartem beziehungsweise Gekochtem zurückzuführen sei.“
„Ja, und eine andere These besagt“, unterbrach ihn Chan, „daß mit zunehmend reichhaltigerer Speisekarte unserer Vorfahren auch deren Gehirn immer größer wurde.“
„Im Ernst?“ fragte Jiao sichtlich skeptisch. „Ich meine, daß eine ausgewogene Ernährung gut und notwendig für eine gesunde – körperliche und geistige – Entwicklung des Menschen ist, das wissen wir ja schon lange. Aber ich habe noch keinen gesehen, der dadurch ein größeres Gehirn bekommen hätte.“
„Ich auch nicht“, entgegnete Chan. „Das werden wir auch nicht erleben. Denn so schnell geht das mit der Evolution nicht: Die Entwicklung des Homo sapiens hat immerhin rund zwei Millionen Jahre gedauert! Und doch wissen wir heute nachweislich, wie wichtig bestimmte Stoffe für unser Denkorgan sind, die wir mit der Nahrung aufnehmen, wie beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren: Sie wirken unmittelbar auf die Nervenzellen ein. Ein Vertreter dieser Klasse ist die Docosahexaensäure, die an der Signalübertragung zwischen den Nervenzellen beteiligt ist und damit zum normalen Funktionieren des Gehirns beiträgt. Ein Mangel an diesen Säuren kann zu Aufmerksamkeitsstörungen, Rechtschreibschwäche, Depression und sogar zu Demenz führen, wie Untersuchungen gezeigt haben. Und umgekehrt konnte die geistige Leistungsfähigkeit bei jungen wie alten Menschen durch regelmäßige, erhöhte Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren gesteigert werden.“
„Oh, dann will ich mir doch gleich einmal ´ne Ladung Omega-3-Fettsäuren reinziehen!“ rief Jie scherzend. „Wo kriege ich die her?“
„Fisch, mein Junge! Jede Menge Fisch!“ antwortete Chan lakonisch.
„Nur in Fisch?“
„Nicht nur in Fisch, sondern auch in Walnüssen, Kiwi und Leinsamen beispielsweise, aber hauptsächlich in Fisch! Und daraus resultiert die erwähnte These mancher Wissenschaftler, daß das verstärkte Wachstum des Gehirns bei den Hominiden mit deren Fähigkeit zum Fischfang einhergegangen sei.“
„Und? Glaubst du daran?“, wollte Long wissen.
„Nicht wirklich“, antwortete Chan. „Und mit Glauben ist hier sowieso nichts gewonnen. Unstrittig ist immerhin die Tatsache, daß die Zusammensetzung der Nahrung einen großen Einfluß auf unsere körperliche und geistige Entwicklung hat. Unstrittig ist auch, daß viele Botenstoffe im Gehirn aus einfachen Aminosäuren bestehen, die der Körper selber produzieren kann, solange eine ausreichende Grundnahrungsversorgung gegeben ist. Darüber hinaus aber gibt es eben auch andere Stoffe, wie beispielsweise Antioxidantien oder die Aminosäure Tryptophan, die der Mensch nicht selbst herstellen kann. Solche wichtigen Stoffe – Antioxidantien schützen die Synapsen vor schädlichen Zerfallsprozessen, und Tryptophan wird im Gehirn durch Enzyme in den bekannten Botenstoff Serotonin umgewandelt – müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Deshalb sind verschiedene Wissenschaftler davon überzeugt, daß man durch eine geeignete Zusammensetzung der Nahrung die kognitiven Fähigkeiten steigern, das Gehirn vor schädlichen Prozessen schützen und sogar dem Alterungsprozeß entgegenwirken kann. Nur fundiert beweisen läßt sich das leider nicht. Der Mensch ist schließlich kein Versuchskaninchen. Man kann ja nicht einer statistisch relevanten Personengruppe alle diese wichtigen Stoffe über einen längeren Zeitraum vorenthalten, nur um zu sehen, ob sich irgendwann vermehrt degenerative Prozesse einstellen. Für so einen Versuch würde sich niemand freiwillig hergeben – und mit Recht! Also gibt es keine abschließende Antwort.“
„Schade! Und was ist mit der anderen These? Mit dem Gekochten oder Gebratenen?“ wollte Jie von Qiang wissen.
„Ja, da ist die Argumentation wie folgt: Um 2.000 Kilokalorien zu sich zu nehmen, benötigt der Mensch eine Nahrungsmenge von entweder fünf Kilogramm rohe, vegetarische Kost oder drei Kilogramm rohe Mischkost mit einem Anteil von 250 Gramm rohem Fleisch oder 1,9 Kilogramm gekochte Mischkost mit einem Anteil von 100 Gramm Fleisch. Das heißt, mit gekochter Nahrung muß man also mengenmäßig weit weniger zu sich nehmen als mit Rohkost, denn durch das Kochen wird weiche, besser verdaubare und vor allem energiereiche Nahrung produziert. Gekochte Kartoffeln enthalten beispielsweise etwa 80 Prozent mehr verdaubare Kalorien als rohe. Und da das Gehirn einen großen Energiebedarf hat – bei einem erwachsenen Menschen verbraucht das Gehirn rund ein Viertel der Gesamtenergie, bei Neugeborenen sogar bis zu 60 Prozent –, war die erhöhte Energiezufuhr durch gekochte oder gebratene Nahrung für die Entwicklung unseres Denkorgans gewissermaßen eine notwendige Voraussetzung. Das Gehirnvolumen hat sich im Laufe der Evolution von etwa 0,38 Liter beim Australopithecus über 0,9 Liter beim Homo erectus bis auf 1,35 Liter beim Homo sapiens vergrößert.“
„Also kurz gesagt: Die Verbesserung der Nahrungsqualität hat die Vergrößerung des Gehirns und damit eine deutliche Steigerung der Intelligenz überhaupt erst möglich gemacht?“ resümierte Long.
„So die Hypothese, ja“, bestätigte Qiang.
„Und was hältst du davon?“ wollte Jiao wissen.
„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Bisher ist weder die Richtigkeit der Hypothese noch das Gegenteil nachgewiesen“, gab Qiang zu bedenken. „Das gleiche Problem wie vorher.“
„Und du, Mam? Was denkst du?“
„Ich weiß es genau so wenig wie alle anderen. . . . Ich könnte mir eventuell vorstellen, daß die erheblich verbesserte Nahrungsqualität eine notwendige Bedingung war – aber eine hinreichende?“
„Immerhin ist der Mensch, das einzige wirklich intelligente Lebewesen auf der Erde, auch das einzige, das gekochte Nahrung zu sich nimmt, während Fisch ja bekanntlich auch von anderen Tieren gefressen wird“, sagte Jie.
„Das ist richtig, ja“, entgegnete Chan. „Dennoch neige ich eher zu zweifeln, ob dies tatsächlich der alleinige Grund gewesen sein kann. Im übrigen ist dies ja auch kein Beweis. Es kann eine rein zufällige Koinzidenz sein.“
„Es wird ja auch vermutet, daß mit dem Kochen das gemeinsame Sitzen und Verzehren der warmen Mahlzeit an der Kochstelle begann und auf diese Weise zur Herausbildung eines gewissen Sozialgefüges führte“, sagte Qiang.
„Ah! Guter Gedanke!“ rief Jie spontan dazwischen. „Ich habe mal gehört, daß eigentlich die Sprache das entscheidende Kriterium für die Gehirnentwicklung gewesen sein soll. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, daß die am Lagerfeuer zusammengesessen und geklönt haben, und daß sich dabei mit der Vervollständigung der Sprache auch die Intelligenz verbessert hat. Dann wäre aber die Entwicklung der sprachlichen Verständigung das primär treibende Element für die Intelligenz, die warme Nahrung nur ein Sekundäreffekt.“
„Wieso Sekundäreffekt?“ fragte Jiao.
„Na, einfach weil die Verständigungsqualität nur verbessert werden konnte, wenn das Gehirn sich entsprechend mit entwickelte. Und dies konnte es durch die energiereichere warme Nahrung“, erläuterte Jie.
„Typisches Henne-Ei-Problem, scheint mir“, sagte Long. „Was war zuerst da: Der Drang zur Verständigung, also die Herausbildung von Sprache? Oder das bessere Essen und damit verbunden das Wachstum der Hirnmasse?“
„Also, ich weiß nicht“, gab Jiao ihrem Zweifel Ausdruck. „Kalorienreicheres Essen macht doch eigentlich nur dick. Wieso sollte denn dadurch plötzlich Intelligenz entstehen? Nach dieser Logik müßten ja alle Dicken besonders intelligent sein!“
„Der Einwand ist berechtigt“, bestätigte Chan. „Und er unterstützt meine Annahme von einer vielleicht notwendigen, aber sicher nicht hinreichenden Bedingung. Richtig ist jedenfalls die Tatsache, daß der Mensch sich von allen anderen Lebewesen durch seine Fähigkeit zur grammatisch-syntaktischen Sprache unterscheidet, während er seine intellektuellen Fähigkeiten zumindest partiell und in unterschiedlichem Maße mit anderen Tieren teilt. Insofern spricht vieles dafür, daß die enorm erhöhten intellektuellen Fähigkeiten des Menschen in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der komplexen Sprache stehen.“
„Aber die intellektuellen Fähigkeiten bei Tieren sind doch in keiner Weise mit denen der Menschen zu vergleichen“, wandte Jiao ein.
„Das habe ich auch nicht behauptet“, entgegnete Chan. „Tatsache ist aber, daß es tierische Intelligenz gibt. Das haben viele Beobachtungen von Verhaltensforschern in freier Natur sowie zahlreiche Studien und Testreihen an ganz unterschiedlichen Tierarten – insbesondere Säugetiere und Vögel – unter Laborbedingungen nachgewiesen. Natürlich ist es nicht einfach, tierische Intelligenz zu messen. Denn da wir uns mit ihnen ja nicht unterhalten können, ist es schon beliebig schwierig, ihnen überhaupt mal eine Aufgabenstellung zu vermitteln. Und das Ergebnis kann auch wieder nur durch Interpretation ihres Reaktionsverhaltens gedeutet werden. Aber trotz aller Schwierigkeiten kam man zu dem klaren Ergebnis, daß es tierische Intelligenz gibt, die sich allerdings in ganz unterschiedlicher Weise äußern kann – und zwar nicht nur bei den Primaten, wie man anfangs glaubte, sondern auch bei ganz anderen Tierarten.“
„Bei welchen?“
„Bei den Meeressäugern, also den Delphinen und Walen, zum Beispiel. Bei Ratten, aber auch bei den Rabenvögeln, Eulen und Papageien.“
„Und wie äußert sich deren Intelligenz?“ wollte Jie wissen.
„Unterschiedlich. Beispielsweise durch Werkzeugherstellung und -gebrauch, Lernfähigkeit, Gedächtnisleistung, teilweise sogar Zahlenverständnis. Manche scheinen sich ganz offenkundig auch selbst im Spiegel zu erkennen. Oder andere Merkmale wie ihre Fähigkeit zur Täuschung anderer, zur Empathie im sozialen Miteinander, zur Kooperation bei ihren Beutezügen, oder ganz allgemein ihre Verhaltensflexibilität.“
„Und warum hat sich deren Intelligenz evolutionär nicht weiterentwickelt?“
„Gute Frage. Offenbar sind bei denen einige wichtige Voraussetzungen dafür nicht gegeben gewesen.“
„Als da wären?“
„Nun, da ist zunächst einmal das Gehirn selbst – die Quelle der Intelligenz. Dessen Anatomie, Größe und Masse, vor allem aber auch die Anzahl der Neuronen sind sehr unterschiedlich. Das menschliche Gehirn hat im Vergleich zu allen anderen Tierarten den mit Abstand höchsten Intelligenzgrad erreicht, das heißt, sein Aufbau ist im gegenwärtigen Entwicklungsstadium optimal.“
„Wieso diese Einschränkung?“
„Wir können nur über den gegenwärtigen Entwicklungsstand sprechen, denn nur den kennen wir. Aber die Evolution geht ja weiter. Wir können also nicht ausschließen, daß es irgendwann einmal noch intelligentere Lebewesen auf dieser Erde gibt. Das werden wir allerdings nicht mehr erleben.“
„Wieso nicht?“ fragte Jie. „Du hast doch vorhin selbst gesagt, in der Evolution hat es schon öfter Sprünge gegeben.“
„Ja, ja. Das ist schon richtig. Aber Sprünge in der Evolution spielen sich nicht in Tagen, Monaten oder Jahren ab, sondern in Hunderttausenden oder gar Millionen von Jahren. Nach unseren Erkenntnissen begann die rasante Entwicklung der Gehirne unserer Vorfahren vor etwa zwei Millionen Jahren und erreichte mit dem Homo sapiens vor etwa 100.000 Jahren die heute übliche Größe. Dieser sogenannte Entwicklungssprung vollzog sich also über einen Zeitraum von annähernd zwei Millionen Jahren! Aber im Zeit-Maßstab der Entstehungsgeschichte unserer Erde seit über viereinhalb Milliarden Jahren ist es eben doch nur ein kurzer Moment.“
„Immerhin hunderttausend Jahre! Da wäre doch mal wieder ein Entwicklungssprung angebracht, oder?“ flachste Jie.
Long und Jiao lachten, und die Eltern mußten schmunzeln.
„Um noch mal auf das Gehirn zurückzukommen“, nahm Chan ihren Faden wieder auf, „läßt sich mit Fug und Recht behaupten, daß es inzwischen weitgehend erforscht ist. Das menschliche Gehirn stellt demnach das gegenwärtige Optimum in der Entwicklungsgeschichte dar und wird deshalb als Maßstab in vergleichenden Untersuchungen an tierischen Gehirnen herangezogen. Nun haben wir ja vorhin gesagt, daß sich das menschliche Gehirn in den letzten zwei Millionen Jahren stark vergrößert hat. Dies allein kann aber nicht die Ursache für unsere höhere Intelligenz sein. Denn andernfalls müßten große Tiere wie Wale, Elefanten und selbst Pferde und Kühe intelligenter sein als der Mensch. Weder die absolute Hirngröße noch ihre Masse geben den Ausschlag für die Intelligenz. Und auch beim relativen Hirngewicht, also dem Verhältnis von Hirn- zu Körpermasse, schneidet der Mensch nicht besser ab als viele Tiere, sondern sogar schlechter als die Maus beispielsweise. Beim Vergleich der Anatomien hat man festgestellt, daß das menschliche Gehirn dem anderer Säugetierarten – und insbesondere dem der Menschenaffen – sehr ähnlich ist. Sie verfügen ebenfalls, wie der Mensch, über einen Neocortex, auch als Großhirnrinde bekannt, und einen präfrontalen Cortex. Beide zusammen bilden die stoffliche Grundlage und den Ort für all das, was wir unter Intelligenz, Vernunft, kognitiver Fähigkeiten, Handlungsplanung, Bewußtsein und Persönlichkeit verstehen. Und beide sind bei einigen Säugern, wie Walen, Delphinen und Elefanten, größer als beim Menschen. Aber trotzdem kann deren Intelligenz bei weitem nicht mit unserer mithalten. Entscheidend für die Intelligenz sind also nicht Größe und Gewicht des Gehirns – weder absolut noch relativ –, sondern andere Kriterien. In Frage kämen beispielsweise auch die Anzahl, Dichte und Vernetzung der Neuronen, die Zahl der Synapsen je Neuron sowie die Leistungsfähigkeit des Neuronennetzwerks. Aber auch hier unterscheiden sich die anatomischen und physiologischen Eigenschaften des menschlichen Gehirns nicht wesentlich von denen der Wale, Delphine und Elefanten. So besitzt der Mensch rund 11,5 Milliarden Neuronen im Cortex, aber die genannten Tiere haben nur etwa eine halbe Milliarde weniger. Der Mensch hat rund 30.000 Synapsen je Neuron, die Tiere haben nur geringfügig weniger. Lediglich die Abstände zwischen den Neuronen sind bei den Tieren wegen ihrer größeren Gehirnabmessungen etwas größer, und damit dauern die Übertragungszeiten etwas länger. Aber das würde ja höchstens bedeuten, daß ihre Denkprozesse langsamer abliefen. Also, auch das ist keine Erklärung für die unterschiedliche Intelligenz. So bleibt als wirklich auffälliger relevanter Unterschied der Gehirne ein feinverästeltes Netzwerk im linken Stirnhirn – das sogenannte Broca-Sprachareal –, das in dieser Form nur bei dem Menschen vorkommt und ihm einen großen Wortschatz und eine Satzbildung mit komplizierter Grammatik ermöglicht. Und das legt den Schluß nahe, daß mit der Entwicklung der komplexen Sprache und der damit einhergehenden Herausbildung dieses Broca-Areals auch der Cortex insgesamt an Größe, Masse, Ausdifferenzierung und damit an komplexerer Verarbeitungskapazität und Intelligenzvermögen gewonnen hat.“
„Das hab’ ich doch vorhin schon gesagt!“ warf Jie ein. „Die saßen am Lagerfeuer und haben geklönt. Hab’ ich das nicht gesagt?“
„Ja, ja. Das hast du gesagt – kleiner Klugscheißer!“ sagte Long etwas bissig. Dann wandte er sich seiner Mutter zu und fragte: „In der Schule habe ich mal gelernt, daß mit dem aufrechten Gang ja die Hände gewissermaßen ‚frei’ wurden und somit immer mehr andere Tätigkeiten ausgeführt werden konnten – praktisch-handwerkliche und künstlerische. Auf diese Weise verbesserte sich ihre Feinmotorik, die immer höhere Anforderungen an die Intelligenzleistung stellte. Also, kann die Steigerung der Intelligenz nicht auch dadurch bedingt gewesen sein? Immerhin unterscheidet sich der Mensch ja auch dadurch von allen Tieren, daß er seine Hände so vielseitig einsetzen kann – auch gestalterisch, was sicher auch seine Kreativität gefördert hat.“
„Das ist ein gutes Argument, Long“, antwortete Chan. „Ich kann mir gut vorstellen, daß es diesen Zusammenhang auch gegeben haben mag. Denn der praktische Gebrauch der Hände zur Herstellung und zum Gebrauch von Werkzeugen oder Waffen setzt natürlich schon eine gewisse Intelligenz voraus – und umgekehrt fördert es ganz sicher auch die intellektuelle Kapazität und die Kreativität. Auf der anderen Seite wird von den Forschern die Entwicklung der komplexen Sprache auf etwa 80.000 bis 100.000 Jahre zurückdatiert. Und das ist genau der Zeitraum, als der Homo sapiens mit seinem deutlich größeren Gehirn die Weltbühne betrat, während der aufrechte Gang und der Werkzeuggebrauch deutlich früher einsetzte. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, daß der sogenannte Homo habilis vor rund zwei Millionen Jahren auftrat, und mit diesem begann bereits das Hirnwachstum. Also, dein Argument, Long, ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Aber ebenso offenkundig ist auch, daß die bis dahin schon bestehenden intellektuellen Fähigkeiten mit der Entwicklung der komplexen Sprache enorm gesteigert wurden.“
„Also noch zu viele Vermutungen und zu wenig gesichertes Wissen!“ resümierte Long.
„Na, ganz so würde ich das nicht sehen“, entgegnete Chan. „Wir wissen bereits sehr viel, aber es fehlen noch ein paar ‚Bausteine’ in der Beweiskette, um endgültige Gewißheit zu haben. So komplexe Entwicklungsvorgänge gehen ja normalerweise nicht einfach nur ‚straight ahead’ vor sich, wo immer schön seriell ein Baustein auf dem anderen aufbaut. Vielmehr entwickeln sich verschiedene Dinge parallel, und da ist es nicht immer einfach, Ursache und Wirkung klar zuzuordnen. Aber gerade weil es immer noch die eine oder andere Ungewißheit gibt, deshalb wollen wir ja versuchen, diese und andere Thesen durch Simulationen zu verifizieren.“
„Na, da habt ihr euch ja was Schönes vorgenommen“, sagte Long mit einem Ausdruck von Bewunderung und Zweifel zugleich.
„Sicher! Es ist eine riesige Herausforderung!“ bestätigte Chan. „Aber das macht die Aufgabe ja gerade so interessant! Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder.“
„Eine Aufgabe für Jahre, schätze ich!“
„Sicher wird das eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Aber Jahre? Wir sind noch bei der Abschätzung. Am meisten Zeit benötigen wir zunächst für die Modellierung der Welt vor etwa zwei Millionen bis 50.000 Jahren mit all den Rahmenbedingungen und Parametern, die nach heutigem Kenntnisstand als gesichert oder zumindest sinnvoll erscheinen. Die Programmierung und Verifizierung dieses Modells erfolgt ja mit der Definition weitgehend automatisch, wird also kaum zusätzliche Zeit beanspruchen. Die eigentlichen Simulationsläufe nehmen vielleicht wenige Wochen in Anspruch. Und das auch nur, weil wir so viele unterschiedliche Varianten durchrechnen müssen. Ein einzelner Durchlauf über den betrachteten Zeitraum von fast zwei Millionen Jahren dauert am Computer ja angesichts der heute verfügbaren Prozessorleistung nur ungefähr knapp zwei Stunden. Aber dann die Auswertung der Millionen und Abermillionen von Simulationen – das wird trotz Unterstützung durch entsprechende Bewertungsprogramme neben der Modellierung die allermeiste Zeit kosten.“
„Na, dann viel Spaß dabei!“ sagte Jie, räkelte sich und gähnte herzhaft.
„Ich bin auch schon total müde“, sagte Jiao. „Können wir die Sitzung vertagen?“
„Oh ja, es ist ja schon so spät!“ bemerkte Chan, als sie auf die Uhr schaute. „Also ab ins Bett!“
„Wetten, daß ich als erster im Bett bin?“ rief Jie, sprang auf und rannte davon. Long und Jiao folgten ihm, und ihre Eltern amüsierten sich darüber.